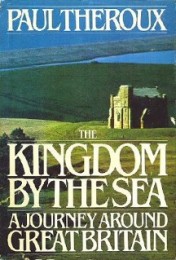Peter Münder
„Ich brauche kein Aspirin – ich fahre nach Indien!“
Mit seinen pittoresken Railway-Reportagen „The Great Railway Bazaar“ (1975) und „The Old Patagonian Express“ (1979) war der amerikanische Autor Paul Theroux, 77, schnell zum Kult-Autor avanciert. Dann erkundete er 1982 entlang der britischen Küsten „The Kingdom by the Sea“ per Bahn sowie wandernd und wurde in englischen Medien heftig wegen polemischer Verzerrungen und düsterer Untergangs-Szenarios kritisiert. Nach diversen Afrika- Reisen („Dark Star Safari“, „Last Train to Zona Verde“) und seiner Pazifik-Exkursion mit einem zusammenklappbaren Faltboot („The Happy Isles of Oceania“, 1992) hatte er 2015 im Auto die US-Südstaaten bereist und sich in „Deep South“ eine Anthropologen-Perspektive angeeignet, die historische Exkurse mit einprägsamen Alltags-Impresssionen aus dem Armenhaus der USA verbindet. Zwischen Flucht-Reflexen, Abenteurer-Lust, Bildungsbeflissenheit und anthropologischem Forschungsbericht bewegten sich Reiseberichte ja immer schon – was also charakterisiert den besonderen Stil von Theroux und macht ihn so faszinierend?
Als Rashid, der Schlafwagenschaffner der Khyber Mail nach Lahore, dem in Peshawar zugestiegenen Paul Theroux sein Abteil gezeigt hatte, sperrte er sofort seinen Mund weit auf und zeigte dem Amerikaner seinen schmerzenden Zahn. Den Eisenbahn-Fan aus Medford überraschte das keineswegs – schließlich hatte er sich ja gerade als Zahnarzt ausgegeben, weil er die langen Erklärungen satt hatte, mit denen er unterwegs all die Fragen wie „Where you from? Married or single? Any children? What is your profession? How is your wife?“ beantworten sollte. Theroux riet Rashid also, auf der anderen Backenseite zu kauen und in Karachi einen Zahnarzt zu konsultieren. Außerdem bekam der Schaffner noch zwei Aspirin, damit war der Fall erledigt. Für den ehemaligen Peace Corps-Helfer und Lehrer in Malawi und Uganda war dieser von London Waterloo Station bis nach Singapur, Japan, Vietnam und in die Sowjetunion absolvierte Eisenbahntrip ein wunderbares, befreiendes Erweckungserlebnis: Den Krach mit der Ehefrau konnte er erstmal hinter sich lassen, er hatte jeden Tag auf seiner Railway-Tour üppigen Stoff zu destillieren, den er für sein geplantes Reisebuch verarbeiten konnte: Der Trip war die reine Medizin für ihn, wie er im „Great Railway Bazaar“ schrieb: „Ich brauche kein Aspirin, ich fahre nach Indien“.
 Auf den Gängen, im Schlafwagen, im Speisewagen fand Theroux wie auf einem riesigen Basar Menschen aus allen möglichen Ländern, mit unterschiedlichsten Berufen und biographischen Hintergründen. Das reichte ihm, um seine Neugier zu befriedigen und etwas Abenteuerluft zu schnuppern. Wo sonst konnte man sich so bequem einigeln und elegeant dinieren? „Dinner in the diner – nothing could be finer“ schwärmt Theroux. Dazu noch die erfrischende, amüsante und intelligente Lektüre (hier Tschechows Novelle „Ariadne“, Dickens „Little Dorritt“ u.a.) – was will man mehr? Aus diesem rollenden Kokon wollte sich der Langstrecken-Traveller am liebsten nicht mehr befreien. Bedauerlich daher, dass die Fahrt nach Lahore nur zwölf Stunden dauerte. Ähnlich war es dann beim Railway-Trip nach Patagonien: Dieser Mix aus exotischer Fremde, realistischen Alltags-Details und ungekünstelten Dialogen, die mit informativen Hintergrundinformationen gefüttert waren, erwies sich als grandioses Erfolgsrezept und machte ihn schnell zum Kultautor. Aber war er als Durchreisender in Asien und Afrika nicht darauf angewiesen, immer nur kurze Momentaufnahmen zu liefern? War es nicht möglich, sich auch mal einen Gesamteindruck mit einer gewissen Tiefenschärfe zu verschaffen und sich an das Psychogramm einer Nation heranzutasten? Das fragte sich Theroux 1982, als er bereits seit elf Jahren in London lebte und ihm bewußt wurde, dass er außer London eigentlich kaum etwas vom UK gesehen hatte: Weder Cornwall noch Devon, weder Wales noch Schottland hatte Paul Theroux besucht und Nord-Irland war für ihn so exotisch-fremd wie Spitzbergen. So griff er sich also im Mai 1982 seinen Rucksack, zog sich seine abgewetzte Lederjacke und die gut eingeölten Wanderstiefel an und packte Landkarten, Regenjacke und einen alten Baedeker von 1906 ein. Es sollte eine von Margate an der Südostküste gelegene Rundreise entlang der Küste um „The Kingdom by the Sea“ werden: Mit der Bahn und zu Fuß wollte der Traveller, der inzwischen auf Hawaii lebt, sich in einfachen B&Bs einquartieren, alle touristischen Sehenswürdigkeiten ignorieren und eintauchen in den britischen Alltag. Ganz im Gegensatz zum London-Schwärmer Dr. Johnson und dessen Kalenderweisheit „A man who is tired of London is tired of Life“ war Theroux regelrecht angepestet vom Moloch London. Vom Verkehr, dem Dreck und Gestank, von den Graffiti-Schmierereien, der auf Wäscheleinen hängenden Unterwäsche und der Blasiertheit der Londoner, die ihre Megapolis nicht als Stadt, sondern als unabhängige Republik betrachteten. Für den amerikanischen Betrachter stellte sich das „Floating Kingdom“ jedenfalls als irritierende Enklave dar, in der er eigentlich nie richtig zu Hause war.
Auf den Gängen, im Schlafwagen, im Speisewagen fand Theroux wie auf einem riesigen Basar Menschen aus allen möglichen Ländern, mit unterschiedlichsten Berufen und biographischen Hintergründen. Das reichte ihm, um seine Neugier zu befriedigen und etwas Abenteuerluft zu schnuppern. Wo sonst konnte man sich so bequem einigeln und elegeant dinieren? „Dinner in the diner – nothing could be finer“ schwärmt Theroux. Dazu noch die erfrischende, amüsante und intelligente Lektüre (hier Tschechows Novelle „Ariadne“, Dickens „Little Dorritt“ u.a.) – was will man mehr? Aus diesem rollenden Kokon wollte sich der Langstrecken-Traveller am liebsten nicht mehr befreien. Bedauerlich daher, dass die Fahrt nach Lahore nur zwölf Stunden dauerte. Ähnlich war es dann beim Railway-Trip nach Patagonien: Dieser Mix aus exotischer Fremde, realistischen Alltags-Details und ungekünstelten Dialogen, die mit informativen Hintergrundinformationen gefüttert waren, erwies sich als grandioses Erfolgsrezept und machte ihn schnell zum Kultautor. Aber war er als Durchreisender in Asien und Afrika nicht darauf angewiesen, immer nur kurze Momentaufnahmen zu liefern? War es nicht möglich, sich auch mal einen Gesamteindruck mit einer gewissen Tiefenschärfe zu verschaffen und sich an das Psychogramm einer Nation heranzutasten? Das fragte sich Theroux 1982, als er bereits seit elf Jahren in London lebte und ihm bewußt wurde, dass er außer London eigentlich kaum etwas vom UK gesehen hatte: Weder Cornwall noch Devon, weder Wales noch Schottland hatte Paul Theroux besucht und Nord-Irland war für ihn so exotisch-fremd wie Spitzbergen. So griff er sich also im Mai 1982 seinen Rucksack, zog sich seine abgewetzte Lederjacke und die gut eingeölten Wanderstiefel an und packte Landkarten, Regenjacke und einen alten Baedeker von 1906 ein. Es sollte eine von Margate an der Südostküste gelegene Rundreise entlang der Küste um „The Kingdom by the Sea“ werden: Mit der Bahn und zu Fuß wollte der Traveller, der inzwischen auf Hawaii lebt, sich in einfachen B&Bs einquartieren, alle touristischen Sehenswürdigkeiten ignorieren und eintauchen in den britischen Alltag. Ganz im Gegensatz zum London-Schwärmer Dr. Johnson und dessen Kalenderweisheit „A man who is tired of London is tired of Life“ war Theroux regelrecht angepestet vom Moloch London. Vom Verkehr, dem Dreck und Gestank, von den Graffiti-Schmierereien, der auf Wäscheleinen hängenden Unterwäsche und der Blasiertheit der Londoner, die ihre Megapolis nicht als Stadt, sondern als unabhängige Republik betrachteten. Für den amerikanischen Betrachter stellte sich das „Floating Kingdom“ jedenfalls als irritierende Enklave dar, in der er eigentlich nie richtig zu Hause war.
Katharsis beim Pajama Game
Um wirklich frei und unabhängig zu sein, hatte er keine Reservierungen für Unterkünfte, Eisenbahn etc. veranlaßt: „I had no one to wait for, no tickets to buy, no appointments. And the next time I find out that a hotel is dirty and I dont like the people, I´ll leave, I thought. I´ll just push on and find a better one. I liked thinking that I was always making progress whenever I was walking away.“ Dieses kleine Manifest nennt er seine „liberating fantasy of running away“.
Da Theroux den Dingen auf den Grund gehen und den Reisebekanntschaften auf den Zahn fühlen will, ist es für ihn auch selbstverständlich, nicht den Lemmingen zu folgen, die Museen, Kirchen oder Denkmäler besichtigen: Seine attraktivsten Ziele sind die von Kennern verächtlich als „totally unremarkable“ oder „nothing there to see“ abgetanen Locations: „Of course I went there straighaway“, konstatiert er trocken. Als kulturhistorisch kuriosen Exkurs betrachtet er seine Besuche von Musicals, Operettenkonzerten und verstaubten komischen Stücken wie „The Pajama Game“, das er sich in Teignmouth gönnt. Es sind kathartische Eskapaden, nach deren Genuß „players and spectators alike felt much better“. Und bei seiner Belfast-Exkursion, als Attentate und Bombenexplosionen noch an der Tagesordnung waren, schreibt er genüßlich: „Belfast was so awful, I wanted to stay.“
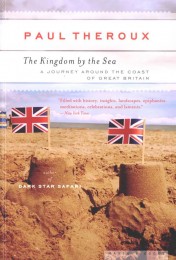 Wie ein skeptischer Anthropologe unter exotischen Stämmen registriert er die merkwürdigen Verhaltensmechanismen der Einheimischen: Ihre indirekte Art, irgendwie zu kaschieren, was offensichtlich ist und aus ihrem Gemauschel Profit zu schlagen: Da wird ihm meistens suggeriert, das B&B, in dem er übernachten will, sei total ausgebucht und dementsprechend teuer, obwohl er der einzige Gast ist – so zahlt er also zehn Pfund für eine Übernachtung statt der üblichen sieben Pfund. Als dreizehnjährige tätowierte Skinhead-Schnösel während der Bahnfahrt mit aggressivem Gehabe die Fahrgäste in Angst und Schrecken versetzen, wagt niemand, dagegen zu protestieren – man duckt sich einfach weg und ignoriert die Bösewichter, die zur Massenschlägerei in einen Badeort fahren. Die Butlins Holiday Camps, in denen Familien sehr günstig ihre Ferien verbringen, hält er für KZs: Im eingezäunten, von Wachleuten beaufsichtigten Areal ist nämlich alles standardisiert und streng reglementiert. In den Badeorten kommt Theroux, der sich auf seiner Tour übrigens nicht als Autor outet, sondern seinen Beruf als „In Publishing“ angibt, aus dem Staunen gar nicht mehr heraus: Die Leute starren stundenlang aufs Meer und mampfen dabei ihre Fish&Chips – am liebsten im parkenden Auto oder in ihren normalen Straßenklamotten im Liegestuhl. Bei diesem Anblick, notiert Theroux, habe er immer an Becketts „Warten auf Godot“ gedacht. Verblüfft registriert er auch, dass sich selbst bei schönstem Wetter – egal ob in Brighton, Hove oder Southend – es meistens nur zwei Badegäste von einigen hundert wagen, sich in die Fluten zu stürzen. Und hier, beim Grübeln über die Meeresbetrachter, die verzückt und versunken vor den donnernden Wellen stehen, läuft der extrem belesene Theroux zu großer Form auf, weil ihm Zitate von Elias Canetti (aus „Masse und Macht“) einfallen, die illustrieren sollen, wie stark das Meer sich auf die nationale Identitätsbildung auswirken kann: Triumphe und Katastrophen der englischen Geschichte sind gleichermaßen mit dem Meer verbunden – das Meer habe dem Engländer Wandel und Gefahr gebracht; laut Canetti sehe sich der Engländer als Kapitän, sein Individualismus beziehe sich aufs Meer.
Wie ein skeptischer Anthropologe unter exotischen Stämmen registriert er die merkwürdigen Verhaltensmechanismen der Einheimischen: Ihre indirekte Art, irgendwie zu kaschieren, was offensichtlich ist und aus ihrem Gemauschel Profit zu schlagen: Da wird ihm meistens suggeriert, das B&B, in dem er übernachten will, sei total ausgebucht und dementsprechend teuer, obwohl er der einzige Gast ist – so zahlt er also zehn Pfund für eine Übernachtung statt der üblichen sieben Pfund. Als dreizehnjährige tätowierte Skinhead-Schnösel während der Bahnfahrt mit aggressivem Gehabe die Fahrgäste in Angst und Schrecken versetzen, wagt niemand, dagegen zu protestieren – man duckt sich einfach weg und ignoriert die Bösewichter, die zur Massenschlägerei in einen Badeort fahren. Die Butlins Holiday Camps, in denen Familien sehr günstig ihre Ferien verbringen, hält er für KZs: Im eingezäunten, von Wachleuten beaufsichtigten Areal ist nämlich alles standardisiert und streng reglementiert. In den Badeorten kommt Theroux, der sich auf seiner Tour übrigens nicht als Autor outet, sondern seinen Beruf als „In Publishing“ angibt, aus dem Staunen gar nicht mehr heraus: Die Leute starren stundenlang aufs Meer und mampfen dabei ihre Fish&Chips – am liebsten im parkenden Auto oder in ihren normalen Straßenklamotten im Liegestuhl. Bei diesem Anblick, notiert Theroux, habe er immer an Becketts „Warten auf Godot“ gedacht. Verblüfft registriert er auch, dass sich selbst bei schönstem Wetter – egal ob in Brighton, Hove oder Southend – es meistens nur zwei Badegäste von einigen hundert wagen, sich in die Fluten zu stürzen. Und hier, beim Grübeln über die Meeresbetrachter, die verzückt und versunken vor den donnernden Wellen stehen, läuft der extrem belesene Theroux zu großer Form auf, weil ihm Zitate von Elias Canetti (aus „Masse und Macht“) einfallen, die illustrieren sollen, wie stark das Meer sich auf die nationale Identitätsbildung auswirken kann: Triumphe und Katastrophen der englischen Geschichte sind gleichermaßen mit dem Meer verbunden – das Meer habe dem Engländer Wandel und Gefahr gebracht; laut Canetti sehe sich der Engländer als Kapitän, sein Individualismus beziehe sich aufs Meer.
Falkland-Krieg, Frauenmörder, Bahnstreik
Was den Trip für Theroux interessant und irritierend machte, waren drei Ereignisse: der Falkland-Krieg, über den schon beim Frühstück in den Guest Houses bei der Zeitungslektüre (SUN: „Argies lose two!“) diskutiert wurde, die von einem Frauenmörder an der Südwestküste verübte Mordserie und der Streik der Eisenbahner, der für ihn den Untergang des Landes anschaulich symbolisierte. Die Kriegsberichte in der „Gutter-Press“ wirkten auf ihn wie geifernde Sportberichte, vor allem nachdem der argentinische Zerstörer „Belgrano“ mit 1200 Mann Besatzung von den Briten versenkt worden war. Überrascht registriert er bei seinen Diskussionen statt eines dumpfen Jingoismus nachdenkliche und ratlose Reaktionen, die sich dann aber allmählich dem bellizistischen Tenor der Boulevardpresse angleichen.
Unter dem Mißtrauen und Argwohn von Frauen, denen er während seiner Wanderungen begegnete, scheint Theroux tatsächlich gelitten zu haben: Er berichtet von ihren verkrampften Gesichtern beim Passieren auf engen Pfaden und darüber, dass eine an ihm vorbeigehende Frau sofort in einen schnellen Trab verfiel, als er sich nach ihr umdrehte – diese Episoden waren auf den Frauenmörder zurückzuführen, der zur selben Zeit wie Theroux im Südwesten unterwegs war, dann aber von der Polizei gefasst wurde. Er vermutet auch, dass er als Wanderer von vielen Engländern mißtrauisch beäugt wurde, weil ihnen sein Habitus (Rucksack, geölte Stiefel usw.) suspekt war. Ich würde aus eigener Erfahrung sagen, dass Theroux vielleicht zu skeptisch-kritisch urteilt und viel projiziert: Den meisten Briten dürfte der Aufzug eines Wanderers mit Rucksack jedenfalls völlig schnuppe sein. Offenbar hatte Theroux vor seinem Trip um die Insel noch „Reisen eines Deutschen in England“ von Karl Philip Moritz (1756-1793) gelesen, der sich darüber beklagt, als Wanderer auf seiner Englandreise 1782 schikaniert worden zu sein, weil damals jeder Reisende ohne Kutsche als verarmter Spitzbube behandelt wurde. Moritz wurde damals ja in Herbergen abgewiesen, in Gaststätten wurde ihm oft kein Essen serviert, es grenzte schon an regelrechtes Mobbing. Trotzdem blieb Moritz ein enthusiastischer Anglophiler.
 Vom Traveller zum Systemkritiker
Vom Traveller zum Systemkritiker
Mit seiner analytischen Schärfe, die er in seinem Bericht über die Insel-Rundreise entwickelt, kann Theroux über die detailgetreue Darstellung eines vertrauten Alltagsrealismus hinausgehen und im größeren Kontext gesellschaftskritische Aspekte beleuchten. Die New York Times nannte dieses Verfahren einmal seinen „elliptischen Maximalismus“. Wie er sein Thema einkreist, seine Irritationen angesichts grotesker Alltagssituationen reflektiert und zum analytischen Gesamtergebnis kommt, zeigt sein vernichtendes Aberdeen-Stadtporträt: Der Geldsegen der US-Ölkonzerne verändert den Alltag der einfachen Leute, die Gentrifizierung wird rasant beschleunigt und plötzlich dreht sich alles um die amerikanischen neureichen „Masters of the Universe“. In Klubs wird Theroux abgewiesen, weil er keinen Schlips trägt oder Jeans nicht erwünscht sind. Frisches Obst, normale Lebensmittel sind kaum noch erhältlich, weil die tonangebenden Amerikaner lieber ihre eigenen sterilen, importierten Produkte in Dosen kaufen wollen. Und die sparsamen Schotten bewundern die liquiden Gringos als leuchtende Vorbilder und mutieren plötzlich selbst zu angeberischen Möchtegern-Plutokraten. Theroux notiert auch genau, wie die Zeitungen in Aberdeen nur noch über Finanzmärkte, explodierende Immobilienpreise, teure Autos und Pipeline-Planungen berichteten und den Rest der Welt ausblendeten. Das „Boom Town Ego“ war plötzlich zu einer perversen, synthetischen Größe aufgeblasen, die einem unberechenbaren Egomanen wie Donald T heute sehr gefallen hätte.
Theroux’s kritische Diagnose gilt natürlich auch dem maroden englischen Schienen-Netz und einer aberwitzigen staatlichen Planung, die offenbar systematisch gut funktionierende Verbindungen solange behindert und verfallen lässt, bis sie nicht mehr funktionieren und der Bahnverkehr eingestellt wird. Völlig deplaziert und überzogen sind in diesen britischen Untergangs-Szenarios jedoch seine Anspielungen auf Auschwitz: Er sieht etwa in Dundee viele zerfallene Gebäude und wilde Mülkippen, findet aber völlig intakte städtische Schwimmhallen, die von der Bevölkerung gern benutzt werden, besonders deprimierend, weil „Group Fun“ für ihn furchtbar ist: “This noise and the water and the cold showers and the nakedness could make a swimming pool seem like Auschwitz.“ Diesen Ausraster angesichts einer banalen Alltagssituation mit tobenden Teenies in der Schwimmhalle finde ich jedenfalls genauso aberwitzig wie seine Auschwitz-Assoziation in „Dark Star Safari“, wo er auf dem Weg nach Djibuti in einem klapprigen alten Zug unterwegs ist und schreibt: „This train could be on the way to Auschwitz.“ Gelegentlich wird Theroux offenbar von Obsessionen gepackt, die er nicht richtig in den Griff bekommt – auch seine furiose Abrechnung mit VS Naipaul („Sir Vidia’s Shadow“, 1998) gehört dazu – inzwischen haben sich die beiden schon seit ihrer Zeit als Lehrer in Afrika befreundeten Autoren wieder ausgesöhnt.
Proktologe oder Piranesi?
„What am I doing here?“ hatte sich Theroux ja in seinen letzten Afrika-Berichten öfter gefragt, als er die altbekannte afrikanische Misere, diesen Mix aus Korruption, Aggression und Kleinkriminalität nicht mehr ertragen konnte und in „The Last Train to Zona Verde“ (dtsch. Ein letztes Mal in Afrika) beschloß, nicht länger wie ein Proktologe das Arschloch der Welt zu untersuchen: „Proctology pretty much describes the experience of traveling from one African city to another, especially the horror cities of West Africa.“ Heutzutage, meint Theroux, genüge es nicht mehr, nur als Proktologe Diagnosen zu liefern, man müsse auch, wie Giambattista Piranesi (1720-1778) sich für Ruinen interessieren und aus der Dekadenz römischer Ruinen und den Details untergegangener Zivilisationen einen ästhetischen Genuß ziehen. Von dieser künstlerischen Vision zerfallener Ruinen und vergangenen Ruhms profitierten ja laut Theroux schließlich nicht nur Smollett und Goethe, englische Studenten, Aristokraten und Autoren auf ihrer „Grand Tour“. Aber dieser moderne Piranesi sei er eben nicht. In seinem „Zona Verde“-Fazit bekennt Theroux, Slums, Kloaken und Mega-Cities nicht mehr besichtigen zu wollen, weil sie sich heute weltweit allzusehr ähneln: „There is a point beyond which squalor cannot sink any lower, or get any worse and that is the point which these African cities have reached.“ Sein Bannstrahl trifft vor allem die größenwahnsinnigen Diktatoren mit der „Moral einer Fruchtfliege“, die sich über Dekaden mit parasitären Clans und Bodyguards an der Macht halten. Aber auch die NGOs und Entwicklungshelfer, die diesen Korruptions-Zyklus unterstützen, beurteilt Theroux sehr kritisch.
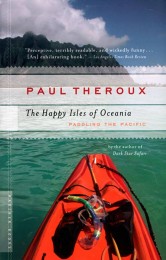 Ohne seine intensive Rundreise durch das „Kingdom by the Sea“ hätte sich sein Blick für das große Gesamtbild hin zu einer Systemkritik wohl kaum so kritisch-scharfsinnig entwickelt. In „The Happy Isles of Oceania“ (1992) spürt man, wie der Inselforscher Theroux hartnäckig den Kern dieser entlegenen Inseln zwischen Neuseeland, den Osterinseln und Hawaii sucht und alte Ausgrabungsstätten besucht, mit Experten auf den Osterinseln über Thor Heyerdaal diskutiert und Thesen zu mittelalterlichen Seefahrer-Routen erörtert. Und nach seiner totalen Melville-Immersion (die erotischen Passagen in „Typee“ und „Omoo“ hatten ihn begeistert ) beobachtet Theroux die Essgewohnheiten der Insulaner, weil ihm auffiel, dass fast überall Spam aus Dosen verzehrt wurde: Diese Corned Beef-Variante schmeckte so salzig-„corpy“ wie es wohl früher die Kannibalen goutierten, vermutete Theroux und entwickelte daraus seine eigene spezielle Kannibalismus-Theorie. Er ist eben einfach immer für eine Überraschung gut. Der Wanderer und Bahnfahrer hatte bei seinen britischen Ausflügen oft den allgemeinen Verfall begutachten können und dabei registriert, wie entschlossen die Inselbewohner sich dem drohenden Untergang entgegen stellten. In seinem Rückblick auf „The Kingdom by the Sea“ bemerkt er: „The British seemed to me to be people forever standing on a crumbling coast and scanning the horizon.“
Ohne seine intensive Rundreise durch das „Kingdom by the Sea“ hätte sich sein Blick für das große Gesamtbild hin zu einer Systemkritik wohl kaum so kritisch-scharfsinnig entwickelt. In „The Happy Isles of Oceania“ (1992) spürt man, wie der Inselforscher Theroux hartnäckig den Kern dieser entlegenen Inseln zwischen Neuseeland, den Osterinseln und Hawaii sucht und alte Ausgrabungsstätten besucht, mit Experten auf den Osterinseln über Thor Heyerdaal diskutiert und Thesen zu mittelalterlichen Seefahrer-Routen erörtert. Und nach seiner totalen Melville-Immersion (die erotischen Passagen in „Typee“ und „Omoo“ hatten ihn begeistert ) beobachtet Theroux die Essgewohnheiten der Insulaner, weil ihm auffiel, dass fast überall Spam aus Dosen verzehrt wurde: Diese Corned Beef-Variante schmeckte so salzig-„corpy“ wie es wohl früher die Kannibalen goutierten, vermutete Theroux und entwickelte daraus seine eigene spezielle Kannibalismus-Theorie. Er ist eben einfach immer für eine Überraschung gut. Der Wanderer und Bahnfahrer hatte bei seinen britischen Ausflügen oft den allgemeinen Verfall begutachten können und dabei registriert, wie entschlossen die Inselbewohner sich dem drohenden Untergang entgegen stellten. In seinem Rückblick auf „The Kingdom by the Sea“ bemerkt er: „The British seemed to me to be people forever standing on a crumbling coast and scanning the horizon.“
So ähnlich verhält sich Theroux jetzt aber auch selbst: Sein Haus auf Hawaii liegt nicht weit von der Küste entfernt, in seinem grotesk-komischen Roman „Hotel Honolulu“(2001) hatte er schon ziemlich effekthascherisch die lnselfreuden beschrieben, die man sich trotz nervtötender Alltagsärgernisse gönnen kann.
Aber der Roman-Autor Theroux, der sich gern selbst bespiegelt und seine exaltierten „Secret History“-Phantasien (oder „Picture Palace“, „Mallory the Magician“ etc.) als eminentes Kunstwerk zelebrieren möchte – das ist eine völlig andere, eher ermüdende Geschichte. Im Unterschied zum frühen lockeren Singapur-Freizeit-Pimp „Saint Jack“ (1973).
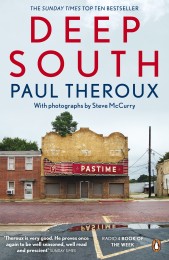 Es muß sich auch noch zeigen, ob Paul Theroux nach der Trump-Wahl und der danach ausgelösten extremen Polarisierung weiterhin amerikanische Regionen erforschen will wie zuletzt in „Deep South“, wo er die US-Südstaaten in seinem Auto (!!!) erkundet. Er beschreibt darin den bei Gun Shows offensichtlichen Waffenwahn, diskutiert mit Priestern, die nebenher noch Rechtsanwälte sind und führt Gespräche mit Sozialhelfern und Bürgermeistern, die sich Sorgen machen, weil viele Südstaaten ökonomisch vom Norden abgekoppelt sind und abgehängt werden.
Es muß sich auch noch zeigen, ob Paul Theroux nach der Trump-Wahl und der danach ausgelösten extremen Polarisierung weiterhin amerikanische Regionen erforschen will wie zuletzt in „Deep South“, wo er die US-Südstaaten in seinem Auto (!!!) erkundet. Er beschreibt darin den bei Gun Shows offensichtlichen Waffenwahn, diskutiert mit Priestern, die nebenher noch Rechtsanwälte sind und führt Gespräche mit Sozialhelfern und Bürgermeistern, die sich Sorgen machen, weil viele Südstaaten ökonomisch vom Norden abgekoppelt sind und abgehängt werden.
Das exotische Flair der frühen Railway-Jahre fehlt in „Deep South“ zwar ebenso wie die Spontaneität von Zufallsbekanntschaften im Railway Bazaar-Diner nach Lahore, dennoch ist sein Südstaaten-Report lohnenswert, weil er in unbekanntem Gebiet sondiert und die dritte Welt mit ihren Problemen nun plötzlich vor seiner Haustür liegt. Und weil sich Theroux mit dem tiefen Süden ernsthaft beschäftigt.
Peter Münder, Journalist, Autor einer Harold Pinter-Biografie, lebt in Hamburg. Seine CulturMag-Beiträge hier.
Literaturangaben
Paul Theroux: The Kingdom by the Sea. A Journey around the coast of Great Britain. Hamish Hamilton, 303 S., London 1983
-ders.: The Happy Isles of Oceania. Penguin 1992 (dtsch. Die glücklichen Inseln Ozeaniens)
Paul Theroux: The Great Railway Bazaar (Abenteuer Eisenbahn – auf Schienen um die halbe Welt) und The Old Patagonian Express (Der alte Patagonien-Express) sind jetzt als Penguin New Classics erschienen. Als Band 365 mit dem Titel Basar auf Schienen bei der Anderen Bibliothek, übersetzt von Werner Peterich, bearbeitet von Christian Döring.
Paul Theroux: Deep South. Four Seasons on Back Roads, with photos by Steve McCurry. Penguin 2015, 442 S. (dtsch. Tief im Süden. Reise durch ein anderes Amerika)