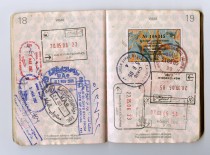 Angeber, Abenteurer, Ballermann-Dumpfbacken, Masochisten, Glasperlenspieler oder Eskapisten? Warum reisen sie?
Angeber, Abenteurer, Ballermann-Dumpfbacken, Masochisten, Glasperlenspieler oder Eskapisten? Warum reisen sie?
In seinem Band „Schrecklich schön und weit und wild“ beschäftigt sich der risikofreudige Weltreisende, Lyriker und Romancier („Weiberroman“, „Jenseitsnovelle“) Matthias Politycki mit der Frage „Warum wir reisen und was wir dabei denken“
„Die Menschen haben nicht besonders viel von der Welt gesehen, als sie langsam vorankamen, es ist kaum zu erwarten, daß sie mehr sehen, wenn sie schnell vorankommen!“ John Ruskin, Ruskin in Italy. Letters to his Parents, Edt. H.I. Shapiro, Oxford 1972 (Übers. PM)
Erkunden und Forschen, Abenteuer, Naturwunder und Skurriles auszukosten war schon immer Matthias Polityckis Spezialität: Auf dem „Ale Trail“ zog er 2011 durch Londoner Pubs und versuchte auch aus solchen Ale-Sorten etwas prickelnd Betörendes herauszuschmecken, die „im Abgang nach feuchtem Feudel“ mundeten; auf dem Luxus-Kreuzfahrer MS Europa durchpflügte er als Hapag-Lloyd-Schiffsschreiber 2006 in 180 Tagen die Weltmeere, wobei er am liebsten schrille Vögel und deren kauzige Marotten beobachtete, um einen Narrenschiff-Schelmenroman mit satirisch-kritischem Tiefgang vom Stapel zu lassen. Sein merkwürdig düsterer Samarkand-Exkurs („Samarkand, Samarkand“) liefert zwar ein klassisches Quest-Thema, nämlich die Suche nach einem geheimnisvollen islamischen Kulturdenkmal. Doch dieser im Jahr 2026 spielende Trip in versandetes Gelände endet literarisch-erzähltechnisch mit einem knirschendem Getriebeschaden: Blasse Figuren, ein magerer Plot mit der dystopischen Vision von der „Rettung des Abendlandes“, in dem die aberwitzige Suchaktion des Ex-Gebirgsjägers Kaufner nie so richtig auf Touren kommt- das irritiert wohl auch deswegen extrem, weil man dem Autor anmerkt, dass er seinen Stoff von der ersten Samarkand-Reise bis zur literarischen Verwertung über 25 Jahre zwischenlagerte. Gut gemeint, die 400 Seiten auch lange abgehangen- das bewährt sich hier aber keineswegs als Erfolgsrezept.
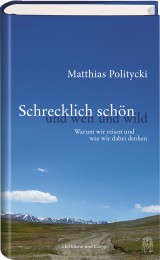 Ende der großen Freiheit?
Ende der großen Freiheit?
Der promovierte Germanist Politycki ist ja kein angestaubter Archivar, sondern unter den bekannten deutschen Autoren der am weitesten herumgekommene Weltreisende. Und daher auch prädestiniert, sich mit dem Reise-Komplex intensiver zu beschäftigen.
Das sei bisher nicht nötig gewesen, erklärt er, nach 9/11 und vor allem nach dem Flüchtlingsstrom vom Sommer 2015 sei die Reise-Welt für ihn aus den Fugen geraten- daher könne er angesichts dieses Elends nicht weiter so unbedarft in der Welt herumreisen wie bisher. Weder in den Jemen, nach Damaskus oder nach Babylon könne er noch einmal fahren. Nun sei das Fremde, das ihn jahrelang gelockt hatte, längst in die eigene Stadt eingezogen, das Ende der großen Freiheit sei zu beklagen – er könne nicht einfach so weiter träumen von der großen Reisefreiheit wie bisher. Und diese Zäsur nutzt er nun, um darüber nachzudenken, warum wir überhaupt reisen: Um etwas von den Utopien zu begreifen, die man früher mit dem Reisen assoziierte und teilweise auch selbst verspürte – wie etwa Freiheit, Ausbruch aus reglementierten Arealen, dem Erreichen von irgendetwas Unerhörtem und Besonderen? Dazu Politycki:
„Immer gab es jemanden, der einen größeren Tiger im Dschungel gesehen hat als man selbst, immer jemanden, der eine ekelhaftere Speise aufgetischt bekam, der höhere Berge erklimmen und größere Meere austrinken durfte. Auch ich betreibe das Reisen mit zum Teil ehrgeizigen und manchmal sogar vermessenen Ambitionen. In der Hauptsache jedoch ist reisen für mich praktische Philosophie. Den Wert einer Reise bemesse ich nicht nach ihrem Schwierigkeitsgrad, ihrer Exotik oder sonstigen Rahmenbedingungen, sondern nach den Erkenntnissen, die auf den Wegen der Neugier als Stolpersteine lagen“.
Ein Rückblick auf seine ersten intensiven Reise-Abenteuer als Jugendlicher ohne Elternbegleitung (Sprachkurs in England mit grauenhaftem Essen, danach war er nur noch krank) verleitet ihn dazu, diese aufwühlenden Erfahrungen als allgemeingültige Maxime zu betrachten: „Warum wir reisen? Um mit unseren Abenteuern anzugeben. Am allermeisten geben wir an, indem wir so tun, als ob das Erlebte ganz normal gewesen- und also wir selbst als noch härterem Holz geschnitzt seien, als die Zuhörer bislang selbst vermuten durften. Dabei ist eigentlich jede Reise per se ein Abenteuer“.
Aber die letzten Reisen werden ja meistens mit den überwältigenden Erlebnissen auf früheren Reisen verglichen, was fast zwangsläufig zu Enttäuschungen führt. Politycki verweist auf Fontane, der bei seinen Wanderungen durch die Mark Brandenburg sich mit demselben Phänomen konfrontiert sah und vor diesen Vergleichen warnte, obwohl dieser Hang zur Komparatistik ja offenbar in der menschlichen Natur liegt. Das Fazit „The Thrill is gone“, das Politycki in einem Kapitel thematisiert, ist meistens diesen Vergleichen geschuldet- „Früher war alles aufregender“ heißt dann die griffige Kalenderweisheit.
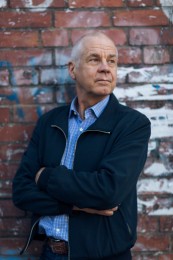 Vergleichen, etikettieren und differenzieren
Vergleichen, etikettieren und differenzieren
Auf dem Weg zu einer systematischen Erfassung diverser Aspekte des Reisens, die Politycki hier anstrebt, diskutiert er auch den Unterschied zwischen Urlaub und Reise: Ist jeder Trip mit einem Flug von mehr als vier Stunden Dauer tatsächlich eine Reise und jeder Kurztrip ein Urlaub? Kann der Reisende den „Blick für das Wesentliche“ für sich reklamieren, der dem auf Wellness oder Sehenswürdigkeiten kaprizierten Urlauber abgesprochen wird? So ähnlich, wie sich der ernsthafte, ambitionierte „Läufer“ vom gemächlich dilettierenden „Jogger“ abgrenzt? Das Thema kann man eigentlich getrost abhaken, die Grenzen sind fließend, jeder Reisende kann schnell zum Urlauber mutieren und umgekehrt- wie Politycki selbst konstatiert. Und wen interessiert das überhaupt? Der Rezensent kann mit dieser Definitionshuberei jedenfalls nichts anfangen, schließlich machten sich die echten Reisenden ja sowieso einfach auf den Weg, ohne sich um passende Schubladen und Etiketten für ihr Unternehmen zu kümmern: Als Johann Gottfried Seume sich am 9. Dezember 1801 auf seine viertausend Kilometer lange Wanderung von Dresden nach Syrakus (und über Paris zurück nach Dresden) machte, sprach er keineswegs von seiner Reise, sondern von einem „Spaziergang“ (so lautet ja auch der Buchtitel). „Wer geht, sieht im Durchschnitt anthropologisch und kosmisch mehr, als wenn er fährt“, schreibt Seume. „Ich halte den Gang für das Ehrenvollste und Selbständigste in dem Manne und bin der Meinung, daß alles besser gehen würde, wenn man mehr ginge.“ Übrigens hätte ein kleiner historischer Exkurs über die Anfänge des Reisens seit der „Grand Tour“ (Vgl. Attilio Brilli: Als Reisen eine Kunst war: Die Grand Tour) im 18. Jahrhundert dem Buch gut getan: Als englische Bildungsbürger oder Studenten mit ihren Tutoren per Kutsche durch Italien fuhren, und abenteuerliche Raubüberfälle von Wegelagerern an der Tagesordnung waren, kostete man diesen Thrill noch intensiv aus, während das Abzocken durch habgierige Wirte allseits verflucht wurde.
Die Stärke von Polityckis Studie liegt in der Beschreibung seiner eigenen Erfahrungen und Eindrücke- von der Totenverbrennung in Varanasi, den Ausweichmanövern um Kriegszonen in Kenia oder bis zur Auseinandersetzung mit aggressiven Rastafari-Dogmatikern auf Jamaika: Wir sehen das Geschehen aus einer kritischen Perspektive, die nicht sofort auf eine verständnisvolle, politisch korrekte Opferrolle fixiert ist.
 Nur schade, dass der gesamte „Dark Tourism“ bei ihm völlig ausgeblendet ist. Wer mal versucht hat, durch die vietnamesischen Cucchi- Flucht-Tunnel zu kriechen (und darin steckenblieb) oder erlebt hat, wie lässig junge buddhistische Mönche am River Kwai an der Juke Box des Kriegsgefangenen-Museums beim Abhören von Elvis-Evergreens erklären, wie englische Kriegsgefangene von den Japanern zu Tode gefoltert wurden, kann direkt miterleben , wie sich hier ein schriller Mix von Kriegs-Horror und Massentourismus entwickelt hat, der eine ganz eigenständige Faszination entfaltet. Der von Karl Kraus nach dem 1. Weltkrieg schon scharf kritisierte Schlachtfeld-Tourismus als „Reklamefahrt zur Hölle“ scheint hundert Jahre später wieder neu zu boomen. Die britischen Battle Tours nach Verdun, Arnheim oder in die Festung Colditz sind meistens lange im voraus ausgebucht. Auch die kambodschanischen „Killing Fields“ konnten in den letzten Jahren schon besucht werden; windige Geschäftsleute wittern dort nun den schnellen Dollar und wollen das Folter-und Mord-Gelände demnächst zu einer Art Disneyland ausbauen. Die von Politycki gestellte Frage „Warum wir reisen und was wir dabei denken“ sollte man sich in diesem Fall vielleicht gar nicht erst stellen- denn das ist wohl kaum Tourismus, sondern einfach nur pervers.
Nur schade, dass der gesamte „Dark Tourism“ bei ihm völlig ausgeblendet ist. Wer mal versucht hat, durch die vietnamesischen Cucchi- Flucht-Tunnel zu kriechen (und darin steckenblieb) oder erlebt hat, wie lässig junge buddhistische Mönche am River Kwai an der Juke Box des Kriegsgefangenen-Museums beim Abhören von Elvis-Evergreens erklären, wie englische Kriegsgefangene von den Japanern zu Tode gefoltert wurden, kann direkt miterleben , wie sich hier ein schriller Mix von Kriegs-Horror und Massentourismus entwickelt hat, der eine ganz eigenständige Faszination entfaltet. Der von Karl Kraus nach dem 1. Weltkrieg schon scharf kritisierte Schlachtfeld-Tourismus als „Reklamefahrt zur Hölle“ scheint hundert Jahre später wieder neu zu boomen. Die britischen Battle Tours nach Verdun, Arnheim oder in die Festung Colditz sind meistens lange im voraus ausgebucht. Auch die kambodschanischen „Killing Fields“ konnten in den letzten Jahren schon besucht werden; windige Geschäftsleute wittern dort nun den schnellen Dollar und wollen das Folter-und Mord-Gelände demnächst zu einer Art Disneyland ausbauen. Die von Politycki gestellte Frage „Warum wir reisen und was wir dabei denken“ sollte man sich in diesem Fall vielleicht gar nicht erst stellen- denn das ist wohl kaum Tourismus, sondern einfach nur pervers.
 Den Horror während seiner total mißglückten Kenia-Ruanda-Kongo- Burundi-Reise, die beinahe mit seinem Exitus geendet hätte, beschreibt Politycki als „Meine vergleichsweise kurze Reise ins Jenseits“: Da wurde aus einer Bein-Infektion eine gigantische Schwellung, die in völlig maroden Krankenhäusern von geldgierigen, inkompetenten Ärzten als Symptom einer vorübergehenden „Überanstrengung“ diagnostiziert wurde. Man empfahl dem deutschen Patienten daher eine Ruhepause. In fast aussichtsloser Situation wurde der schon bewußtlose Politycki von seiner Freundin nach Europa transportiert, wo man ihm mit mehreren Notoperation noch eine Beinamputation ersparen und sein Leben retten konnte. „Es sollte ein ganzes Jahr dauern, bis ich wieder richtig zu Hause ankam“, schreibt er, „ein anderer als der, der zu seiner Reise aufgebrochen war“. Kein Wunder, dass sein Buch ursprünglich „Mein Abschied vom Reisen“ heißen sollte. Doch mit dem resignativen Daheimbleiben will der Autor sich nicht abfinden: Er plädiert dafür, angesichts einer globalisierten Monotonie weiterzureisen, um das faszinierende Neben- und Miteinander der Kulturen und ein damit verbundenes Ethos zu erhalten. Das hört sich ganz plausibel an; enttäuschend ist trotzdem, welch marginalen Stellenwert in diesen Thesen und Überlegungen über das Reisen das „Umparken im Kopf“ einnimmt. Tina Uebel erklärte ihre Reiselust einfach damit, „hinterher weniger dumm“ zurückkehren zu wollen, sogar Goethe verstand das Reisen mitunter auch als eine Art eigenen Umerziehungsprozeß: „Man muß, sozusagen, wiedergeboren werden, und man sieht auf seine vorigen Begriffe wie auf Kinderschuhe zurück“, schreibt er 1786 aus Rom in der „Italienischen Reise“. „Die Wiedergeburt, die mich von innen heraus umarbeitet, wirkt immer fort. Ich dachte wohl hier was Rechts zu lernen; daß ich aber so weit in die Schule zurück gehen, daß ich so viel verlernen, ja durchaus umlernen müßte, dachte ich nicht. Nun bin ich aber einmal überzeugt und habe mich ganz hingegeben, und je mehr ich mich selbst verleugnen muß, desto mehr freut es mich“. Über dieses Umdenken und das Ablegen eingefahrener Verhaltensmuster während des Reisens hätte der Rezensent in „Schrecklich Schön“ jedenfalls gerne mehr erfahren.
Den Horror während seiner total mißglückten Kenia-Ruanda-Kongo- Burundi-Reise, die beinahe mit seinem Exitus geendet hätte, beschreibt Politycki als „Meine vergleichsweise kurze Reise ins Jenseits“: Da wurde aus einer Bein-Infektion eine gigantische Schwellung, die in völlig maroden Krankenhäusern von geldgierigen, inkompetenten Ärzten als Symptom einer vorübergehenden „Überanstrengung“ diagnostiziert wurde. Man empfahl dem deutschen Patienten daher eine Ruhepause. In fast aussichtsloser Situation wurde der schon bewußtlose Politycki von seiner Freundin nach Europa transportiert, wo man ihm mit mehreren Notoperation noch eine Beinamputation ersparen und sein Leben retten konnte. „Es sollte ein ganzes Jahr dauern, bis ich wieder richtig zu Hause ankam“, schreibt er, „ein anderer als der, der zu seiner Reise aufgebrochen war“. Kein Wunder, dass sein Buch ursprünglich „Mein Abschied vom Reisen“ heißen sollte. Doch mit dem resignativen Daheimbleiben will der Autor sich nicht abfinden: Er plädiert dafür, angesichts einer globalisierten Monotonie weiterzureisen, um das faszinierende Neben- und Miteinander der Kulturen und ein damit verbundenes Ethos zu erhalten. Das hört sich ganz plausibel an; enttäuschend ist trotzdem, welch marginalen Stellenwert in diesen Thesen und Überlegungen über das Reisen das „Umparken im Kopf“ einnimmt. Tina Uebel erklärte ihre Reiselust einfach damit, „hinterher weniger dumm“ zurückkehren zu wollen, sogar Goethe verstand das Reisen mitunter auch als eine Art eigenen Umerziehungsprozeß: „Man muß, sozusagen, wiedergeboren werden, und man sieht auf seine vorigen Begriffe wie auf Kinderschuhe zurück“, schreibt er 1786 aus Rom in der „Italienischen Reise“. „Die Wiedergeburt, die mich von innen heraus umarbeitet, wirkt immer fort. Ich dachte wohl hier was Rechts zu lernen; daß ich aber so weit in die Schule zurück gehen, daß ich so viel verlernen, ja durchaus umlernen müßte, dachte ich nicht. Nun bin ich aber einmal überzeugt und habe mich ganz hingegeben, und je mehr ich mich selbst verleugnen muß, desto mehr freut es mich“. Über dieses Umdenken und das Ablegen eingefahrener Verhaltensmuster während des Reisens hätte der Rezensent in „Schrecklich Schön“ jedenfalls gerne mehr erfahren.
Peter Münder
Peter Münder ist CULTURMAG-Autor. Mehr Infos, weitere Beiträge finden sich HIER.











