 ,,Es ist eh alles positiv“
,,Es ist eh alles positiv“
Am 12. Februar 1989 starb Thomas Bernhard – Gisela Trahms blickt zurück auf einen einzigartigen Schriftsteller.
Nein, „respektvoll erschüttert“ wie bei Gustav von Aschenbach war die Welt nicht, als sie im Februar 1989 von Thomas Bernhards Tod erfuhr. Viele werden heilfroh gewesen sein. Aber müssen nicht sogar seine Verächter zugeben, dass der Vorhang im richtigen Moment fiel, wie vom Lebenstheatermacher selbst bestimmt? Fünf Minuten später, sozusagen, begann eine Epoche, in der seine Themen und Tiraden erst einmal entsorgt schienen. Was hättest du zum Mauerfall gesagt, Thomas, und zum 11. September, zu Selbstmordattentätern, Datennetzen, virtuellen Welten? Wären deine Schimpfkanonaden nicht zerschellt an diesen neuen Wirklichkeiten?
Getrost konnte Bernhard gegen das Burgtheater als eine Stätte des Schwachsinns wettern – die Institution Theater blieb ja unbezweifelt. Der denkende Mensch ging in das Burgtheater oder in das Bochumer Schauspielhaus, fragte sich vielleicht: „Ist es eine Tragödie? Ist es eine Komödie?“, doch er ging ins Theater und das Gesehene war wichtig und nahm einen zentralen Platz im öffentlichen Diskurs ein. Und heute? Welches Stück hätte es seit Bernhards Tod auch nur halbwegs zum Stadtgespräch gebracht, geschweige denn zur wochenlangen Erregtheit eines ganzen Landes (wie „Heldenplatz“, dessen Uraufführung der Autor gerade noch erlebte)?
Dass die „Geistestätigkeit“ das Ziel aller menschlichen Anstrengungen sei, war Bernhards Lebensaxiom. Der Künstler! Der Privatgelehrte! Der Denkende und Empfindende! Dagegen Staat und Gesellschaft, ein Sumpf der Niedertracht! Und nicht nur in diesem Konflikt reibt sich der Geistesmensch auf. Dem Denken und der Kunst wohnt ja in ihrer Forderung nach unbedingter Hingabe ein sadistischer Zug inne. Sie verlangen die Aufopferung all dessen, was der gewöhnliche Sterbliche als Glück verheißend ansieht: „Wir hassen das Forellenquintett, aber es muss gespielt werden“, sagt der Zirkusdirektor Caribaldi in „Die Macht der Gewohnheit“, und so wird weitergeprobt, jahrelang. „Morgen Augsburg!“
Du liebe Güte! Warum denn? Wo sind wir denn hier? Ganz recht: Im tiefsten 19. Jahrhundert.
Ganz unten, „Im Keller“
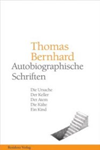 Bernhards Großvater, der Heimatdichter Johannes Freumbichler (1881–1949), lebte dem Enkel Kult und Unbarmherzigkeit dieses Kunstanspruchs vor. In Bernhards Autobiografie ist nachzulesen, wie sich die Familie zeitweise zu acht Personen in eine Dreizimmerwohnung zwängte – der Großvater erhielt gleichwohl ein Zimmer für sich, um schreiben zu können, was kaum ein Verlag drucken mochte. Thomas schlief auf einem Notbett im Flur. Armut und Scheitern bestärkten Freumbichler in der Überzeugung, ein Genie zu sein, leider ein verkanntes. Alle Hoffnungen projizierte er auf den vaterlosen, unehelich geborenen Enkel, der ihn liebte, verehrte und ihm in allem „nachfolgte“. Unter größten Opfern wurde er aufs Gymnasium geschickt. Aber eines Morgens beschloss der Sechzehnjährige (wie einst auch der Großvater), sich den schulischen Abrichtungsritualen zu verweigern und „in die entgegengesetzte Richtung“ zu gehen, zum Arbeitsamt nämlich, das ihm eine Lehrstelle in einem Lebensmittelgeschäft in der verrufenen Salzburger Scherzhauserfeldsiedlung verschaffte, wo er sich augenblicklich als zugehörig empfand. Ganz unten also, im „Keller“.
Bernhards Großvater, der Heimatdichter Johannes Freumbichler (1881–1949), lebte dem Enkel Kult und Unbarmherzigkeit dieses Kunstanspruchs vor. In Bernhards Autobiografie ist nachzulesen, wie sich die Familie zeitweise zu acht Personen in eine Dreizimmerwohnung zwängte – der Großvater erhielt gleichwohl ein Zimmer für sich, um schreiben zu können, was kaum ein Verlag drucken mochte. Thomas schlief auf einem Notbett im Flur. Armut und Scheitern bestärkten Freumbichler in der Überzeugung, ein Genie zu sein, leider ein verkanntes. Alle Hoffnungen projizierte er auf den vaterlosen, unehelich geborenen Enkel, der ihn liebte, verehrte und ihm in allem „nachfolgte“. Unter größten Opfern wurde er aufs Gymnasium geschickt. Aber eines Morgens beschloss der Sechzehnjährige (wie einst auch der Großvater), sich den schulischen Abrichtungsritualen zu verweigern und „in die entgegengesetzte Richtung“ zu gehen, zum Arbeitsamt nämlich, das ihm eine Lehrstelle in einem Lebensmittelgeschäft in der verrufenen Salzburger Scherzhauserfeldsiedlung verschaffte, wo er sich augenblicklich als zugehörig empfand. Ganz unten also, im „Keller“.
Aber natürlich hatte er nicht die Absicht, dort zu bleiben. Und trotz seiner Elendserfahrungen (später noch vertieft durch seine Tätigkeit als Gerichtsreporter, von der er einmal sagte, dass dort die Wurzeln seines Schreibens lägen) waren seine Texte niemals im strikten Sinne sozialkritisch. Die Forderung der Achtundsechziger nach realistischer Erdung der Literatur war ihm kaum ein Hohngelächter wert. Für Thomas Bernhard waren zwar „die Verhältnisse“, und besonders die österreichischen, samt und sonders „furchtbar“, die Misere aber existenziell. Der Mensch, mit der Geburt in eine unaufhebbare Kälte gestoßen, bleibt eine Fehlkonstruktion, das Leben eine Kette von erfahrenen und ausgeteilten Verletzungen. Das ist sozusagen die Muttermilch der Bernhardschen Texte, die den Leser nährt (oder nervt).
Groteske Verrenkungen
 Dies vorausgesetzt, kann man dann anfangen zu zetern, zu beleidigen, zu wüten. „Nicht nach Dinkelsbühl!“, „Ich hasse die Schweiz!“, usw. usw. Jede Menge Skandale zettelte er an, polarisierte mit Lust, erwarb Ruhm und Reichtum und wurde geliebt und bewundert von einem wachsenden Publikum. Verabscheut wurde er vor allem von jenen, die seine Invektiven wörtlich nahmen und übersahen, dass es sich doch zuallererst um Sprachmusik handelte, um Satzkaskaden und verbale Endlosschleifen, die immer aufs neue vorführten, welche Wirkungen man mit immer den nämlichen Mitteln erreicht: mit ständig wiederholten Schlüsselwörtern („naturgemäß“), mit Steigerungen und seiner Übertreibungskunst („Der Denker, von welchem behauptet wird, dass er Tag und Nacht und selbst noch im Schlafe denke.“), mit immer ausufernderen Wortverknüpfungen („Vernichtungsgesichtspunkt“). Und die Resultate sind nicht nur düster: Die virtuosen Kurztexte von Der Stimmenimitator beispielsweise sind so schaurig wie komisch und zeigen Bernhard auf dem Gipfel seiner Kunst. Ebenso das herrliche „Dramolett“ namens „Claus Peymann kauft sich eine Hose und geht mit mir essen“. Die Hose ist nun von Ermenegildo Zegna – aber das Anprobieren in der Enge der Kabine, welche Qual! Ja, der Tod durch „Kleiderhausprobierzellenschlag ist der häufigste“! Und besteht nicht unser aller Dasein aus solch grotesken Verrenkungen?
Dies vorausgesetzt, kann man dann anfangen zu zetern, zu beleidigen, zu wüten. „Nicht nach Dinkelsbühl!“, „Ich hasse die Schweiz!“, usw. usw. Jede Menge Skandale zettelte er an, polarisierte mit Lust, erwarb Ruhm und Reichtum und wurde geliebt und bewundert von einem wachsenden Publikum. Verabscheut wurde er vor allem von jenen, die seine Invektiven wörtlich nahmen und übersahen, dass es sich doch zuallererst um Sprachmusik handelte, um Satzkaskaden und verbale Endlosschleifen, die immer aufs neue vorführten, welche Wirkungen man mit immer den nämlichen Mitteln erreicht: mit ständig wiederholten Schlüsselwörtern („naturgemäß“), mit Steigerungen und seiner Übertreibungskunst („Der Denker, von welchem behauptet wird, dass er Tag und Nacht und selbst noch im Schlafe denke.“), mit immer ausufernderen Wortverknüpfungen („Vernichtungsgesichtspunkt“). Und die Resultate sind nicht nur düster: Die virtuosen Kurztexte von Der Stimmenimitator beispielsweise sind so schaurig wie komisch und zeigen Bernhard auf dem Gipfel seiner Kunst. Ebenso das herrliche „Dramolett“ namens „Claus Peymann kauft sich eine Hose und geht mit mir essen“. Die Hose ist nun von Ermenegildo Zegna – aber das Anprobieren in der Enge der Kabine, welche Qual! Ja, der Tod durch „Kleiderhausprobierzellenschlag ist der häufigste“! Und besteht nicht unser aller Dasein aus solch grotesken Verrenkungen?
 Kein writer’s block stoppte diese Wortflut. Romane, Erzählungen, Stücke – manchmal vier Neuerscheinungen in einem Jahr. Keine Essays, keine Theorie. Handlung immer nur knapp über dem Nullpunkt, es geschieht wenig mehr als dass geredet wird, geredet und geredet… Man kann sie leid werden, diese auf immer ähnliche Töne gestimmte Suada, besonders wenn sie im Wälzerformat auftritt, und auch das Personal ist ja immer das nämliche, vom Krüppel bis zum Fürsten, alle seltsam außerhalb der Zeit mit dem einzigen Fixpunkt des Faschismus … Aber dann wieder braucht man diese Stimme auch, dringend, weil die Welt eben trotz aller Schönheit und Freude auch eine widerwärtige ist und bleibt und es so unglaublich wohltut, jenen Satzmäandern zu folgen, in denen der ennui sich auskotzt. Und es gibt ja auch die anrührenden Bücher: Wittgensteins Neffe zum Beispiel und die Bände der Autobiografie, lauter kleine Romane, die ganz unabhängig voneinander gelesen werden können und von Kindheits- und Krankheitstraumata grässlichster Art berichten, in denen dennoch die Lichtfunken zucken, und seien es die der Absurdität. Und, tatsächlich, die des Erbarmens.
Kein writer’s block stoppte diese Wortflut. Romane, Erzählungen, Stücke – manchmal vier Neuerscheinungen in einem Jahr. Keine Essays, keine Theorie. Handlung immer nur knapp über dem Nullpunkt, es geschieht wenig mehr als dass geredet wird, geredet und geredet… Man kann sie leid werden, diese auf immer ähnliche Töne gestimmte Suada, besonders wenn sie im Wälzerformat auftritt, und auch das Personal ist ja immer das nämliche, vom Krüppel bis zum Fürsten, alle seltsam außerhalb der Zeit mit dem einzigen Fixpunkt des Faschismus … Aber dann wieder braucht man diese Stimme auch, dringend, weil die Welt eben trotz aller Schönheit und Freude auch eine widerwärtige ist und bleibt und es so unglaublich wohltut, jenen Satzmäandern zu folgen, in denen der ennui sich auskotzt. Und es gibt ja auch die anrührenden Bücher: Wittgensteins Neffe zum Beispiel und die Bände der Autobiografie, lauter kleine Romane, die ganz unabhängig voneinander gelesen werden können und von Kindheits- und Krankheitstraumata grässlichster Art berichten, in denen dennoch die Lichtfunken zucken, und seien es die der Absurdität. Und, tatsächlich, die des Erbarmens.
 Er kultivierte die Absonderung, brauchte die Einsamkeit. Wenn er im Café Bräunerhof in Wien Zeitung las, war er die unnahbare Diva. Andererseits entwickelte er früh ein Gespür für nützliche Kontakte, spielte virtuos mit dem „Betrieb“, durchschaute die gewinnbringenden Effekte des Skandals. Wer die Fotos in dem prächtigen Bildband von Sepp Dreissinger betrachtet, sieht einen lächelnden Thomas Bernhard, umgeben von Freunden. Ein gut gebautes Mannsbild in Lederhosen. Einen selbstbewussten Besitzer und Restaurator mehrerer Bauernhöfe, wo er es selten lange aushielt. Einen entspannten Flaneur unter Spaniens Sonne. Und schließlich einen erschütternd von Krankheit Gezeichneten, nicht einmal sechzig Jahre alt. „Es ist nichts zu loben, nichts zu verdammen, nichts anzuklagen, aber es ist vieles lächerlich; es ist alles lächerlich, wenn man an den Tod denkt.“ Die Erfahrung, sich selbst historisch zu werden oder gar zu überleben, ist ihm erspart geblieben. Ein Bernhardsches Glück.
Er kultivierte die Absonderung, brauchte die Einsamkeit. Wenn er im Café Bräunerhof in Wien Zeitung las, war er die unnahbare Diva. Andererseits entwickelte er früh ein Gespür für nützliche Kontakte, spielte virtuos mit dem „Betrieb“, durchschaute die gewinnbringenden Effekte des Skandals. Wer die Fotos in dem prächtigen Bildband von Sepp Dreissinger betrachtet, sieht einen lächelnden Thomas Bernhard, umgeben von Freunden. Ein gut gebautes Mannsbild in Lederhosen. Einen selbstbewussten Besitzer und Restaurator mehrerer Bauernhöfe, wo er es selten lange aushielt. Einen entspannten Flaneur unter Spaniens Sonne. Und schließlich einen erschütternd von Krankheit Gezeichneten, nicht einmal sechzig Jahre alt. „Es ist nichts zu loben, nichts zu verdammen, nichts anzuklagen, aber es ist vieles lächerlich; es ist alles lächerlich, wenn man an den Tod denkt.“ Die Erfahrung, sich selbst historisch zu werden oder gar zu überleben, ist ihm erspart geblieben. Ein Bernhardsches Glück.
Gisela Trahms
Wittgensteins Neffe: Eine Freundschaft.
Suhrkamp Taschenbuch. Neuauflage 2008. 176 Seiten. 7,00 Euro.
Thomas Bernhard: Autobiographische Schriften. Die Ursache (1975), Der Keller (1976), Der Atem (1978), Die Kälte (1981), Ein Kind (1982).
Residenzverlag 2007. 544 Seiten. 25,00 Euro.
Thomas Bernhard: Claus Peymann kauft sich eine Hose und geht mit mir essen. Drei Dramolette.
Suhrkamp 1993. 96 Seiten. 6,50 Euro.
Sepp Dreissinger: Thomas Bernhard. Porträts, Bilder & Texte.
Verlag der Bibliotheken 1991. 350 Seiten. Antiquarisch ab 29,00 Euro.
© Andrej Reiser











