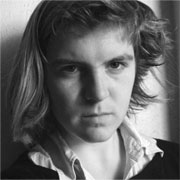Heißer und kalter Kaffee
Heißer und kalter Kaffee
– So sieht es also aus in einem kleinen und jungen Verlag für Literatur und Essay. Hier passt alles, was ich sehe, die Bücher, der Verleger, sein Fahrrad, der Schreibtisch, der Herd zum Kaffeekochen, auf gefühlte 40 Quadratmeter, aufgeteilt auf zwei Räume. Ich bin angekommen im 2. Wiener Bezirk beim Klever Verlag, der seit seiner Gründung 2008 im Souterrain, wie ein guter Club, einer größeren Wohnhausanlage beheimatet ist. Keine piekfeine Gegend hier, ein bisschen Rotlicht, ein bisschen ramschig, eben schön urban und lebendig.
Ralph Klever macht mit mir einen „Rundgang“ durch den Verlag, bevor wir uns in die Freischwinger setzen, um übers Büchermachen und andere nette Sachen zu sprechen. Im hinteren, dem Küchen- und Billybücherregalteil führt eine Holztreppe nach oben über eine Tür in den kleinen Hinterhof. Dort lebt ein eigener Charme hinter den von Efeu bewachsenen meterhohen Backsteinmauern. Im Sommer sitze ich mit meinen Autoren draußen, höre ich. Da schwappt dann die Geräuschkulisse vom Wurstelprater (= Action-Gaudi-Karussel-Zone im Prater) rüber. An dem Tag meines Besuchs ist es trüb und kalt in der Stadt.
Ein neuer Verlag mit viel Erfahrung
Wir beginnen mit nicht schönen Meldungen. Das letzte Jahr ist für den Verlag traurig zu Ende gegangen. Mit dem Tod der Schriftstellerin Adelheid Dahimène im November 2010 und des Schriftstellers Peter O. Chotjewitz im Dezember 2010 verliert er zwei angesehene Autoren. Und wohl noch mehr als das: Vor allem Adelheid Dahimène hat Ralph Klever angestubst, einen eigenen Verlag zu gründen, und hat dort auch im Frühjahr 2009 ihren ersten Lyrikband („Blitzrosa Glamour“) veröffentlicht. Im März 2011 soll ihre längere Prosaarbeit „Rauchernovelle“ erscheinen.
Ralph Klever ist seit Mitte der neunziger Jahre nicht mehr aus dem Verlagsleben und aus Verlagshäusern wegzudenken. Als verantwortlicher Verlagslektor für Literatur beim Klagenfurter Ritter Verlag hat er gelernt, Programme zu machen und Profile zu schärfen. Franzobel, einer der gaaaanz wenigen österreichischen Gewinner des Ingeborg-Bachmann-Preises (1995), ist beispielsweise ein Ritter-Autor. 2003 übernimmt er die Verlagsassistenz beim Molden Verlag in Wien. Gut gefüttert mit Kontakten zu Autoren und dem ganzen Drumherum stellt Klever dann fünf Jahre später seinen eigenen Verlag auf die Beine. Gerade in diesen Zeiten, frage ich. Das würde schwer werden, das wusste er, aber da waren großartige Autoren, mit denen wollte er unbedingt was machen. Das klingt nach Herzenslust und Leidenschaft. Ich finde, seine Bücher haben es verdient. Ohne Förderung gehe es natürlich noch nicht: nichts Neues in der Kunst.
Mit Andreas Okopenko und seinen autobiografischen Aufsätzen holt er sich die frühe österreichische Avantgarde ins Haus („Erinnerung an die Hoffnung“). Mit Ann Cotton („Nach der Welt“) kommt eine junge Stimme dazu. Die habe er auch schon vorher gekannt, sagt Klever. In der kleinen Stadt und dem kleinen Land kennt man sich eben. Ich dachte mir schon, was macht eine Suhrkamp-Autorin hier? Aber genau die passt zum Label.
Die Reflexion über Literatur als Versuchsfeld
 Die kleinere Form des Essays ist neben der Literatur eine der Schienen des Verlags. Sie bedeutet im weitesten Sinn die Reflexion über Literatur und ist für Klever eine gewisse Notwendigkeit, ein Versuchsfeld. Wenn Essay auf einem Buchdeckel steht, erreicht man nur eine bestimmte Leserschicht und viele Bücher verkauft man auch nicht. Das ist der Reiz und die Provokation daran: Die großen Verlage wollen Großes, große Romane groß verkaufen oder Sachthemen noch größer aufblasen. Mein Verlag will kleine Literatur gar nicht kleiner Autoren machen, sagt Klever. Zu seiner Literaturedition gehören Prosatexte, Gedichte, Improvisationen, Miniaturen, ein Roman. Romane will er eigentlich schon mehr machen. Mehr verrät er nicht. Bei der Covergestaltung der Bücher wird (inzwischen) auf komplizierte grafische Lösungen verzichtet (zur Freude der Vertreterin!). Mehr als eine schlichte Broschur mit Innenklappen und atmosphärischen Fotos außen drauf brauchen die im Moment nicht, erfahre ich.
Die kleinere Form des Essays ist neben der Literatur eine der Schienen des Verlags. Sie bedeutet im weitesten Sinn die Reflexion über Literatur und ist für Klever eine gewisse Notwendigkeit, ein Versuchsfeld. Wenn Essay auf einem Buchdeckel steht, erreicht man nur eine bestimmte Leserschicht und viele Bücher verkauft man auch nicht. Das ist der Reiz und die Provokation daran: Die großen Verlage wollen Großes, große Romane groß verkaufen oder Sachthemen noch größer aufblasen. Mein Verlag will kleine Literatur gar nicht kleiner Autoren machen, sagt Klever. Zu seiner Literaturedition gehören Prosatexte, Gedichte, Improvisationen, Miniaturen, ein Roman. Romane will er eigentlich schon mehr machen. Mehr verrät er nicht. Bei der Covergestaltung der Bücher wird (inzwischen) auf komplizierte grafische Lösungen verzichtet (zur Freude der Vertreterin!). Mehr als eine schlichte Broschur mit Innenklappen und atmosphärischen Fotos außen drauf brauchen die im Moment nicht, erfahre ich.
Bei der letztjährigen Frankfurter Buchmesse hat der Verlag es mit zwei Büchern zum Schwerpunkt Argentinien versucht, die seien aber in der Titelflut untergegangen, sagt Klever. Trotzdem hat er mit Ricardo Piglia („Der letzte Leser“) und Leopold Federmair („Buenos Aires, Wort und Fleisch“) zwei großartige Autoren und Landeskenner für sein Programm gewonnen.
Mein Kaffee ist kalt geworden beim Zuhören, ich kriege neuen heißen und nippe daran. Klever erzählt, dass das deutsche (und schweizerische) Feuilleton schneller auf ihn aufmerksam geworden sei als das österreichische. Wir rätseln ein wenig. Ich tippe darauf, dass das Letzte eben langsamer sei (= Klischee). Bei ein paar Buchhandlungen in der Stadt sei er gut vertreten, darunter auch bei Thalia. Ab und zu schaue er nach seinen Büchern. Ich sehe dafür rechts aus den hoch angebrachten Fensterchen, sehe Beton, dann gehen Beine vorbei.
Ich will wissen, was der Verleger gern liest, so ganz privat. Eigentlich hängt man ja immer hinter dem her, was man alles lesen möchte, sollte, wollte, müsste und ist grundsätzlich überfordert. Bei Klever jedenfalls war es die letzten Wochen Georges Perec und „Das Leben – Gebrauchsanweisung“. Ich selbst habe die hübsche Ausgabe mit dem Puzzle vom Haus. Friedericke Mayröcker lese er dagegen in Portionen.
Ein letztes Werkstattgespräch mit Peter O. Chotjewitz
 Dann nehmen wir uns ein paar Klever-Bücher vor vom Herbstprogramm und die „Idiome“. Die zuerst. Das sind die Hefte für Neue Prosa, herausgegeben von Florian Neuner und Ralph Klever. Damit habe er eine direkte Achse nach Deutschland gelegt. Seit der dritten Nummer gehören die „Idiome“ ins Programm, und ich frage vorsichtig nach dem Verkauf. Irgendwie scheint es darum gar nicht zu gehen. Egal, die seien als Medium für den Verlag interessant. Drin stecken avancierte Prosa und Werkstattgespräche, der Rahmen ist anspruchsvoll und auf hohem poetologischen Niveau. In Heft Nummer IV, das im Frühjahr erscheinen wird, hat Florian Neuner ein letztes Werkstattgespräch mit Peter O. Chotjewitz geführt, wenige Tage vor seinem Tod.
Dann nehmen wir uns ein paar Klever-Bücher vor vom Herbstprogramm und die „Idiome“. Die zuerst. Das sind die Hefte für Neue Prosa, herausgegeben von Florian Neuner und Ralph Klever. Damit habe er eine direkte Achse nach Deutschland gelegt. Seit der dritten Nummer gehören die „Idiome“ ins Programm, und ich frage vorsichtig nach dem Verkauf. Irgendwie scheint es darum gar nicht zu gehen. Egal, die seien als Medium für den Verlag interessant. Drin stecken avancierte Prosa und Werkstattgespräche, der Rahmen ist anspruchsvoll und auf hohem poetologischen Niveau. In Heft Nummer IV, das im Frühjahr erscheinen wird, hat Florian Neuner ein letztes Werkstattgespräch mit Peter O. Chotjewitz geführt, wenige Tage vor seinem Tod.
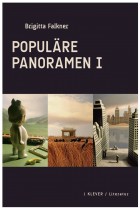 Mit den „Populären Panoramen I“ (2010) von Brigitta Falkner ist der Klever Verlag auf einer Bestenliste vorgerückt: im Januar Platz 2 beim ORF. Mal überlegen, was sie sein könnten: ein Wimmelbuch? ein Abenteuerroman mit Fotos? Ein spielerisches Experiment? Ein Kunstbuch? Von allem etwas, finde ich, ohne Hochglanzpapier, schlicht und reizvoll. Ein Ich fährt mit einem Zug durch eine Landschaft (das Panorama). Der Zug bleibt stehen, fährt, mal schnell, mal langsam. Im Zugabteil gibt es Mitfahrende und eine Fliege, es kommt jemand rein, es geht wer raus. Es wird gelesen, geschlafen, gegessen. Ziemlich unspektakulär, was da auf der linken Buchseite (manchmal nur zwei Textzeilen) zunächst passiert. Rechts sind die Bilder angeordnet (bis zu drei Bildszenen): allerliebste Miniaturlandschaften, die die Comic-Zeichnerin Falkner aus Kinderspielzeug (Plastikmännchen und -Tiere, Comicfiguren), Baumarktutensilien, Gebrauchsgegenständen (Gummihandschuhe) usw. gebaut, dann abfotografiert hat. Größenverhältnisse und Perspektiven sind darauf massiv gestört. Die Aufgaben vom Ich sind beobachten, wahrnehmen, reflektieren – bis ins hinterletzte Detail. So weit, bis sich Wahrnehmungen auch ins Surreale verschieben. Linke und rechte Seite ergänzen sich daher kongenial. Das Buch ist ein herrliches versponnenes Spiel mit Perspektiven von Text und Bild, die Irritation der Lesenden mit eingeschlossen.
Mit den „Populären Panoramen I“ (2010) von Brigitta Falkner ist der Klever Verlag auf einer Bestenliste vorgerückt: im Januar Platz 2 beim ORF. Mal überlegen, was sie sein könnten: ein Wimmelbuch? ein Abenteuerroman mit Fotos? Ein spielerisches Experiment? Ein Kunstbuch? Von allem etwas, finde ich, ohne Hochglanzpapier, schlicht und reizvoll. Ein Ich fährt mit einem Zug durch eine Landschaft (das Panorama). Der Zug bleibt stehen, fährt, mal schnell, mal langsam. Im Zugabteil gibt es Mitfahrende und eine Fliege, es kommt jemand rein, es geht wer raus. Es wird gelesen, geschlafen, gegessen. Ziemlich unspektakulär, was da auf der linken Buchseite (manchmal nur zwei Textzeilen) zunächst passiert. Rechts sind die Bilder angeordnet (bis zu drei Bildszenen): allerliebste Miniaturlandschaften, die die Comic-Zeichnerin Falkner aus Kinderspielzeug (Plastikmännchen und -Tiere, Comicfiguren), Baumarktutensilien, Gebrauchsgegenständen (Gummihandschuhe) usw. gebaut, dann abfotografiert hat. Größenverhältnisse und Perspektiven sind darauf massiv gestört. Die Aufgaben vom Ich sind beobachten, wahrnehmen, reflektieren – bis ins hinterletzte Detail. So weit, bis sich Wahrnehmungen auch ins Surreale verschieben. Linke und rechte Seite ergänzen sich daher kongenial. Das Buch ist ein herrliches versponnenes Spiel mit Perspektiven von Text und Bild, die Irritation der Lesenden mit eingeschlossen.
Der Kaffee ist ausgetrunken.
Senta Wagner
Brigitta Falkner: Populäre Panoramen I. Wien: Klever Verlag 2010. 246 Seiten. 24,90 Euro.
Florian Neuner/Ralph Klever: Idiome IV. Hefte für Neue Prosa. Wien: Klever Verlag 2011. 96 Seiten. 9,90 Euro.
Zur Homepage des Klever Verlags gehts hier, die Verlagsvorschau des Frühjahrsprogramms finden Sie hier.