 Die Einsamkeit des Marathon-Schreibers
Die Einsamkeit des Marathon-Schreibers
Peter Münder über den britischen Autor Alan Sillitoe, der am 25.4.2010 mit 82 Jahren in London gestorben ist.
Er hat zwar über fünfzig Bücher veröffentlicht, neben Romanen auch Gedichte, Theaterstücke und Kindergeschichten geschrieben, doch Alan Sillitoe, der brillante, gnadenlose Kritiker des britischen Zweiklassensystems, wird wohl immer nur als Verfasser seiner beiden berühmtesten Werke Samstag Nacht und Sonntag Morgen (1958) und Die Einsamkeit des Langstreckenläufers (1959 veröffentlicht, 1962 von Tony Richardson verfilmt) in Erinnerung bleiben. Die beiden heroischen Außenseiter Colin Smith, ein 17jähriger Sträfling und der rauflustige Trunkenbold und Schürzenjäger Arthur Seaton, Arbeiter in einer Fahrradfabrik, wirbelten mit ihren vermeintlich so degoutantem, radikal amoralischen Ansichten den englischen Literaturbetrieb damals gehörig durcheinander.
Wegen seines düsteren „Kitchen-Sink“ Realismus und seiner kompromisslosen Kritik saturierter Bürgerlichkeit wurde Alan Sillitoe schon früh das Etikett „Zorniger Junger Mann“ verliehen, was der 1928 in Nottingham geborene Arbeitersohn immer als zu einengend und nichtssagend ablehnte.
Sillitoe fühlte sich selbst zeitlebens als Outcast eines zutiefst ungerechten Klassensystems. Er wuchs mit vier Geschwistern in extrem ärmlichen Verhältnissen auf, die sein Biograph Richard Bradford als „totale Dickens-Tristesse“ beschrieb. Die vielen Umzüge mit dem Handwagen, der die gesamte Familienhabe enthielt, die langen Phasen der Arbeitslosigkeit des Vaters, der tägliche Kampf ums Brot – diese Erfahrungen hat der Mann aus Nottingham nie vergessen und streckenweise auch autobiographisch verarbeitet. Als 14Jähriger wurde er Dreher beim Fahrradhersteller Raleigh, später war er Funker bei der Luftwaffe, dann hatte er sein literarisches Erweckungserlebnis als TB-Patient: Er las alle Klassiker, die er in die Finger bekam und fing selbst an zu schreiben.
Sein analytischer Scharfblick, das Sezieren untragbarer Gesellschaftskonflikte waren vielleicht radikal, aber Sillitoe war nie ein ideologischer Sektierer oder ein missionarischer Oberlehrer-Typ. In den Erzählungen Der Zauberkasten kaprizierte er sich auf die Beziehungsprobleme vereinsamter Individualisten, die für feste Bindungen einfach nicht geschaffen sind und beschrieb einen Mikrokosmos voller unsäglicher, sterbenslangweiliger Details und ritualisierter Alltags-Banalitäten.
Bissig, satirisch, warmherzig
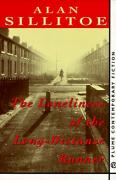 Seinen bissigen Humor und seine satirische Schärfe konnte er auch sanft und humorvoll zur Geltung bringen, wenn er kauzige, warmherzige Typen zeigte, für die er große Sympathien empfand: So geriet ihm etwa einer seiner letzten Romane die 2004 veröffentlichte Lebensgeschichte des eigenwilligen, unbelehrbaren Schmieds Ernest Burton Ein Mann seiner Zeit, zur experimentierfreudigen comedie humaine mit anrührenden satirischen Untertönen.
Seinen bissigen Humor und seine satirische Schärfe konnte er auch sanft und humorvoll zur Geltung bringen, wenn er kauzige, warmherzige Typen zeigte, für die er große Sympathien empfand: So geriet ihm etwa einer seiner letzten Romane die 2004 veröffentlichte Lebensgeschichte des eigenwilligen, unbelehrbaren Schmieds Ernest Burton Ein Mann seiner Zeit, zur experimentierfreudigen comedie humaine mit anrührenden satirischen Untertönen.
„Ich bin Schriftsteller und meine Lebensaufgabe besteht darin, an meinem Schreibtisch zu sitzen und meiner Phantasie freien Lauf zu lassen“, erklärte Alan Sillitoe noch vor zwei Jahren gegenüber der BBC für eine TV-Dokumentation. Da hatte er Nottingham bereits verlassen und lebte schon seit etlichen Jahren zusammen mit seiner Familie im Londoner Bezirk Notting Hill. Er schrieb tatsächlich auch noch als 80Jähriger mehr als zwölf Stunden täglich. Und das politische Tagesgeschehen verfolgte er so kritisch wie in seinen frühesten Jugendjahren. Die britische Unterstützung für die militärischen Einsätze im Irak und Afghanistan verdammte Sillitoe, wie man es von ihm nicht anders erwartete, in Grund und Boden. Er war zwar nie Mitglied einer politischen Partei gewesen, empfand aber eine kritische Solidarität mit der Labour-Partei. „Sie sind zwar gegen das Rauchen, gegen das Trinken, gegen die Autofahrer und wenn man ein kleine Hütte auf dem Land hat, wollen sie einem dafür auch noch doppelt so hohe Steuern aufbrummen – aber ich würde trotzdem wieder für sie stimmen“.
Alan Sillitoe, dieser große, warmherzige gesellschaftskritische Realist, der noch im März seinen 82. Geburtstag feierte, verstarb am 25. April im Londoner Charing Cross Hospital.
Peter Münder











