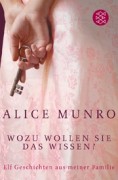 Erdachte Spuren
Erdachte Spuren
Ein weiterer Literaturpreis für Alice Munro war überfällig. Jetzt ist die „Meisterin der kleinen Form“ mit dem internationalen mit 60.000 Pfund dotierten Man-Booker-Preis ausgezeichnet worden. Gisela Trahms über Munros jüngste Kurzgeschichtensammlung.
Im November 1851 machen sich drei junge Männer namens Laidlaw von Ontario auf nach Manitoba, versehen mit nichts als Äxten, Entschlossenheit und der Aussicht auf ein Grundstück. Sie roden, sägen Bäume zu Brettern, ziehen eine Hütte hoch und schlafen zu dritt in einem Bett aus Weidenzweigen. Weil sie die Feuerstelle falsch anlegen, verbrennen sie beinahe.
Schließlich kommen Mutter und Schwester nach und übernehmen das Backen und Kochen, „was wir alle als Wohltat empfanden.“ So beginnt die Zivilisation und so geht sie weiter, Fortschritte und Rückschläge lösen einander ab, und auch wenn es hier um Kanada geht und nicht um den Wilden Westen: kennen wir das nicht alles aus tausend Filmen und historischen Schinken? Warum es noch einmal lesen?
Weil es so wunderbar erzählt ist, natürlich.
Die elf neuen Geschichten von Alice Munro fügen sich zum ersten Mal zu einem Langtext zusammen, in dem sie wie Kapitel fungieren. Während man gewöhnlich Erzählungen um ihre Wirkung bringt, wenn man sie ohne Innehalten verschlingt, kann man dieses Buch fort und fort lesen und tut es auch. Ein epischer Fluss entsteht, der trägt.
Seine Quelle tritt im trostlosen Tal von Ettrick aus dem schottischen Boden. Dort redet der Schäfer James Laidlaw so lange auf seine Söhne ein, bis zwei von ihnen sich bereit erklären, mit dem Sechzigjährigen 1818 nach Nuova Scotia aufzubrechen, nach Ostkanada also. Kaum auf See, entsetzt sich der alte Laidlaw über seinen Entschluss und wandert ruhelos auf dem Schiff umher, um jedermann die unvergleichlichen Schönheiten Schottlands zu preisen, die er nie wiedersehen wird. Das ist von herzzerreißender Komik, gleichzeitig versteht man nur zu gut, wie es die Söhne und vor allem die Schwiegertochter nervt, die, hochschwanger, während der Überfahrt niederkommt, beinahe stirbt, in Rekordzeit gesundet und dann dem jungen Arzt auszuweichen sucht, der ihr das Leben gerettet hat. Der Arzt, schwindsüchtig, wie man errät, fühlt sich angezogen von Agnes’ Vitalität. Gleichzeitig blickt er mit einer gewissen trotzigen Befriedigung auf die zwölfjährige Nettie, die schon hustet und wahrscheinlich noch vor ihm sterben wird…
Diese Darstellung der Überfahrt, 64 Seiten lang, gehört zu den Glanzstücken Munroscher Prosa. Sie enthält ein Dutzend Geschichten in einer, alle in der Wahrheit leuchtend, die sie selbst konstruieren. Denn hier wird weder behauptet „So und nicht anders ist es gewesen“ noch heroisiert noch beschönigt noch angeklagt. Eine Fülle von Details unterfüttert die Handlung und bildet ein lebendiges setting für die Personen, die keine „Käuze“ sind, wie der Schutzumschlag lockt, sondern tüchtige, handfeste und natürlich auch eigenwillige Leute. Alice Munro hat keine Schrulligkeiten nötig, um Interesse zu wecken. Man erfährt genug.
Zum Beispiel, was Familie bedeutet: Dass Andrew Laidlaw, selbst mit Frau und Kindern versehen, Hunderte von Kilometern nach Illinois zurücklegt, um die Witwe seines Bruders samt deren Kindern zu sich zu holen. Keineswegs beglückt, aber selbstverständlich. Oder wie eine Mutter mit ihren Kindern umgeht, wenn sie erst zwei hat und mit zehn bis fünfzehn weiteren Geburten rechnet. Was Klassenunterschiede bedeuten, die sich im Lauf der Jahrhunderte immer feiner ausdifferenzieren und ein kompliziertes Netz von Regeln erzeugen, das den Einzelnen hält und einschnürt. Und schließlich, wie ein Mädchen namens Alice Laidlaw auf einer Farm heranwächst, mit zwanzig einen Mann namens Michael Munro heiratet und fortgeht in die Stadt.
Historischer Roman, Familiengeschichte, Autobiografie
Ein historischer Roman also, eine Familiengeschichte, eine Autobiographie – all in one. Und doch primär elf einzelne Erzählungen. Eine heißt „Unterm Apfelbaum liegen“ und schildert beispielsweise, wie die dreizehnjährige Alice ziellos mit dem Fahrrad durch die Gegend fährt (obwohl sich das für ein Mädchen nicht schickt), „weil ich insgeheim für die Natur schwärmte. Dieses Gefühl kam anfangs aus Büchern… Dann hatte es sich mit einer anderen geheimen Leidenschaft von mir vermischt, nämlich der für Gedichtzeilen. Ich durchstöberte meine Schulbücher danach, um sie zu entdecken, bevor sie gelesen und verachtet wurden.“ Das Besondere ist hier das „und verachtet“: Man errät, dass Alice nicht die Kraft hat, sich gegen die Mehrheitsmeinung zu stemmen, vielleicht wird sie mit den anderen über Gedichte höhnen. Dennoch möchte sie sie lesen und sich sozusagen einverleiben, so lange sie davon unbefleckt sind. Die erwachsene Erzählerin macht daraus kein ‚Ich klug, die andern blöd‘ – Drama. Sie streut ein paar Hinweise ein, das ist alles.
Unübertroffen auch die Lakonie des Rückblicks: „Ich war neunzehn, als ich mich verlobte, zwanzig an meinem Hochzeitstag. Mein Mann war der erste feste Freund, den ich je gehabt hatte. Meine Aussichten waren nicht rosig gewesen. Im selben Herbst reparierten mein Vater und mein Bruder den Deckel auf dem Brunnen in unserem Hof, und mein Bruder sagte: ‚Wir müssen das ordentlich machen. Denn wenn dieser Jüngling reinfällt, findet sie nie wieder einen anderen.‘“
Warum? Sie ist hübsch. Aber sie befremdet. Irgendetwas, „schrill wie eine Warnglocke“, vertreibt die jungen Männer, mit denen sie aufgewachsen ist. Dieses „etwas“ wird nicht benannt. Man kann nur vermuten, dass es eine gewisse heftige Intelligenz gewesen sein muss, die sich nicht immer unterdrücken ließ. Später wird es das Schreiben sein.
Der Anfang des Buches, die erste Spurensuche nach den Vorfahren im ewig verregneten Schottland, liest sich ein bisschen mühselig. Und das Ende wirkt in der Parallelführung von autobiographischen Mitteilungen und solchen über die Geologie Kanadas ziemlich konstruiert. Aber davon sollte sich niemand abschrecken lassen, das sind nur ein paar Seiten. Neun der elf Geschichten leuchten in jener Kombination von unerschrockener psychologischer Tiefenbohrung und Geheimnis, in der Alice Munro seit langem Meisterin ist.
Alles wird ja präzise beschrieben, man sieht es vor sich, gerade in den „historischen“ Passagen des Buches. Und doch wird jede Figur von Ungesagtem, nicht Preisgegebenem umhüllt. Zunächst hat man den Eindruck, die Autorin sei auf ‚Faction‘ aus, wie Truman Capote die Mischung aus Tatsachenbericht und Fiktion nannte. Aber lassen wir uns nicht täuschen: Alice Munro ist an einer anderen Art von Tatsachen interessiert als Geschichtsprofessoren und Biographen. Sie steckt, wie immer, einen kunstvollen Rahmen ab, in den der Leser eintritt, um das zu erraten und selbst zu erforschen, was sie verschweigt.
Gisela Trahms
Alice Munro: Wozu wollen Sie das wissen? Elf Erzählungen (The View From Castle Rock, 2006).
Übersetzt von Heidi Zerning.
S. Fischer Verlag 2008. 384 Seiten. 19,90 Euro.











