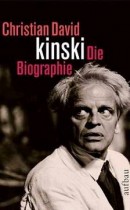 Genial verrückt
Genial verrückt
Das „Enfant terrible“ unter den deutschen Schauspielern im Visier eines sachkundigen Filmkritikers.
Als „Irren vom Dienst“ bezeichnete ihn die Kulturkritik noch zu Lebzeiten. Aus der abfälligen Etikettierung seiner chronischen Zornausbrüche am Set und in der Öffentlichkeit schwang jedoch immer auch Bewunderung und Anerkennung mit. Für einen Menschen, der in jeder Hinsicht aus dem Rahmen fiel. Dieser von Genialität und Grobheit fast schon geplagte Außenseiter des Kulturbetriebs erregte jahrzehntelang das Publikum und inspirierte nun den Wiener Filmkritiker Christian David zur einer Lebensbeschreibung. In der umfassenden Biographie wird Kinskis komplexer Charakter erstmals im Lichte seiner unendlich vielen Bühnen-, Film- und Fernsehauftritte betrachtet.
Dieser Weg bietet sich an, wenn man des Selbstdarstellers Selbstbeschreibung „Ich spiele nicht, das bin ich“ Glauben schenkt. So lotet David denn Kinskis sensible Seele anhand einer profunden Analyse der von ihm seit 1946 gespielten Charaktere und Rezitationen aus. Davids feinsinnige Rollen- und Filmanalysen bestätigen oft das, was Kollegen, Kritiker und Freunde in ihm schlussendlich sahen: Einen über die Maßen perfektionistischen und leidenschaftlichen Künstler, dessen Leben ständig zwischen Wahnsinn, Banalität und Genialität pendelte. Hinter dem egomanischen Choleriker verbarg sich wie viele Vertraute bezeugen aber auch ein überaus charmanter und fürsorglicher Mitmensch.
Zwischen Kunst und Kommerz
Diesen widersprüchlichen, durchaus vertrauten Charakterzügen vermag David jedoch keine neuen Facetten hinzuzufügen. Sein biographisches bVerdienst besteht vielmehr darin, sie anhand zahlreicher unbekannter Briefe und Interviews mit Weggefährten erstmals haarscharf nachzuzeichnen und zu beglaubigen. Das reichhaltige Material hat der Biograph bereits für seine Promotion über Kinski gesammelt und breitet sie hier nun anschaulich und intelligent kommentierend aus. Auch wenn noch viele Details zu Kinskis Berliner Kindheit oder auch zu seinen zentralen Entscheidungen für oder gegen bestimmte Engagements im Verborgenen liegen, die wesentlichen Lebensspuren hat David er sichtbar gemacht. Seine schauspielerischen Anfänge in britischer Gefangenschaft beleuchtet er ebenso intensiv wie die gescheiterten Ausflüge in die Berliner, Wiener und Münchener Theaterszene der 50er oder die finanziell glanzvollen Zeiten im Rom der 60er Jahre. Dort, wo der Superstar ein gutes Jahrzehnt lang in Saus und Braus lebte und seine höchste Produktivität entfaltete. Zumindest was die Zahl seiner Projekte anging, die meist kommerzieller und weniger künstlerischer Natur waren.
Gerade den schicksalhaften Spagat zwischen Kommerz und Kunst, zwischen Leben und Überleben weiß David mit treffenden Beispielen und Zitaten zu belegen. Die Amplituden in Kinskis Karriere sind nämlich nicht nur seiner permanenten Geldnot geschuldet, sondern auch Ausdruck der eingebildeten und wirklichen Kränkungen, die er mit seiner Flucht in sehr gut bezahlte Trashfilme kompensiert hat. Das „Atemlose und Unstete“ war seinem Wesen so immanent, dass auch David kaum eine Erklärung für Kinskis oft irrationalen und selbstzerstörerischen Entscheidungen findet. Sicher hätten die ihm versagten Interviews mit Kinskis letzter Ehefrau und seinem Sohn präzisere Aufschlüsse über das Privat- und Seelenleben des Künstler liefern können. Aber auch ohne intime Details entsteht – trotz aller Widersprüchlichkeiten in Kinskis Charakter – ein ziemlich klares Bild vom Künstler und dessen disparaten Filmschaffen.
Diese biographisch angelegte Filmographie liefert keine sensationellen Enthüllungen oder Einsichten. Keine Anekdoten oder Klatschgeschichten. Davids Darstellung ist sauber recherchiert, filmkritisch fundiert und flüssig erzählt. Für Kinski-Fans und Kinski-Gegner wird es bis auf weiteres „Die Biographie“ sein.
Jörg von Bilavsky
Christian David: Kinski. Die Biographie. Aufbau Verlag, Berlin 2006. 447 Seiten. 24,90 Euro.











