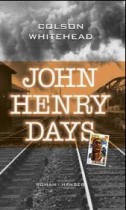 Die unerträgliche Belanglosigkeit des Seins
Die unerträgliche Belanglosigkeit des Seins
Der archaische Kampf auf Leben und Tod und das Dahintreiben in postmodernen Belanglosigkeiten – dies sind die beiden Pole, zwischen denen Colson Whitehead in seinem zweiten, enzyklopädisch ausgreifenden Roman hin und her pendelt und dabei einen zwiespältigen Eindruck hinterlässt.
Der 1969 in New York geborene Afro-Amerikaner erzählt in„ John Henry Days“ zum einen die Legende von John Henry, der als „Bohrhauer“ im Westen Virginias einen Tunnel durch das Big Bend trieb und durch seinen heroischen Wettkampf mit einer Dampfbohrmaschine der ersten Generation berühmt wurde. Diesen vermochte er zwar zu gewinnen, aber nur um den Preis seines eigenen Lebens. So erfüllte sich, was John Henry, dieses „Prachtexemplar der Gattung Mensch“ schon immer wusste: „… der Berg würde ihn irgendwann kriegen“.
Der Held und der Spesenritter
Als Antagonist von John Henry, dessen Ballade man seit dem späten 19. Jahrhundert im ganzen Süden Amerikas sang und summte, tritt der Journalist J. Sutter auf. Als Spesenritter und Bewohner von „Terminal City“ ist er immer in der Luft, unterwegs zum nächsten Promotion-Termin, auf dem er Büfetts plündert und alles absahnt, was es abzusahnen gibt. Er, der schwarze Yankee aus New York, der sich immer „von der Esse der Geschichte seines Volkes“ fernzuhalten versuchte, soll anlässlich des „John Henry Days“-Festivals in Talcott/Virginia für ein Internet-Magazin berichten. Die strahlende Legende, das „Ideal schwarzer Männlichkeit in einem kastrierten Land“, kontrastiert dabei auf das Schärfste seine eigene Bedeutungslosigkeit: „Ziehe eine Linie unter dem Wort heroisch und führe sämtliche Bedeutungen auf. Keine einzige trifft auf ihn zu.“
Amerikanische Kulturgeschichte
Zwischen den Polen John Henry und J. Sutter reiht Colson Whitehead sein vielköpfiges Romanpersonal ein und zeichnet in variationsreichen Prosastücken auch eine amerikanische Kulturgeschichte zwischen Sklaverei, Fortschrittseuphorie, Black Power und Pop-Kultur. Mit kubistischen Splittern zieht er so eine Linie von den frühen Plaggern und Claqueren, die Songs in den Musikkneipen bewarben, bis zum Beginn des RocknRoll, mit dem ein Riss in das historische Kontinuum trat und plötzlich alles möglich erschien. Doch dann besiegelte, wie Whitehead uns zeigt, das tragische Konzert der Rolling Stones in Altamont, bei dem die Hells Angels Konzertbesucher zu Tode prügelten, schon das Ende der 60er und der Gegenkultur. Die Träume und Utopien rutschen nun hoffnungslos in den immer schneller in seiner eigenen Bedeutungslosigkeit kreiselnden „Pop“ und in die kafkaesk entmenschlichte Virtualität von Internet, Public Relations und New Economy ab.
Flickenteppich
Colson Whiteheads Roman „John Henry Days“ erscheint beim Lesen als ein großflächiger Flickenteppich, aus dem sich einerseits faszinierende Muster und Linien der modernen Kultur ergeben, der zugleich aber auch aus vielen unverbundenen und fadenscheinigen Stofffetzen besteht. Atmosphärisch dichte, fast epische Szenen und satirisch-pointierte Kulturkritik stehen so neben endlos aneinander gereihten snapshots aus dem ganz alltäglichen amerikanischen Leben. Zäh und redundant führen diese immer wieder die Banalität unserer heutigen Welt im Vergleich mit der archaisch-heroischen von John Henry vor Augen – eine Einsicht, zu der auch der Spesenritter J. Sutter, dieser postmoderne Mann ohne Eigenschaften, gegen Ende des Romans kommt: „Er überlegt, welche moderne Entsprechung es für John Henrys Geschichte, für sein Martyrium geben könnte. Aber er lebte in anderen Zeiten und ihm fiel nichts ein.“
Karsten Herrmann
Colson Whitehead: John Henry Days. Roman. Aus dem Amerikanischen von Nicolaus Stingl. Hanser 2004. 526 Seiten. 24,90 Euro. ISBN: 3-446-20469-5











