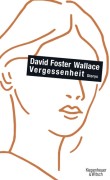 Der Tausendprozentige
Der Tausendprozentige
David Foster Wallace kann eigentlich alles. Aber anders als die meisten Alleskönner kann er alles nicht nur ein bisschen, sondern auch noch ein bisschesser als alle anderen.
Er kann richtig gut nerven, er kann unglaublich langweilen, er kann die überflüssigsten Umwege gehen, hunderte von Seiten lang in Fußnoten über fast gar nichts dampfplaudern; er kann Traktate schreiben, die sich in Sphären bewegen, in die ihm vielleicht noch fünf andere Menschen auf diesem Planeten problemlos folgen können, aber wenn er will, kann er auch erzählen wie kein zweiter, so unerhört dicht, intensiv, brüllendkomisch und gleichzeitig mit einem so intensiv-welthaltigen Impact, dass es einem den Atem verschlägt.
Sein Bestseller Schrecklich amüsant, aber in Zukunft ohne mich, eigentlich eine Auftragsreportage über eine Kreuzfahrt, ist ein gutes Beispiel dafür, wie seine Texte funktionieren: David Foster Wallace recherchiert so akribisch, bis der Gegenstand seiner Recherche bis auf die Knochen zerlegt ist und die Mechanik jeder Geste, jedes Lächelns exakt aufgezeigt ist. Die Besessenheit, mit der er sich in die Materie wühlt, bewegt sich fernab von jeder Detailverliebtheit, denn der zugrunde liegende Impuls ist nicht der eines Erzählers, der möglichst anschaulich beschreiben will. Es ist der eines Anatomen, der begreifen, verstehen will, wie die Welt funktioniert, wie Menschen, die Medien, wie soziale Strukturen funktionieren und deswegen alles zerlegen und untersuchen muss. Dass er sich dabei nie, wirklich nie auf nahe liegende Gedanken verlässt, die andere kluge Leute schon vor ihm zu vielleicht ähnlichen Themen teilweise sogar schon zu eindrucksvollen Bildern verdichtet haben, gehört zu seinen herausragenden Leistungen, und auch daran liegt es, dass der Kosmos des David Foster Wallace so einzigartig ist. Beim Lesen seiner besten Texte hat man das Gefühl, man betrete als erster Mensch den Neuschnee über einem fremden und seltsamen Land, das dann doch das eigene ist.
Anatomie der Informationsgesellschaft
Wie er über die Absurdität unserer medialen Welt schreibt, über grotesk missglückte Schönheitsoperationen, über Schlaflabore (in denen herausgefunden werden soll, welcher Ehepartner den anderen durch sein Schnarchen vom Schlafen abhält), über Künstler, die ihre eigenen Ausscheidungen ausstellen und die mediale Brechung dieser „Scheiße“ auf allen Meta-Ebenen, das ist oft hochkomisch und von einer überwältigenden Hellsichtigkeit.
Genauso oft aber ist er „nur“ der kalte Beobachter, der seine Fundstücke hinter Glas ausstellt. Als Besucher steht man vor den Vitrinen, man staunt und bewundert die Exponate, aber man liebt sie nicht. Aber wollen Texte geliebt werden, in denen Reisende „lateral an der Telefonreihe vorbei“ hetzen und „transitorische ischämische Attacken“ bekommen, in denen der Regen „auf die konvexen Butzenscheiben der Fenster jetzt in vaskulären oder peristaltischen Pulsen oder Wellen“ prasselt und infolge der „Vehemenz ihres jähen Aufschreis Adrenalin, Cortisol und andere Stresshormone in meinen Kreislauf ausgeschüttet“ werden?
Der Band Vergessenheit versammelt die drei verbliebenen Geschichten aus Oblivion, die nicht unter dem Titel In alter Vertrautheit (Kiepenheuer & Witsch 2006) erschienen sind; die längste und beste davon („The suffering channel“) zeigt David Foster Wallace auf der Höhe seiner Kunst, denn hier fügt sich sein Wissen, seine Erzählkunst, sein unerbittlicher, die Materie durchdringender Blick und seine Klugheit zu einem dunkel schimmernden Juwel, das vieles überstrahlt, was derzeit geschrieben wird. Ja, selbst Pynchon, mit dem er ständig verglichen wird, denn der will ja eigentlich nur spielen, während es David Foster Wallace immer ums Ganze geht.
Am Ende trägt man ein etwas entrücktes und leicht verstörtes Lächeln in die Welt jenseits des Buches. Und die Beruhigung, diese Welt mit jemandem zu teilen, der das alles weiß. Der da ist, der aufpasst und aufschreibt.
Stefan Beuse
Foster Wallace: Vergessenheit. Storys. Aus dem Amerikanischen von Ulrich Blumenbach und Marcus Ingendaay. Kiepenheuer & Witsch 2008. 222 Seiten. 18,95 Euro.











