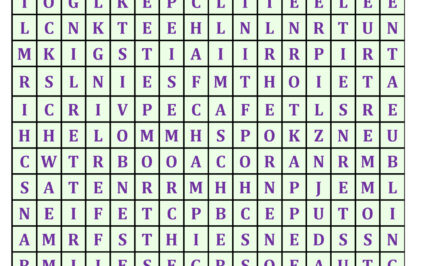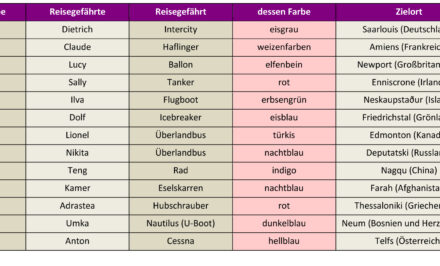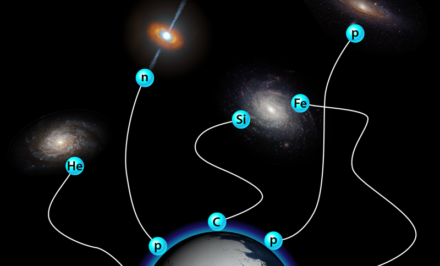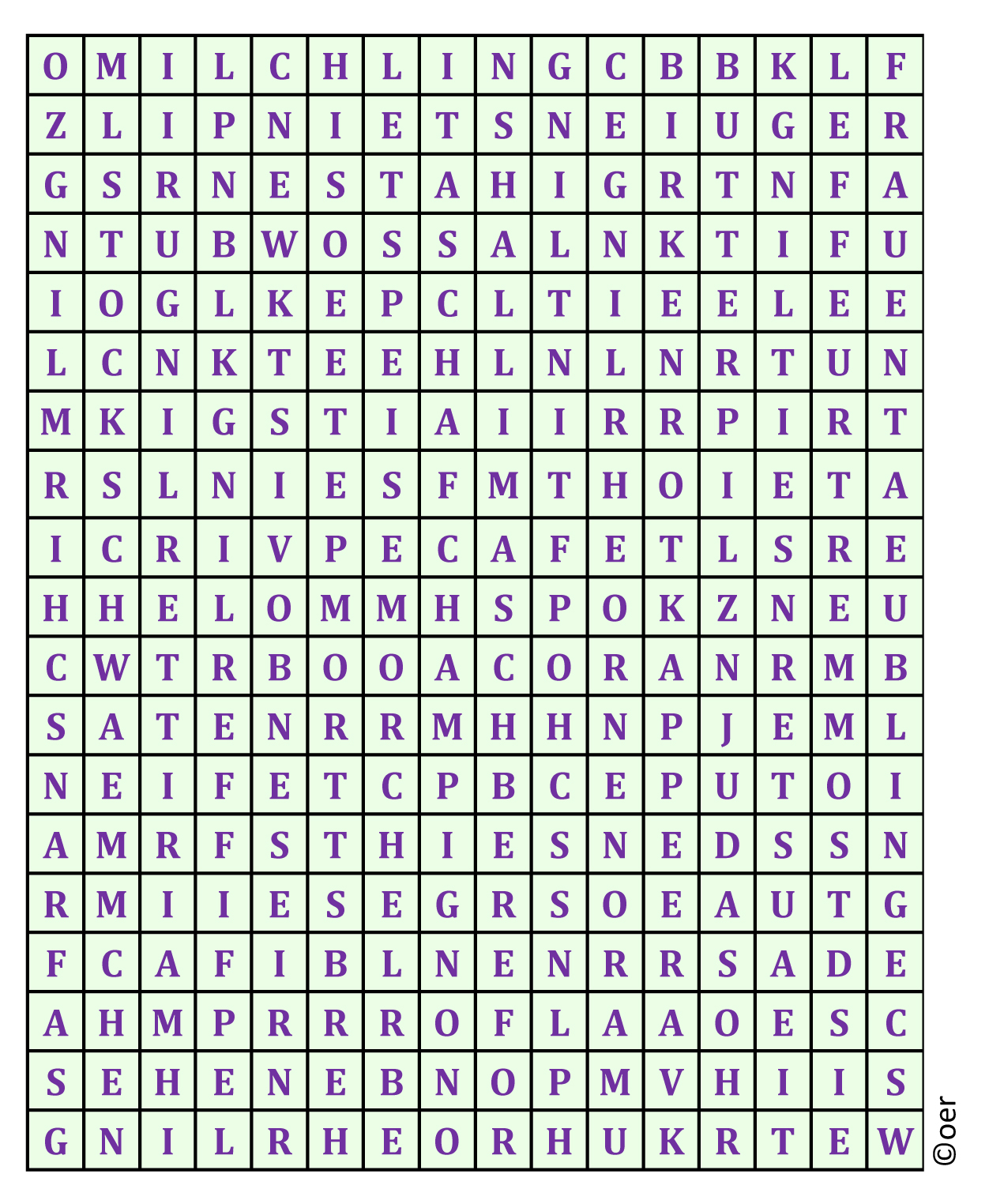Textanalyse und Aufführung mit gemischter Raubtiertruppe
Textanalyse und Aufführung mit gemischter Raubtiertruppe
– Dieter Dorn war 35 Jahre lang als Regisseur und Intendant an den Münchener Kammerspielen und dem Residenztheater tätig; jetzt inszeniert er gerade Wagners „Ring“ in Genf. In seinem faszinierenden Rückblick auf sein Bühnenleben beleuchtet er mit großem Scharfblick und subtiler Selbstironie markante Inszenierungen, seine loyale Raubtiertruppe und die Bedeutung von Texttreue. Von Peter Münder
Die wahre Faszination der theatralischen Wunderwelt, der magischen Momente eines bedeutenden Stücks kann wohl nur jemand wie dieses Theatergenie Dieter Dorn erschließen. Er ist 1935 in Leipzig geboren, besuchte die Thomasschule, spielte früh Klavier, erlebte die großen Dirigenten des Gewandhausorchesters, ließ sich auch vom Theater verzaubern und „schwamm so richtig in der Leipziger Kunstsuppe“. Eigentlich wollte er Pianist oder Dirigent werden, schließlich spielte er sogar Rachmaninows Etüden „so einigermaßen“ und er komponierte auch ‒ „dabei spielte natürlich die Eitelkeit keine geringe Rolle“, schreibt Dorn in seiner Autobiografie. Diese musikalischen Träumereien lösten sich jedoch in einem desillusionierenden Nebel auf, als er registrierte, dass sein bester Freund doppelt so gut Klavier spielte wie er. So kam er auf einigen Umwegen zum Theater.
Dieter Dorn hat fast alle denkbaren Irrungen und Wirrungen vor und hinter den Kulissen erlebt. In Ost-Berlin hatte er noch bei Brecht und Helene Weigel hospitiert. Die neue Sicht Brechts, das Entdecken gesellschaftlicher Prozesse im Text und das Umsetzen dieser Aspekte auf der Bühne haben Dorn stark geprägt. Aber nach unerträglichen ideologischen Indoktrinationstorturen und „Formalismus“-Vorwürfen der SED-Apparatschiks war er 1956 in den Westen geflohen und hatte nach der Schauspielausbildung seine ersten Regieerfahrungen in Hannover, Essen, Oberhausen, Hamburg (Schauspielhaus) und Berlin (Schillertheater) gemacht.
Das Leben als Stationendrama: Als Dieter Dorn 1958 in Berlin die Schauspielschule beendet und auf der Suche nach dem ersten Engagement ist, verschickt er 50 Postkarten mit seinem Porträt an 50 Theater, von denen kein einziges antwortete. Dann wird er nach Hannover eingeladen, wo er schnell Karriere macht, weil er einfach überall einsetzbar ist: Als Schauspieler, Regieassistent und Dramaturg. Seine erste Rolle war der Busch, an dem die Handwerker im „Sommernachtstraum“ ihre Kleider aufhängen.
In Hamburg konnte er zwar Christopher Hamptons „Menschenfreund“ inszenieren, was ihn wegen der Arbeit mit den großartigen Schauspielern Helmut Griem und Gisela Stein so beflügelte und euphorisierte, dass er glaubte, er würde „nur noch fliegen“. Für ihn war es eine Art Initiation: „Ich merkte, plötzlich, dass ich diesen Wunderkindern irgendwie gewachsen war“. Und dass er die hinter den Texten anvisierte Gegenwelt und deren magische Momente in ihrer gemeinsamen Arbeit aufscheinen lassen konnte. Aber ihn nervte an diesem riesigen Haus auch die fehlende Kontinuität der Leitung, die kurzen Intervalle zwischen der Intendanz von Schuh, Monk und Lietzau sowie der Kleinkrieg mit den Pfeffersäcken der Stadt, die das Finanzgebaren der Theaterleitung monierten.
In Berlin hatte er 1975 die Proben für seine Inszenierung von Thomas Bernhards „Der Präsident“ nach mehreren Wochen intensiver Arbeit mit Stars wie Martin Held und Thomas Holtzmann einfach abgebrochen, weil er meinte, an diesem mit zu vielen Mimen und Verwaltern aufgeblasenen Theater nicht länger arbeiten zu können. Darüber urteilt Dorn jetzt kleinlaut und selbstkritisch: „Das war eigentlich eine Unverschämtheit, vor allem den Schauspielern gegenüber.“ Der damalige Intendant Lietzau hätte ihn verdonnern müssen, die Inszenierung zu Ende zu bringen. Was folgte, war auch ein vorübergehender Bruch mit dem pikierten Thomas Bernhard ‒ aber da Dorn später mehrere Bernhard-Stücke inszenierte, darunter den wunderbaren, lange gespielten „Theatermacher“ in München, versöhnten sich die beiden Theaterbesessenen wieder.
Der Regisseur als Rattenfänger
Wenn Dorn einen Blick zurück wirft auf große Bühnenmomente, auf die Arbeit mit seiner „gemischten Raubtiertruppe“ mit Diven wie Sunnyi Melles und Gisela Stein, dann beschreibt er seine Truppe wie ein liebevoller Vater, der seine Familie behütet. Er sieht sich aber auch als Rattenfänger, der seine Mimen mitnehmen muss auf einen Weg, den niemand genau kennt und dessen Ziel man nur diffus erahnen kann. Dankbar registriert er heute noch, wie selbstverständlich die Schauspieler diesen Weg mitgingen und sich auf seine Deutungshoheit verließen, auch wenn sie dabei selbst ihre eigenen Ideen entwickeln und erarbeiten konnten und die Texte zusammen interpretierten. Natürlich gab es auch Irritationen und Kuriositäten wie etwa den Rollstuhlfahrerprotest gegen Dorns Direktive, die bevorzugte Kartenvergabe an behinderte Rollstuhlfahrer zu beenden, weil diese einen veritablen Schwarzmarkthandel mit den Karten etabliert hatten.
Sehr aktuell mutet auch der damalige Zickenkrieg der beiden Stars Sunnyi Melles und Gisela Stein an: Beide kämpften verbiestert um einen Teppich , den die empfindsame Sunnyi Melles zwecks Geräuschminderung unbedingt vor ihrer Garderobe ausgelegt haben wollte, während die robustere, geräuschresistente Stein diesen Teppich immer wieder aufrollte und entfernte. Dorn versuchte in solchen Fällen immer, sich möglichst neutral zu verhalten: „Man darf die eine Löwin nicht intensiver streicheln als die andere“, meint er. Und private Kontakte zu seinen Stars begrenzte er auf ein Minimum. Vielleicht konnte sich deswegen auch ein so starker Teamgeist entwickeln: Niemand wurde bevorzugt, es gab keinen Personenkult.
„Die Größten sind die Einfachsten“, schreibt Dorn über Ausnahme-Mimen wie Minetti, Rolf Boysen oder Thomas Holtzmann. Ihnen konnte er viel zumuten, weil sie meistens ohne Allüren und sehr verständnisvoll auf seine Einfälle und das mitunter langwierige, mühsame Erarbeiten von Stücken eingingen. Vom profilneurotischen Textzertrümmern, wie es manche Regiekollegen mit Inbrunst betreiben, hält Dieter Dorn überhaupt nichts. Er ist verständlicherweise der Liebling der Puristen, die in einer Inszenierung auch noch Sprache und Absicht des Dramatikers erkennen wollen. Und nicht auf Videobildschirme glotzen oder Goethe, Schiller, Kleist und Shakespeare als Schrittmacher einer stammelnden, geifernden Punk-Bewegung erleben wollen.
Dennoch ist er nicht nur auf die hehren Klassiker fixiert: Seine legendären Genet-Inszenierungen, vor allem „Die Zofen“, verstörten, bewegten und begeisterten die Zuschauer, weil sie sich radikal mit herkömmlichem Rollenverhalten auseinandersetzten und die Herr-Knecht-Problematik ganz brutal auf den Kopf stellten und ausagierten. Damals sperrte sich Dorn bei den Proben mit Rolf Boysen und Thomas Holtzmann, die als rachsüchtige Zofen die Ermordung ihrer Herrin planen, im Probenraum ein, weil niemand sie vor der Premiere in ihren auffälligen Kleidern und den extrem hochhackigen Stöckelschuhen sehen sollte ‒ auch nicht ihre Ehefrauen. Es wurde ein skandalumwitterter Erfolg, der dem Regisseur Freikarten in sämtlichen Schwulen-und Transvestiten-Etablissements bescherte.
Wenn Kritiker (Vgl. Wolfgang Höbel im SPIEGEL: „Edler Plausch, wüster Rausch“, 25.10.2001) daher auf dem Höhepunkt des Münchener Theaterkrieges, als die krypto-avantgardistischen Pseudomodernen um Dorns Nachfolger Frank Baumbauer gegen den angeblichen Traditionalisten Dieter Dorn monierten, die Inszenierungen Dorns müssten in der Schublade „konservative, pomadige Hochkultur“ abgelegt werden, dann verkennen sie einfach das große Faible des Textentdeckers und Analytikers Dorn für experimentierfreudige zeitgenössischer Dramatiker (Botho Strauß, Handke, Hampton, Thomas Bernhard, Yasmina Reza, David Storey), die Dorn alle inszenierte. Er will den Zuschauer eben nicht mit digitalen Bilderwelten zumüllen, sondern ihm zumuten, einige Textfinessen und Figurenentwicklungen auch in den Klassikerinszenierungen selbst zu eruieren. Plumpe Holzschnittkontraste, meint Dorn, überfluten uns eh schon überall: Das Böse bei Shakespeare oder Schiller ergebe sich jedoch direkt aus den Stücken und werde auch genau begründet, da brauche es keinen plumpen Oberinterpreten, der mit hanebüchener Effekthascherei darauf hinweise. Ebenso sei es laut Dorn inakzeptabel, in einer modernistischen „Faust“- oder „Tasso“-Inszenierung die Sprache mit einem Jargon von Zuhältern oder Gangstern zu verhunzen oder die feudale Pyramide hierarchischer Strukturen einzuebnen:
„Die Hierarchie muss ernst genommen werden, denn nur wenn der Kontext stimmt, kann der Zuschauer daraus seine eigenen Schlüsse ziehen. Wenn Gretchen im ‚Faust‘ dramaturgisch aus ihrem historisch-sozialen und gesellschaftlichen Umfeld genommen wird, bedeutet das eine Minimierung ihrer großen Konflikte, die dadurch entstehen, dass sie mit einer unbändigen Lust ausbrechen will aus ihrer engen, erstickenden dörflichen Welt und sich dann mit einer Hand voll Gold leicht hinwegträumt in eine andere Welt. Das war aber zu ihrer Zeit, zur Gegenwart des Stücks, eine Ungeheuerlichkeit. Nur daraus entsteht die Katastrophe. Wenn man das aber aus einer Besserwisserei heraus inszeniert und sich schlauer fühlt, weil man einer anderen Zeit angehört, hat man schon verloren. Der Weimarer Geheime Rat hat dazu einen schönen Satz geprägt: Die Kunst gibt sich selbst Gesetze und gebietet der Zeit. Der Dilettantismus folgt der Neigung der Zeit“.
Seine Arbeiten folgten jedenfalls nicht der Neigung der Zeit: All die zum Berliner Theatertreffen oder zu den Salzburger Festspielen eingeladenen Inszenierungen (Stücke von Hampton, Botho Strauß, Lessing, Kleist, Shakespeare sowie Opern von Richard Strauss, Wagner, Henze, Mozart) wirkten frisch, brisant und aktuell, ohne dass der Kern der Stücke aufgeweicht oder die Thematik verdreht worden wäre. Und wenn über Texttreue und das Regietheater diskutiert wird, dann weist Dorn auf einen interessanten Aspekt hin: „Es ist doch komisch, dass einige Regisseure auf der Bühne mit der Montage von Textflächen jonglieren ‒ aber niemand würde es doch wagen, in einer Beethoven-Partitur herumzupfuschen und darin einige Passagen einfach zu kürzen!“ Seine Einstellung zur Kritik tendiert übrigens gegen Null: Er hält es für einen großen Fehler, sich am hymnischen Lob oder auch an Verrissen zu orientieren ‒ der einzige Kompass, den er gelten lässt, ist die Motivation, mit seiner Truppe eine stringente, insgesamt glaubwürdige und anregende Regiearbeit abzuliefern.
Agenten in der Oper
Fünfzehn Opern ‒ von Mozart bis Henze, von Richard Strauss bis Wagner ‒ hat Dieter Dorn bisher zwischen Wien, Salzburg, New York und Genf inszeniert. Als die große SALT 2 Abrüstungskonferenz im Juni 1979 in Wien stattfand, inszenierte er Mozarts „Entführung aus dem Serail“ (Dirigent Karl Böhm) an der Staatsoper. Er konnte nicht ahnen, dass sowohl Jimmy Carter als auch Breschnjew mit großem Gefolge bei der Premiere dabei sein würden: Dreihundert Bodyguards und Geheimagenten wuselten zur Blütezeit des Kalten Krieges in der Oper herum ‒ hinter den Kulissen, in den Garderoben, im Keller, auf dem Schnürboden, in der Beleuchtung ‒ überall standen die Männer in ihren grauen Anzügen und dunklen Sonnenbrillen betont unauffällig herum und störten den Maestro bei der Arbeit. In der Pause wurde der Regisseur zu Jimmy Carter in die Loge gerufen: Breschnjew war krank geworden und hatte sich verabschiedet, daher musste Carter aus protokollarischen Gründen die Oper auch verlassen. Er wollte aber noch wissen, wie die ganze Entführungsstory ausging. Darüber klärte der deutsche Regisseur den ahnungslosen US-Präsidenten auch gründlich auf.
Als Dorn sich dann nach der Pause im Theater umsah, merkte er, dass Parkett und Ränge fast leer waren: Der Agententross und das gesamte Gefolge der amerikanisch-sowjetischen Verhandlungsdelegation war nicht mehr präsent. Und da schrien die restlichen Zuschauer auch schon wie hysterische Furien „Da ist das Schwein!! Das ist er!!“ und zeigten wütend auf den Regisseur. Sie machten nämlich Dieter Dorn und seine Regie für den vorzeitigen Abgang der vielen Besucher verantwortlich. Als er diese Anekdote Anfang November bei einer Lesung und Diskussion mit dem Hamburger FAZ-Kulturredakteur Thomas Wegner im Ernst-Deutsch-Theater erzählt, ist er selbst nicht nur sehr amüsiert, sondern geradezu begeistert. Denn dass man sich über eine Inszenierung so enragieren und echauffieren und sich mit dem Erfolg einer Oper dermaßen identifizieren kann, erlebt man schließlich nicht alle Tage, und das ist für den Theatermacher eine tolle Erfahrung. Dieter Dorns Autobiografie vermittelt wunderbar diesen grenzenlosen Enthusiasmus für die magische Bühnenwelt ‒ es ist ein absolut faszinierendes, aufregendes Theaterbegeisterungsbuch.
Peter Münder
Dieter Dorn: Spielt weiter! Mein Leben für das Theater. Autobiographie. München: C.H. Beck 2013. 416 Seiten. 60 Abbildungen. 22,95 Euro. Verlagsinformationen zum Buch.