Schnittstelle: Berliner Mauer. Christina Mohr im „Doppelschlag“ über einen Sammelband, der die künstlerische Auseinandersetzung mit der Berliner Mauer dokumentiert und über David Byrnes „Bicycle Diaries“, in denen der Musiker Berlin (und andere Metropolen) als „radelnder Flaneur“ mit dem Fahrrad erkundet.
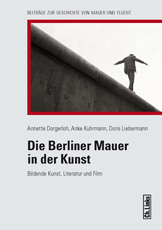 Mauer-Geschichten
Mauer-Geschichten
„Beuys empfiehlt die Erhöhung der Berliner Mauer um 5 cm (bessere Proportion!). “
Seit ihrer Errichtung bot die Berliner Mauer Anlass zu Klagen und zynischen Kommentaren (siehe Beuys-Zitat), denen überwiegend der Wunsch innewohnte, das menschen- und ländertrennende Bauwerk einzureißen. Doch wie andere Grausamkeiten dieser Welt wurde die Mauer vielen zur künstlerischen Inspiration: um erlittenes Unglück zu bewältigen, Appelle auszusenden oder eine wie auch immer gestaltete Zukunft zu imaginieren. Unzählige FotografInnen, MalerInnen und Poeten arbeiteten sich an der Mauer ab, machten den 43,1 Kilometer langen Wall, die „Narbe“, den „Riss“ oder „Schnitt“ zum Hauptdarsteller von Filmen, Bildern, Gedichten und Büchern.
Die Herausgeberinnen Annette Dorgerloh, Anke Kuhrmann und Doris Liebermann haben in dem 300 Seiten starken, reich bebilderten Band „Die Berliner Mauer in der Kunst“ Beispiele künstlerischer Auseinandersetzungen zusammengetragen: Aufgeteilt in die drei Hauptkapitel Malerei, Literatur und Film werden Werke aus Ost und West vorgestellt, erläutert und in chronologische und Sinnzusammenhänge gebracht.
DDR-regimetreue Auftragsarbeiten, die „ehrliche, tapfere, disziplinierte und wachsame Soldaten“ (aus dem Fahneneid der DDR-Grenztruppen) zeigen, werden dabei ebenso behandelt wie die ätzend-bösen, aber auch ratlos-indifferenten Auslassungen Wolf Biermanns. Dass staatskritische Dichter aus der DDR mit Gefängnisfolter rechnen mussten, westdeutsche Filmemacher wie Reinhard Hauff („Der Mann auf der Mauer“, 1982 mit Marius Müller-Westernhagen) dagegen mit Preisen der Filmakademie bedacht wurden, sind so lapidare wie eindrückliche Randnotizen aus diesem Buch, dessen Lektüre vorbehaltlos empfohlen werden kann bzw. muss.
Annette Dorgerloh/Anke Kuhrmann/Doris Liebermann: Die Berliner Mauer in der Kunst: Bildende Kunst, Literatur und Film. Gebunden. 300 Seiten. Mit zahlreichen Abbildungen. Berlin: Christoph Links Verlag. 34,90 Euro. Zum Verlag geht es hier, Zur Stiftung Berliner Mauer hier.
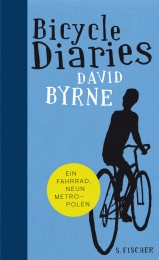 Erlebnisse auf zwei Rädern
Erlebnisse auf zwei Rädern
Wenn Sie in einer Metropole wie Berlin, London, Buenos Aires oder Istanbul leben und Ihnen ein hagerer, gutaussehender Mittfünfziger auf einem Faltfahrrad auffällt: Beginnen Sie ein Gespräch mit ihm, es könnte David Byrne sein! Multimedia-Künstler und Talking Heads-Mastermind Byrne schwang sich schon im New York der siebziger Jahre aufs Rad, um im Nachtleben schneller und flexibler unterwegs zu sein als seine Musikerkollegen. Dass er von diesen als uncool verunglimpft wurde, kümmerte ihn wenig – und bis heute bevorzugt er diese Art der Fortbewegung, wobei er betont, kein Radsportler zu sein.
Der 1952 in Schottland geborene Byrne ist vielmehr ein radelnder Flaneur, ein Beobachter, Kommentator und Geschichtenerzähler, der mit seinen „Bicycle Diaries“ ein wunderbares Beispiel dafür bietet, dass es den Gedanken am zuträglichsten ist, wenn sie nicht von Mauern umgeben sind, egal ob von innen oder außen.
Mit dem Faltrad als ständigem Begleiter macht sich Byrne in jeder neuen Stadt auf den Weg und schaut. Trifft Leute im Café und denkt nach, zum Beispiel über die Berliner Mauer: Mit den Talking Heads hielt sich Byrne in den frühen Achtzigern häufig in West-Berlin auf und war – wie fast alle Pop-Künstler – fasziniert und abgestoßen zugleich von der kaputten Dekadenz der geteilten Stadt. Seiner Meinung nach wurde der breite Streifen links und rechts der Mauer deshalb nicht bebaut, weil damit gerechnet wurde, dass die Mauer nicht lange stehen würde und nur ein Übergangsobjekt sei.
Viele von Byrnes Beobachtungen sind nicht sofort nachvollziehbar, wie z. B., dass die Berliner Radfahrer so zuvorkommend und diszipliniert seien. Es ist aber genau dieser freundlich-distanzierte Blick, der seine Ausführungen so lesenswert macht: Auch als Radfahrer ist Byrne in allererster Linie Künstler und Musiker und betrachtet die Welt/die Architektur/die Werbung/die Mode/die Einkaufsstraßen durch diese spezifische Brille. Er ist aber auch Historiker, Kultur- und Gesellschaftswissenschaftler, Stadtplaner, Psychologe und Humanist.
Seine essayistischen Tagebucheinträge über Detroit, Manila, Sydney und – last but not least – seine Homebase New York City sind so klug und poetisch, dass man „Bicycle Diaries“ mit reinstem Herzen und Gewissen an Freunde verschenken kann. Am Schluss des Buches gibt er praktische Tipps für Radler (nicht Radsportler!) und präsentiert Skizzen für Fahrradständer, die selbstverständlich aus seiner eigenen Zeichenfeder stammen.
Christina Mohr
David Byrne: Bicycle Diaries: Ein Fahrrad, neun Metropolen. Deutsch von Brigitte Jakobeit. Gebunden mit Lesebändchen. S. Fischer 2009. 368 Seiten 19,95 Euro. Zum Verlag geht es hier, zur Homepage von Byrne hier.












