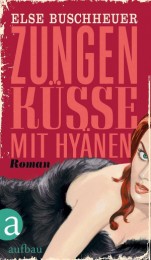 Wir sind die Guten! Die Guten sind auch nicht besser.
Wir sind die Guten! Die Guten sind auch nicht besser.
Ein turbulenter neuer Roman von Else Buschheuer. Sophie Sumburane hat sich amüsiert.
In Dingenskirchen zu unserer Zeit, sitzt der Vorzeigechauvinist Wolfgang Müller in seinem Rollstuhl, feiert Orgien und beschäftigt das Personal seiner „gelben Villa“. Zur gleichen Zeit zieht die 33-jährige männliche Jungfrau Michael Rothe mit einer Tupperdose Bohneneintopf und 1000 von Mutti geklauten Euros in blinden Aktionismus in die große Stadt, Rizz. Irgendeine Metropole, weit weg von seiner verstaubten Heimatstadt Grimmelshausen. Michael träumt von der glitzernden Karriere eines erfolgreichen Journalisten, von Zungenküssen mit schönen Frauen und rauschenden Partys. Stattdessen spricht er bei seinem Patenonkel vor, landet im Boulevard-Regionaljournalismus und erlebt die orale Entjungferung im Puff. Ob von Barbie-Oma oder seinem schwulen Nachbarn, das will er nicht wissen.
Was die abwechselnd in Leipzig und Berlin lebende Else Buschheuer mit ihrem vierten Roman abliefert, ist mehr als kurios. Schon der Titel mutet besonders an, die ersten Sätze bestätigen die Vermutung, die Überschrift des ersten Abschnitts lässt keine Zweifel mehr zu. Tingeltangel. So sei sie gewesen, die verSCHTORbene Felicitas Müller – Michael Rothes Vormieterin, Bestsellerautorin und Gastgeberin von Krethi und Plethi in Personalunion. Beschwerden gab es über sie vor allem wegen lauter Beischlafgeräusche, weiß ihre ehemalige Vermieterin, eine der vielen liebevoll gestalteten Nebenfiguren, Irene Puvogel (sich selbst Puh-Vogel sprechend), zu berichten. Dabei war die junge Frau, ihrer roten Locken wegen die „Rote Müllerin“ genannt, doch die Geliebte von Wolfgang Müller, dem Star-Regisseur von Rizz, einem alterndem geilen Bock, der seine Frauen am liebsten jung und dumm mag, während er selbst als Liebhaber nicht mehr der Knaller gewesen sein dürfte. Was ihm aber auch egal war, Hauptsache für ihn: er hat seinen Spaß. Und das heißt auch: immer bei ihm, nie bei ihr. Felicitas und Müller, so schien es, schienen durch eine Hass-Liebe verbunden, sie konnte ihm intellektuell das Wasser reichen, wohingegen sich die sonstigen Besucherinnen eher durch „hohe Absätze, kurze Hauptsätze“ auszeichneten.
Obwohl beide vorgaben, freiheitsliebend zu sein, lebten sie doch in einer (auf Buschheuer-Art) eheähnlichen Gemeinschaft, verfallen einander, haben trotzdem mehrere Affären nebenher und sind traurig, wenn das im Streit an die Wand geworfene Geschirr nicht kaputt geht. Bis etwas schief läuft: an ihrem 30. Geburtstag hat Felicitas Gift im Glas und überlebt den Abend nicht. Müller tut, als könnte er weiter machen wie bisher, doch so richtig kommt er nicht über Felicitas hinweg. An Müller und der Müllerin zeigt Buschheuer ins extreme gezogene Geschlechter-Klischees, die eigentliche Moral der Beziehung: Frauen leiden zwar mehr, aber sie sind weniger gefühlstief als Männer.
In der Figur des Müller, der reich und mächtig, gleichzeitig nonchalant ist, zu einer Geliebten „du bist meine fleischgewordene Wichsvorlage“ sagt und mehrere Affären gleichzeitig hat, obwohl er eigentlich kaum alleine aufs Klo gehen kann, wird durch Buschheuer eine fundamentale Widersprüchlichkeit auf den Punkt gebracht, die sich unsichtbar durch uns alle zieht. Mehr oder weniger subtil, gekleidet in das Gewand eines Crescendo der Unerhörtheiten.
Absurdes Lesevergnügen
Aber zurück zu Michael Rothe, der im Lauf der Geschichte immer mehr ins Rizzer Highsociety-Leben abrutscht, und als Möchtegern-Journalist im Leben seiner Verstorbenen Vormieterin herum zu schnüffeln beginnt. Der unglaubliche Zufall, ausgerechnet in dieser Wohnung zu Wohnen, muss ausgenutzt werden, logisch. An diesem Punkt hätte ein langweiliger Journalist-als-Ermittler-Krimi aus dem ganzen werden können. Ist es aber – zum Glück – nicht. Nicht mit Else Buschheuer. Und das hätte auch so gar nicht gepasst, zum satirischen Ton des Buches. Statt in gewohnten Bahnen zu laufen, scheint Buschheuer regelrecht Spaß daran zu haben, die Geschichte erneut in eine noch absurdere Richtung umzulenken, noch einmal einen drauf zu setzen. Irgendwann ringt sich der Leser ob all der Absurditäten bei der Bemerkung, im Streit würde die Rote Müllerin dem Müller schon mal auf die Terrasse pinkeln, gerade noch ein müdes Lächeln ab, ein Kuriosum das untergeht, neben den vielen anderen.
Das Buch ist dennoch ein leichtes Lesevergnügen, fernab vom effekthascherischen Literatengestus und dem Anspruch, die Welt erklären zu wollen. Stattdessen voller Sexorgien, Schimpfwörtern und alltagssprachigen Dialogfetzen. Da wird Michael zu Mei-kel, Klarhabbisch’s Dialoge sind in feinstem Araber-Deutsch verfasst und ganz dringend wird Honisch gesucht. Oder vielmehr was gegen Honisch. Denn auch das Lieblingsmotiv einschlägiger Romane, das aus Grund XY unleserliche Tagebuch der Toten darf natürlich nicht fehlen. Doch selbst dafür hat Buschheuer einen originellen Einfall: Mei-kel findet es mit Honig verklebt im Schrank und landet in der chemischen Reinigung, um Hilfe ersuchend.
Buschheuer scheint die beliebtesten Motive der deutschen Genrelandschaft gesammelt zu haben, um sie in ihr Kuriositätenkabinett einzusetzen. Jede der Figuren ist eine auf die Spitze getriebene Überzeichnung „der“ Figur, vom „Prachtexemplar des aussterbenden weißen Mannes“ (der Rollstuhl-Macho-Müller) über „die schönste Leiche der Saison“ bis hin zum verklemmten Mutter-Söhnchen auf dem Weg zum Mann. Jede Figur handelt, spricht und bewegt sich in Extremen, tut und sagt Dinge, über die der vernünftige Menschenverstand nur ungläubig den Kopf schütteln kann und hat natürlich ordentlich Dreck am Stecken. Jede der noch so kleinen Nebenfiguren ist ein Original, fast alle nehmen, um ihr Sein berechenbarer zu machen, Drogen, haben abgefahrene Kindheitsgeschichten oder lernen Latein um ihren Bildungskomplex zu lösen.
Gemein ist dagegen allen eines: die starke Tendenz zur Vereinzelung. Das Bewegen in den klar abgesteckten Grenzen der jeweiligen Figur, der Hang zum googeln, E-Mailen, Sms-en, statt des miteinander Sprechens. Gesellschaftskritik? Vielleicht. Auf jeden Fall nicht mit dem Holzhammer, keine Nebenfigur steht moralisch beleidigt im Hintergrund herum, zwischen keine Zeilen sind irgendwelche „tieferer Sinn“ Zwänge versteckt. Der Leser liest, Buschheuer liefert reflexive Unterhaltung.
Gleichzeitig merkt man der Sprache des Buches an, wie unerhört viel Spaß es Buschheuer gemacht haben muss, dieses Buch zu schreiben. Die Vergleiche und Metaphern sind unheimlich phantasievoll, die Bilder, die die Autorin herauf beschwört wollte man eigentlich nie vor Augen haben. Die neue schwarze, zwei Meter große, Tatort-Kommissarin Kuki Bobito, empfängt den frisch entjungferten (in mehrerer Hinsicht) Mei-kel in Schnell-Ficker-Hose. Der Reißverschluss führt vom Schritt, zwischen den Beinen hindurch, die Po-Ritze entlang hinauf, Kuki platzte auf wie eine überreife Kiwi.
Mit diesem Bild im Kopf können Sie nun getrost zum Buch greifen, es wird Sie nicht enttäuschen. Wer Sprachwitz, Sprachspiele und sehr viel Satire mag, sollte es mit diesem Roman versuchen, er ringt sich keine elementare Weisheit ab und will doch mehr, als bloß unterhalten.
„Es geht uns gold. Wir sind verlogen. Wir sind käuflich. Wir trennen den Müll. Wir wissen nicht, was Liebe ist. Wir haben unseren Platz in der Gesellschaft gefunden. Ganz oben.“
Sophie Sumburane
Else Buschheuer: Zungenküsse mit Hyänen. Aufbau Verlag, Berlin 2013. 352 Seiten. 19,99 Euro.











