 You are not a gadget
You are not a gadget
– Am Sonntag wird der diesjährige Friedenspreis des Deutschen Buchhandels verliehen. Jaron Lanier scheint prädestiniert für die Auszeichnung: der Internetpionier setzt sich seit Jahren für die Entlohnung von künstlerischer Kreativität unter digitalen Bedingungen ein. Aber Laniers Argumentation ist komplexer als ein Plädoyer für Urheberrecht und Buchpreisbindung. Von Kerstin Schoof
Jaron Lanier ist Informatiker und Musiker mit Faible für seltene akustische Instrumente, er arbeitet für Microsoft und lehrt an der University of California in Berkeley. Als Entwickler im Silicon Valley der 80er- und 90er-Jahre hat er den Begriff „Virtual Reality“ geprägt – und Technik-Utopien entworfen, die bis heute ihre Wirkung entfalten. Das Internet als unkommerzieller Raum, der ein Zeitalter der Fülle, der „Abundanz“ ermöglicht: diese Visionen prüft Lanier seit einigen Jahren auf ihre Realitätstauglichkeit und kommt zu ernüchternden Ergebnissen. Statt wachsenden allgemeinen Wohlstands habe die Umsonstkultur im Netz zum Verlust von Arbeitsplätzen, dem Abstieg der Mittelschichten und zu einem „Starsystem“ einiger weniger Erfolgsunternehmer geführt, die aufgrund riesiger Serverkomplexe und ihrer Rechenleistung von den Daten, die andere kostenlos zur Verfügung stellen, profitieren. Der beispielhafte Fall der Musikindustrie, die Krisen von Journalismus und Verlagen oder die Auseinandersetzungen um Vergütung und Nutzung digitaler Texte im Netz sind laut Lanier letztlich immer auch als eine Art Avantgarde für breitere soziale Entwicklungen zu verstehen.
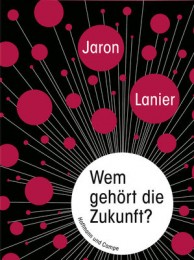 Die Möwe und das Meer
Die Möwe und das Meer
Mit dem sinkenden Wert von medialen, kulturellen oder unterhaltungselektronischen Produkten gingen Kostensteigerungen in Bereichen einher, die lange als grundlegende und günstig verfügbare Ressourcen galten, jedoch zunehmend an Selbstverständlichkeit verlieren: etwa der Zugang zu Trinkwasser, zu bezahlbarer Energie- und Gesundheitsversorgung. Dem Traum von einer intelligenten Umgebung aus Nanorobotern mit Schnittstellen zum globalen Netz, die die zukünftige Menschheit in jedem Augenblick schützen und versorgen, setzt Lanier ein etwas anderes Szenario entgegen.
Verdurstend am Meer bittet ein Mensch eine roboterähnliche Möwe um Hilfe, die antwortet: „Sie werden von unseren verschiedenen Sponsoren nicht als potenzieller Kunde eingestuft, daher kommen diese nicht für die Kosten Ihres Wassers auf.“ […] „Vor meiner Nase ist ein ganzer Ozean. Man muss einfach nur ein bisschen Wasser für mich entsalzen!“ „Die Lizenzen für die Meerwasserentsalzung sind an Trinkwasserfirmen vergeben. Sie müssen einen Vertrag unterschreiben. Sie können sich aber jeden beliebigen Film ansehen, der je gedreht wurde, […] während Sie verdursten. Ihr Status als verstorben wird automatisch in Ihren sozialen Netzwerken aktualisiert“ (Wem gehört die Zukunft?, S. 43-44).
Nicht zuletzt sieht Lanier den Preis für „freie“ Dienste wie Facebook im Ausmaß heutiger Überwachung, der Monopolisierung von Informationen und in der Mobkultur der Internetforen. „Kostenlos“ bedeutet für ihn unter diesen Bedingungen unweigerlich, dass „jemand anders darüber entscheidet, wie man leben soll“. Und die Errungenschaften des Web 2.0? Ein Unix-Nachfolger und eine Online-Enzyklopädie, so Lanier polemisch – von echter Innovation sei mehr zu erwarten.
Digitale Subjektivität
In seiner vorletzten Publikation „Gadget“ kritisierte Lanier bereits die reduktionistischen Definitionen dessen, was eine Person in digitalen Umgebungen sein kann, und weist auf die Einschränkung unserer Subjektivität, unserer Denk- und Handlungsweisen durch simplifizierende Software hin. Seine aktuelle Veröffentlichung „Wem gehört die Zukunft?“ fragt stärker nach den gesellschaftlichen Folgen, die die derzeitigen Tendenzen der digitalen Vernetzung nach sich ziehen. Lanier betrachtet diese aus einer Vielzahl wirtschaftlicher, psychologischer und historischer Perspektiven, die nicht immer systematisch entwickelt werden, aber eine Fülle an Ideen und Lösungsansätzen hervorbringen. Sein zentraler Vorschlag: Micro-Payments, die auch geringe, private Beiträge zur weltweiten Datensphäre entlohnen, da diese nichts weniger als die Grundlage für die Wertschöpfungsketten ganzer Industrien darstellten.
Laniers Ausführungen sind deshalb so erfrischend, weil er trotz aller Einwände gegen die vorherrschende digitale Kultur ein Technikenthusiast geblieben ist – und aufgrund jahrelanger Erfahrung in den unterschiedlichsten Institutionen der Netzkultur und Software-Industrie genau weiß, wovon er spricht. Die Pascalsche Wette kontert er mit einer Kirk‘schen Wette auf den Fortschritt: was Lanier vorschwebt, ist eine demokratische Gestaltung der technologischen Entwicklung, in der der Mensch sich nicht in Schwarm- oder Maschinenintelligenz auflöst, sondern mitsamt seiner individuellen Kreativität im Mittelpunkt steht (oder auf der Kommandobrücke sitzt). Und an dieser Stelle kann man nur zum Friedenspreis gratulieren!
Kerstin Schoof
Jaron Lanier: Wem gehört die Zukunft? Du bist nicht der Kunde der Internetkonzerne. Du bist ihr Produkt (Who owns the future?, 2013). Aus dem Amerikanischen Englisch von Dagmar Mallett und Heike Schlatterer. Hoffmann und Campe, Hamburg 2014. 479 Seiten. 24,95 Euro.
Jaron Lanier: Gadget – Warum die Zukunft uns noch braucht (You are not a gadget. A Manifesto, 2010). Aus dem Amerikanischen von Michael Bischoff. Suhrkamp, Berlin 2010. 247 Seiten. 9,99 Euro.
Zur Website des Friedenspreis des Deutschen Buchhandels. Foto: Wikimedia Commons, Quelle. Autor: vanz.











