 Ein anderes Wissen, ein anderes Licht
Ein anderes Wissen, ein anderes Licht
Im März gewann Georg Klein den Preis der Leipziger Buchmesse für seinen autobiographischen „Roman unserer Kindheit“. Nun folgt ein Band mit Erzählungen, die gewohnt virtuos in jene phantastischen Räume und Konstellationen entführen, die seine Leser schätzen. Von Gisela Trahms
Nach einer kosmischen Katastrophe haben sich ein Dutzend pensionierte Lehrer, der Erzähler und sieben Kinder auf die Spitze des Harzer Wurmbergs retten können, die als einsame Insel aus den Wasserfluten ragt. Die Kinder sind zu jung, um sich an die untergegangene Welt zu erinnern. Soll man ihnen überhaupt von einer Zivilisation berichten, die für immer verschwunden ist? Die Lehrerschar streitet. Eines Tages wird offenbar, dass die Kinder längst wissen und sich beschafft haben, was ihnen nützt. Sie ziehen davon, Aufbruch, Abenteuer, Kampf, Historie beginnen von neuem, wieder einmal, und zurück bleiben die Alten in einem schnaps- und rauchgeschwängerten Todeswartestand.
„Die Pferde der Kinder“ heißt die Auftakterzählung, in der bis zum Schluss die Rätselbröckchen glitzern. Statt lückenloser Erklärungen und penibler Kausalität bietet sie die lakonische Neufassung mythischer Muster (der überlistete Wächter, die Fahrt einer Kriegerschar übers Meer, diesmal unter weiblichem Kommando), deren klare Strukturen den Autor wohl umso mehr reizten, eine Handvoll Unauflösliches darunter zu mischen. So trägt diese Geschichte den Leser mühelos über die Seiten und lässt ihn Bilder schauen als blättre er in einer graphic novel, um ihn am Schluss, zu seiner eigenen Verblüffung, mit der Frage ‚Was zum Teufel habe ich übersehen?‘ zu entlassen.
Zukunft und Trümmer
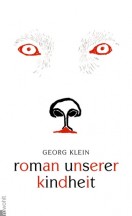 Während der „Roman unserer Kindheit“ das zeitlose Jetzt des kindlichen Blicks beschwört, schauen die meisten der achtzehn Erzählungen nach vorn und entwerfen ein nicht so fernes Irgendwann. In „Futur I“ und „Futur II“ sind sie gegliedert, eine offene Zukunft also und eine vollendete. Auf jeden Fall aber eine, die in der Gegenwart wurzelt, so dass ihre Welten gleichzeitig befremdlich und vertraut erscheinen. Farben und Bedrohungen schillern intensiver als in unserem Alltag. Aber einmal dem Läuten der Kleinschen Nachtglocke gefolgt, erliegt man bald den Reizen des Heftigen.
Während der „Roman unserer Kindheit“ das zeitlose Jetzt des kindlichen Blicks beschwört, schauen die meisten der achtzehn Erzählungen nach vorn und entwerfen ein nicht so fernes Irgendwann. In „Futur I“ und „Futur II“ sind sie gegliedert, eine offene Zukunft also und eine vollendete. Auf jeden Fall aber eine, die in der Gegenwart wurzelt, so dass ihre Welten gleichzeitig befremdlich und vertraut erscheinen. Farben und Bedrohungen schillern intensiver als in unserem Alltag. Aber einmal dem Läuten der Kleinschen Nachtglocke gefolgt, erliegt man bald den Reizen des Heftigen.
Komplexe Trümmer sind über die Szenarien verstreut, ähnlich den künstlichen Ruinen in romantischen Parks. „Beim letzten Märchen“ macht diese Konstellation selbst zum Thema. Joschka, Inhaber eines Abbruchunternehmens, dringt am Heiligen Abend in den Wald vor, wo seine Männer in den nächsten Tagen einen Märchen-Themenpark entsorgen sollen. Dessen letzte Figur ist eine junge Frau. Lebendig geworden und verführerisch blond wie die Loreley sitzt sie auf einem Felsen im Schnee, hochschwanger allerdings, und der von ihrer Schönheit überwältigte Joschka wird sie zu sich nehmen wie vor zweitausend Jahren ein anderer Joseph eine andere Schwangere, deren Kind uns noch immer irritiert. Als vorerst „letztes“ ist dieses besondere „Märchen“ wirkmächtig bis heute und immun gegen Bulldozer, genau wie die andere Lesart dieser Geschichte, eben die von der Macht des Eros.
Ein zarter Chip
Solche Mehrdeutigkeiten und listigen Intertextualitäten erzeugen ein System von Gruben und Gräben, in die man während der Lektüre unvermittelt einbricht. Welche Geschichte wird unter der Oberfläche erzählt? Ist sie die „eigentliche“ oder sollten wir uns mit der Oberfläche begnügen und vergnügen? Wie wird das Netz der Anspielungen fortgesponnen und weitergeknüpft, in dem wir auch realiter oft genug straucheln? Und das doch, bei genauerem Hinsehen, auch Komik und sogar Trost bereit hält. Der gutmütige Joschka, die trinkfreudigen Lehrer sind lächerlich, aber liebenswert. Was ihnen geschieht, überfordert sie. Der Protagonist der Titelgeschichte wird mit einem seltsamen Auftrag nach Nowosibirsk geschickt und am Ende zu fünfhundert Jahren Küchendienst verurteilt, die er willig auf sich nimmt. Ähnlich Mühler, dem Helden aus „Barbar Rosa“, überlässt er sich voller Vertrauen jenen unbekannten Mächten, die ihn auf die Spur setzten. Hinter den furchteinflößenden Labyrinthen Sibiriens scheint ein zarter Chip am Werk, der Fürsorge und Sinnandeutungen einspeist.
In der Mitte des Buches ruht dann die Perle, ein Text von knapp fünf Seiten mit dem Titel „Zwergenanekdote“: in einem Wiener Krankenhaus gerät der frisch operierte Sigmund Freud in eine lebensbedrohliche Situation. Vieles erinnert hier an Kleist: die suggestive Situierung, das Pathos der Nüchternheit, der mitreißende Aufbau, die sprachliche Meisterschaft. Nichts ist auf leere Effekte berechnet, alles auf effektive Konstruktion der Wahrheit. Es ist die Geschichte einer Rettung, und wenn es so etwas noch gäbe, könnte man behaupten: ein Stück zukünftiger Klassik. Vielleicht vermag es ja ihr helles Licht, auch auf die Wahrnehmung des Autors zurück zu strahlen.
Gisela Trahms
Georg Klein: Die Logik der Süße. Erzählungen. Reinbek: Rowohlt 2010. 238 Seiten. 18,95 Euro.
Zur Webseite von Georg Klein
Georg Klein im Interview Mit Gisela Trahms
Georg Klein im Porträt
Foto: © Bauer, 2009












