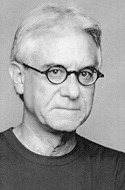Gutes Buch, falscher Titel
Gutes Buch, falscher Titel
– Greil Marcus ist zu Recht eine Ikone der internationalen Kulturkritik. Dieses Mal aber hat er sich wohl eine Themenverfehlung geleistet.Von Andreas Pittler.
Jeder, der irgendwann zwischen den frühen 70er und den späten 80er Jahren von Rock’n’Roll fasziniert war, stolperte früher oder später über den Namen Greil Marcus – und der Autor dieser Zeilen war wohl nicht der einzige, der ursprünglich glaubte, es handle sich dabei um einen abgefahrenen Deutschen, dem es Spaß mache, den Vornamen an den Familiennamen anzuhängen.
Marcus krachte Anfang der 80er Jahre mit „Mystery Train“ in jede WG, in der davon geträumt wurde, mit drei Akkorden und der Wahrheit die Bühne zu stürmen und der eigenen Freundin (so man eine hatte, ersatzweise derjenigen, in die man verliebt war), den eigenen Eltern, den Lehrern und, ach ja, der ganzen Welt (in dieser Reihenfolge wohlgemerkt) zu zeigen, was in einem steckte. Durch Marcus lernte man, dass selbst der ölige Fettsack, der einige Jahre zuvor abgenippelt war, einmal eine Revolution ausgelöst hatte, wodurch man erkannte, dass man doch „Love me tender“ hören durfte, ohne als Schmalzheini im Stile von Heino verunglimpft zu werden. Na, und Woody, Cisco und Leadbelly, die waren ja nicht erst seit Dylans ersten Schritten Säulenheilige, die einen dazu ermutigten, selbst die Wandergitarre aus alten Pfadfindertagen als ein cooles Instrument wahrzunehmen.
Zehn Jahre später waren Punk und New Wave tot, die eigene Gitarre verstaubte am Dachboden und die künstlerische Ausdrucksform beschränkte sich, wenn überhaupt, auf das Abfassen von Werbetexten in einer abgefuckten Agentur oder, wie im Falle des Verfassers dieser Zeilen, auf das Schreiben von Lokalnachrichten für eine popelige Provinzgazette. Den „Marcus Greil“ hatte man längst vergessen, doch just da rief er sich mit zwei weiteren bedeutenden Werken wieder nachhaltig in Erinnerung. „Lipstick Traces“ zog eine gerade Linie von den Dadaisten zu Beginn des (20.) Jahrhunderts bis zu den Punks am Ende desselben. Und bei der Lektüre von „Im faschistischen Badezimmer“ konnte man herrlich all seine Vorurteile bestätigt sehen und eine Erklärung finden, warum Johnny Rotten und Sid Vicious scheitern mussten – und wenn die schon gescheitert waren, dann brauchte man sich wegen des eigenen Versagens auch nicht mehr so wirklich schlecht zu fühlen.
Marcus wurde so endgültig ein allzeit geschätzter Begleiter der eigenen Befindlichkeit. Stets nett zu lesen, immer wieder ein – mehr oder weniger – amüsiertes Nicken evozierend und die eigene Sentimentalität auf eine angenehme Weise nährend. Man las die Bücher, die er so von Zeit zu Zeit auf den Markt warf, und fühlte sich dadurch ermuntert, wieder einmal „Van the Man“ aufzulegen oder sich die alten Folkniks reinzuziehen, und natürlich immer aufs Neue „Bob Almighty“ zu huldigen.
Closed Doors
Nun also die Doors. Marcus ist mittlerweile fast 70 und damit wohl nicht der einzige, der ein wenig peinlich wirkt, wenn er noch den Rock’n’Roll-Rebellen gibt (seien wir doch ehrlich – so etwas verzeiht man nur Keith Richards!). Und tatsächlich scheint es, als wäre er irgendwie von der Spur abgekommen. Waren die Querverbindungen, die er in früheren Werken herstellte, meist erhellend und aufschlussreich, so verliert er sich diesmal in Assoziationsketten, die außer ihm selbst wohl kaum jemand nachvollziehen kann. Man hat das Buch doch wegen Jim Morrison gekauft, wegen Densmore, Manzarek und Krieger, weil man eintauchen will in diese einzigartige Atmosphäre im Kalifornien der späten 60er Jahre, doch Marcus schwadroniert über das Amerika von heute, über die Clintons, über Republikaner versus Demokraten und über eine ganze Menge an US-Interna, bei denen man sich permanent fragt, was der smarte Jim von 1967 damit zu tun hat.
Und während man noch nach der Antwort auf diese Frage nachgrübelt, bombardiert Marcus seine Leserschaft mit Namen wie Jim Jarmusch, Andy Warhol, Joseph Heller, Raymond Chandler, Marianne Faithfull, hin und her hüpfend über Zeiten hinweg und die Ereignisse vieler Jahre in ein literarisches Stundenglas stopfend. Mehr und mehr ist man irritiert von dem gewaltigen Auftürmen diversester Namen und Begebenheiten – selbst, wenn man zufällig von ihnen wissen sollte –, denn man kann sich nicht länger des Eindrucks erwehren, hier prahle jemand mit seinem Wissen, um herauszustreichen, dass der wahre Held des Buches nicht Jim Morrison sondern Greil Marcus ist.
Dabei hat Marcus zum Glück aber nicht sein Talent verloren, gut zu erzählen. Und wenn man seine Eitelkeit ignoriert und sich von der Idee verabschiedet, das Buch handle von den Doors, dann kann man sich dem Text doch wieder mit einigem Gewinn nähern. Denn gibt man sich den Gefühlen hin, die Marcus empfindet, wenn er sich, ausgehend von einem Doors-Song in seine 60er Jahre zurückbeamt, dann stellt man, durchaus mit einem Schmunzeln, fest, dass auch eine Themenverfehlung ganz gut geschrieben und recht unterhaltsam sein kann.
Andres Pittler
Greil Marcus: The Doors (The Doors: A Lifetime of Listening to Five Mean Years, 2011). Deutsch von Fritz Schneider. Köln: Kiepenheuer & Witsch. 2013. 258 Seiten. 9,99 Euro. Verlagsinformationen zum Buch.