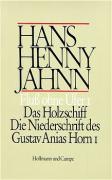 Schatten der Sehnsucht
Schatten der Sehnsucht
So ist Jahnns Leben und Schreiben letztlich ein großes „Trotzdem“ eingewirkt, das den Oszillationen des tragischen Natur- und Menschenschauspiels widersteht und dem oftmals konstatierten „Es ist wie es ist. Und es ist fürchterlich“ das unerschrockene „Bis zum letzten wollen wir uns aber widersetzen“ zur Seite stellt. „Ich war ein Schatten der Sehnsucht. Ein Sterbender, der noch auf Genesung hofft. Ein Gelangweilter, der in den Abgrund der ausgebrannten Hölle starrt.“
Wie ein schroffes, unzugängliches Felsengebirge steht Hans Henny Jahnns „Fluss ohne Ufer“ in der deutschen Literaturlandschaft. Voller Argwohn und vorsichtig tastend nähert man sich seinen abweisenden Ausläufern – um plötzlich hinein in eine Welt voller morbider Blüten, leuchtender Kristalle und schwarzer Abgründe gerissen zu werden. Nach der fiebernden Lektüre von über 2000 Seiten wird man nicht mehr derselbe sein wie zuvor: Zu tief hat man das „unauslotbare Hirn“ mit seinen monströsen Ängsten und Begierden, mit seinen verzweifelten Einsamkeiten und Sehnsüchten durchpflügt.
Hans Henny Jahnn blieb zeit seines Lebens der „Neger der deutschen Literatur“, dessen „literarischer Quantensprung“ nur von wenigen Feinschmeckern bemerkt wurde – so vom Literaturrebell Rolf Dieter Brinkmann, für den Hans Henny Jahnn „ein radikaler großer deutscher Dichter“ und dessen „Fluss ohne Ufer“ unvergleichlich war: „Ein erschreckendes Buch, kenne niemanden, der einen Leser so durch das Grauen des Gehirn führt.“ Das Monumentalwerk „Fluss ohne Ufer“ ist ein dreigeteilter Romanzyklus, der zwischen 1934 und 1946 in der dänischen Emigration entstand. Unvermittelt, wie „aus dem Nebel gekommen“, setzt der erste Teil – „Das Holzschiff“ – ein und führt den Leser auf hohe See und tief in den labyrinthisch-geheimnisvollen Bauch des Schoners: „Nahe der Spantenkonstruktion entdeckten wir ein Loch im Fußboden. Eine Stiege führte tiefer. Wir benutzten sie. Ein Raum nahm uns auf, der dem darüberliegenden glich. […] Eine Ahnung zog uns nach dem entgegengesetzten Ende des Ganges. Wir fanden dort wieder ein Loch im Boden, eine Stiege darunter, die, zwar schräger als die erste, ins Tiefere leitete. Wir kletterten nochmals abwärts.“ Den mysteriösen und kafkaesken Ereignissen auf dem „Holzschiff“ schließt sich die „Niederschrift des Gustav Anias Horn“ – eine durchaus mit Proust zu vergleichende „Recherche“ nach einer längst verlorenen Wirklichkeit. Die „Niederschrift“ ist das existentielle Projekt einer erinnernden Vergegenwärtigung des eigenen Lebens, welches in einer übermächtigen äußeren Realität zu verschwinden droht; sie stemmt sich gegen „das Aufgefressenwerden unserer Existenz durch Produktionsprozesse“: „Ich muß die Erinnerung wollen. Sie ist mein Maß. Ich darf nicht der Mensch sein, der nach vierundzwanzig Stunden vergißt. Ich will versuchen, mich zu entsinnen. Ich muß eine ganze Antwort geben. Eine ganze Antwort? – Sie wird irgendwo abbrechen. Sie wird zehntausend Lücken haben. Es gibt keine vollkommene Rückkehr des Ablaufs. Kein Traum ist groß genug, kein Hirn genau. Überall schließen sich die Türen. […] Ich erkenne meine Verzweiflung; aber ich schreibe doch.“ Mit der „Niederschrift“ widersetzt sich Jahnn vehement einer entfremdeten Welt, die im Zuge von Fortschrittsgläubigkeit und rationaler Aufklärung scheinbar alle Geheimnsnisse verloren hat und mit Diktaturen und Weltkriegen nurmehr bestialische Blüten treibt. Je tiefer wir die „Wirklichkeit und die Gleichzeitigkeit des vielgestaltigen Geschehens“ begreifen möchten, desto mehr scheint sie uns aus den Händen zu gleiten und einer gespenstischen Leere Platz zu machen. Mit Leonardi da Vinci warnt Jahnn: „Die Erkenntnis, die nicht durch die Sinne gegangen ist, kann keine andere Wahrheit erzeugen als die schädliche.“ Daher muß es nun (wieder) heißen: „mit allen Sinnen aufnehmen und unerschrocken, nur auf sich selbst gestellt, dem Vermittelten standhalten – wie teuer die Verantwortung auch zu stehen komme.“ Und so versucht Gustav Anias Horn mit allen Konsequenzen einen sinnlich-synthetischen Zugang zur Welt zu finden. Er möchte die „Freundschaft mit den Sternen wieder aufnehmen wie als Kind“ und dabei sein „eigenes Dasein wie eine feierliche Tatsache“ verspüren. Er sehnt sich nach einer neuen Unmittelbarkeit, welche die seit frühester Kindheit beigebrachten Sinnesverstümmelungen rückgängig macht und die gesellschaftlich normierten Bewußtseinsstrukturen mit ihrem abstrakten Wirklichkeitsbegriff auflöst. Die Wirklichkeit, „um die es Jahnn geht – die vermißt und gesucht wird und sich entzieht – , ist verknüpft mit dem Sensorium, mit der Wahrnehmungsfähigkeit, den der Außenwelt zugewandten Sinnesorganen und der eigenen Offenheit von Psyche und Körper.“
So zeigt Jahnn im „Fluss ohne Ufer“ eine innere und äußere Wirklichkeit, die durch eine ungeheure Sinnlichkeit und Wahrnehmungsintensität ausgezeichnet ist. Er führt durch seine „Gedanken, die Rosse, die schnell an allen Orten sind und ihre Hufe nicht in die Zeit setzen, sondern in das Moos der Träume.“ Er führt mit seinen unvergleichlichen, archaisch-mythischen Naturbeschreibungen durch gleißende Luftozeane und ferne Landschaften, durch die „ein eisiger Wind aus dem östlichen Raum streicht“: „Er hat den ersten Schnee hungrig aufgeleckt. Der Boden liegt wieder nackt da. Die gläserne Kälte verwandelt die Kruste der Erde. Ätzender Staub klirrt über die Äcker. Die kahlen Laubbäume schaukeln steif und leise klappernd.“
Doch trotz aller Bemühungen kann es in diesen Zeiten nicht mehr gelingen, sich alleine über die Sinne einer Wirklichkeit zu versichern, die durch eine unfaßbare Gleichzeitigkeit des Geschehens und eine diskursive Zersplitterung gekennzeichnet ist. Für diese Wirklichkeit gibt es keine Versicherung mehr, sie ist „ein einziges Entsetzen, ohne Sinn, ohne Moral.“ Konsequent lebte Jahnn mit dem unauflösbaren Widerspruch zwischen seiner poetisch-archaischen Utopie und einer technisch-industriellen Wirklichkeit, der nicht zu entrinnen ist. Standhaft hält er an „der Idee eines Rechtes fest, an seine Trümmer, an einen Rest, den ich mein Privatleben nenne, meine private Zärtlichkeit, meine private Faulheit, meine private Verzweiflung, an meinem privaten Fluss ohne Ufer.“
So ist Jahnns Leben und Schreiben letztlich ein großes „Trotzdem“ eingewirkt, das den Oszillationen des tragischen Natur- und Menschenschauspiels widersteht und dem oftmals konstatierten „Es ist wie es ist. Und es ist fürchterlich“„ das unerschrockene Bis zum letzten wollen wir uns aber widersetzen“ zur Seite stellt.
Karsten Herrmann
Hanns Henny Jahnn: Fluss ohne Ufer. Achtbändige Jubiläumsausgabe von Hoffmannn und Campe bei 2001 für 48 DM. Oder als dreibändige Taschenbuchausgabe bei Suhrkamp für 98 DM ISBN 3-518-39642-0











