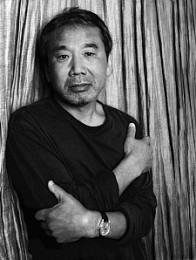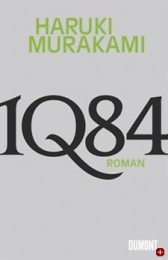 Unterwelt, Parallelwelt, Scheinwelt
Unterwelt, Parallelwelt, Scheinwelt
– Haruki Murakami ,62, wirbelt in seinem 1000 Seiten starken Roman „1Q84“ durch ein buntes Panoptikum, in dem gleich zwei Monde leuchten, eine Auftragskillerin ihren Job mit einem Eispick erledigt, mysteriöse „Little People“ herumwuseln und nebenher noch eine 17-jährige Schreiberin zum Bestseller-Star hochgepusht wird. Will er mit Fantasy-Mummenschanz, introvertierter Nabelschau, Krimi-Action und Sekten-Kritik seinen Millionen Lesern ein Bonsai-Potpourri aus Chandler, Kafka, Dostojewski und Thomas Pynchon präsentieren? Von Peter Münder.
Murakamis Helden zog es ja immer schon nach unten, in Unterwelten und Traumwelten, in denen es sich nach Herzenslust fantasieren lässt und man der schnöden Langweiler-Bürowelt lässig Adieu sagen kann. Im amüsanten und spannenden „Mister Aufziehvogel“ (1999) kroch der Rossini-Liebhaber Toru Okada auf der Suche nach seinem verlorenen Kater in einen stillgelegten Brunnen, traf dort unten ungewöhnliche Typen und gab sich in seiner Traumwelt seinen erotischen Fantasien hin. In „Hard-Boiled-Wonderland und das Ende der Welt“ steigt ein 35-jähriger anonymer Datenschützer mit im Gehirn implantierter Black Box in die düstere Tokioter Tunnelwelt, um im Datenkrieg zwischen dem staatlichen Syndikat und kriminellen Hackern ein unterirdisches Geheimlabor aufzustöbern: Hier ist die Unterwelt allerdings eine Art Vorhölle mit unheimlichen Schwärzlingen und wabernden Blutegeln, die gierig das Kloaken-Abwasser saufen. Im Kontext der terroristischen Aum-Giftgasattacken vom März 1995 gesehen, über die Murakami ja in einem großen Reportage-und Interview-Band ausführlich berichtete („Untergrundkrieg“, 1997), wirkt dieses Miniatur-Horror-Szenario allerdings wie eine harmlose Science-Fiction-Persiflage. In der Kurzgeschichte „Frosch rettet Tokio“ (im Erzählband „Nach dem Beben“, 2003) will Frosch die Stadt vom wütenden mächtigen Wurm erlösen, der in der Unterwelt randaliert, ein Erdbeben auslösen und die Stadt zerstören will. Also steigt Frosch mit dem unscheinbaren, aber kampfentschlossenen Bankangestellten Katagari nach unten, um im heldenhaften Kampf dieses Inferno zu verhindern. Bemerkenswert am riesigen Frosch ist seine Eloquenz und Belesenheit: Er kennt sich sowohl bei Joseph Conrad als auch bei Tolstoi und Dostojewski bestens aus, zitiert sogar Nietzsche und kann mit dieser Bildungshuberei den zögernden Katagari zur Teilnahme an dieser riskanten Terminator-Mission überreden.
Das ist natürlich Murakami pur: Finsterste Unterwelt, sprechende Tiere mit einem Faible für europäische Klassiker – alles präsentiert in einer naiv-märchenhaft anmutenden Erzähltechnik. Neben dem mitunter doch recht exotischen Ambiente und den Figuren mit Hang zum spintisierenden Irrationalen ist eben auch immer eine kräftige Prise Hokuspokus dabei, die zum metaphysischen Tiefsinn hochgepeppt wird. Selten gerierte sich die vermeintliche Suche nach dem Hegel‘schen Weltgeist, die dann noch nur geklonten literarischen Pop-Manierismus ergibt, so verschwurbelt und manieriert. Thomas Pynchon lässt grüßen: Nicht nur dessen Hang zum Untergrund, zu alternativen Kommunikationssystemen („The Crying of Lot 49“) hat auf Murakami abgefärbt, auch dessen esoterisch-versponnene Darstellung sprechender Kugelblitze oder eloquenter Hunde (in Pynchons „Against The Day“) ist ganz nach seinem Gusto, weil er an eine „andere Realität“ glaubt. Ist nicht alles Fake, was uns umgibt, fragte er etwa im legendären „Paris Review“-Interview von 2002: Ähnelt die Realität nicht einer hübschen Filmkulisse, in der Möbel, Wände, Bücherregale, einfach alles aus Papier ist und uns den schönen Schein vorgaukelt? Andererseits hatte der Kafka-Preisträger und langjährige Nobelpreiskandidat Murakami sich nach dem Fukushima-Desaster auch als Kritiker der japanischen Energiepolitik profiliert und ein energisches Umdenken der japanischen Politkaste gefordert. Wer wollte dem widersprechen?
Offenbar hat sich Murakami zwischen zwei Welten ganz gut eingerichtet: Die real existierende, von Korruptionsskandalen, Giftgas-Attacken und Atomreaktor-GAU heimgesucht, kann er mit kritischen Kommentaren und Reportagen begleiten und halbwegs rational analysieren, während er sich mit einem Mix aus kafkaesk-surrealistischen Szenarios und Fantasy-Staffagen in eine subterrane Nebenwelt flüchtet, um damit offenbar die Sehnsucht einer globalen Lesergemeinde nach eskapistischen Harry-Potter-Mummenschanz angesichts einer immer komplexeren und undurchschaubarer werdenden Welt zu stillen. Murakamis Figuren fliegen nicht auf dem Harry-Potter-Besen über die Ginza, sie tauchen einfach ab in dunkle Tunnel, stillgelegte Brunnen und Notleitern, die zu einer von zwei Monden gut beleuchteten Parallelwelt mit eigenen Gesetzen führen. Über diesen spiritistischen Tischchenrücken-Quark, der an UFOs und grüne Marsmännchen erinnert, sind viele Kritiker hoch entzückt: So kann man abendfüllend sehr engagiert über die Blutegel schwadronieren, die etwa in „Kafka am Strand“ vom Himmel fallen, über die Omnipotenz von Figuren spekulieren, die durch Wände gehen, über die Signifikanz von erogenen Ohrläppchen schwärmen, die ja in „Wilde Schafsjagd“ so relevant zu sein scheint. Hübsch ist ja auch die in „Hard-Boiled-Wonderland“ präsentierte Spekulation, ob die Welt wirklich eine völlig andere wäre, wenn die Erde so flach wäre wie ein Teetisch. Oder war es eine Tatami-Matte? Der Frage „Was wäre wenn“ weicht Murakami jedenfalls nie aus, sie ist sozusagen der Treibsatz, mit dem er sein Ideensystem zündet, Plot, Ambiente, Dialoge in Gang hält und die Geschichten seiner „Nantonaku“-Romane irgendwie (das bedeutet nantonaku) über die Runden bringt.

Das hundertprozentige Mädchen
Und nebenher thematisiert er noch die Einsamkeit der Single-Generation, die Zerrüttung der traditionellen Familienstrukturen (alle Romanfiguren leiden unter kaputten, unklaren Familienverhältnissen), die düsteren Aspekte des materialistisch orientierten Rat-Race und die Suche der Königskinder, die zueinander nicht kommen konnten: „Wie ich eines schönen Morgens im April das 100%ige Mädchen sah“ ist auch so ein typisches Murakami-Leitmotiv: In bester Kafka-Tradition kommt das Traumpaar erst mal nicht zusammen, weil introvertiertes Grübeln angesagt ist: Wie spreche ich das 100%ige Mädchen an? Was wird sie von mir halten? Wird sie mich auslachen? Und dann ist der richtige Zeitpunkt verpasst, das Mädchen entschwunden und fortan trauert man dem perfekten Partner nach. Wie der hochtalentierte Mathe-Lehrer und Hobby-Schreiber Tengo in „1Q84“, der sich nach Aomame verzehrt, die er als 10-jähriger Schüler vor dem Mobbing seiner Mitschüler bewahrte: Sie drückte ihm damals vor zwanzig Jahren voller Dankbarkeit kräftig die Hand und diesen Händedruck spürt Tengo heute noch. Auch Aomame , die eigentliche Heldin in „1Q84“, sehnt sich nach dem ebenso cleveren wie gutmütigen Tengo. Sie ist inzwischen Fitness-Trainerin und als barmherzige Auftragskillerin unterwegs, die Mädchenschänder liquidiert und Männer umbringt, die ihre Frauen besonders brutal misshandelt haben – eine Art Rubina Hood unserer Tage. Aber zweifellos die vielschichtigste und faszinierendste Figur des Romans.
„1Q84“ wurde mit riesigem Hype in einer gigantischen Millionen-Auflage (in Japan wurden eine Million Exemplare in zwei Wochen verkauft) in inzwischen drei handlichen Teilen (für Tokios U-Bahnleser sind dicke Bücher zu unhandlich) veröffentlicht. Wenn im gelungenen Romananfang die wie eine seriöse Business-Woman wirkende Aomame in der Tokioter Rush Hour mit ihrem Taxi in einen Stau gerät und riskiert, ihren dringenden Termin zu verpassen, dann ahnt der Murakami-Kenner schon, was nun passieren wird: Irgendwie wird sie einen Dreh finden, in die Unterwelt abzutauchen, obwohl sie dort nicht mehr die faszinierende Janacek-„Sinfonietta“ genießen kann, die sie im Taxi Dank einer besonders anspruchsvollen Hightech-Stereo-Anlage so intensiv genießen konnte. Kurzentschlossen steigt Aomame dann auch über eine Notleiter von der Stadtautobahn nach unten hinab, um sich einen kürzeren Weg zu ihrem Termin im Hotel zu suchen. Die Auftragskillerin muss dort nämlich einen Mord mit ihrem selbst konstruierten handlichen Eispick erledigen und bekommt vom cleveren Taxifahrer noch mit auf den Weg: „Die Dinge sind meist nicht das, was sie zu sein scheinen.“ Allerdings, schon gar nicht beim spiritistisch angehauchten Rätselfreund Murakami! Bei ihrem Abstieg ist die Killerin mit dem Eispick im griffigen Hartschalen-Etui aber in eine andere Welt gelangt, in der es zwei Monde – einen großen gelben und einen kleinen grünen – sowie andere pfiffige Besonderheiten gibt: Dies ist nun die Parallelwelt von 1984, die Murakami einfach „1Q84“ nennt.
Und was bedeutet nun das Q im Titel von „1Q84“? Spötter spekulierten schon darüber, ob hier etwa ein IQ von 84 (von wem auch immer) gemeint sei … Dabei soll das Q (japanisch kyu = neun) nur eine Anspielung auf George Orwells 1984 sein, weil die Vorreiter-Sekte mit ihren Little People an einen Big-Brother-Oberkontrolleur samt Gedankenpolizei mit zwangsverordnetem Newspeak-Jargon vage an Orwell erinnert. Die Handlung spielt allerdings im Jahr 1984 in Tokio und Chiba.
Blue Moon, Two Moons, True Moons?
Mir wurde es dann allerdings doch zu bunt, als Aomame am Ende von „1Q84“ zwar Tengo nach 20-jähriger Durststrecke versunken in die Betrachtung der beiden Monde erspäht, ihn dann aber doch verpasst. Außerdem versucht sie noch, mit den beiden Monden ins Gespräch zu kommen und stellt enttäuscht fest, dass diese den Dialog verweigern. Oder als die 60 Zentimeter großen geheimnisvollen „Little People“ (wie bei „Schneewittchen und die sieben Zwerge“ sind es sieben an der Zahl) der „Vorreiter“-Sekte aus dem Maul einer Ziege steigen und von ihrer Mission berichten, zu der eine Mother, eine Daughter, ein Perceiver, Receiver usw. gehören und mit dem auserwählten Führer alles irgendwie anders werden soll. „Die Puppe aus Luft“, von den Little People gesponnen, heißt zwar der preisgekrönte Besteller-Roman, den Tengo als Ghostwriter der 17-jährigen Fukaeri verfasste. Aber der zur Rahmenerzählung ausgewalzte Puppen-Plot mit den zwergenhaften Männlein wird hier mit so viel heißer Luft zusammengesponnen, dass wir dieses märchenhafte Sektiererkomplott nie so recht ernst nehmen können. Da Murakami alles mit allem verbindet und auch an „Alice in Wonderland“ anspielt, die ja im geheimnisvollen Kosmos eines Kaninchentunnels verschwand, ergibt sich der Eindruck, Murakami möchte sie alle übertrumpfen: Lewis Carroll, Raymond Chandler (den hat er ja ins Japanische übersetzt), Tolstoi, Dostojewski und natürlich auch Kafka, dessen „Schloß“ er schon als Teenager begeistert verschlang.
Die Realitätsfrage: Ein weites, mysteriöses Feld
Vielleicht hat Murakami ja selbst als Folge der aufreibenden Realitätsdebatte einen gravierenden Realitätsverlust erlitten und trotz Aomames spannender Killer-Episoden kein Gespür mehr für seinen überzogenen Spiritisten-Humbug? Auch seinen mit reichlich Hokuspokus angereicherten, um Ödipus-Fluch, sprechende Katzen und krause Mysterien kreisenden missglückten Roman „Kafka am Strand“ (2004) hielt er für seinen besten. Sicher will er mit literarischen Mitteln eruieren, was alles schiefgelaufen ist in der japanischen Gesellschaft: Wie konnte es zu diesen korrupten, mafiösen Strukturen in der Politkaste kommen? Zum exzessiven Materialismus, zur Auflösung traditioneller Werte? Leider kann man sich als Leser auf so eine kritisch-analytische Bestandsaufnahme aber nicht einlassen, weil der Manga-mäßige Budenzauber in „1Q94“ meistens davon ablenkt und man den Eindruck hat, Harry Potter habe schon den Besen geholt für seinen nächsten Ausritt ins Murakami-Fantasyland, auf den er uns unbedingt mitnehmen möchte. Sorry, aber ohne mich.
Peter Münder
Haruki Murakami: 1Q84. Aus dem Japanischen von Ursula Gräfe. Du Mont Verlag 2010. 1021 Seiten. 32 Euro.
John Wray: The Paris Review Interview – The Art of Fiction No. 182/2002.
Jay Rubin: Haruki Murakami and the music of words. London: Harvill Press 2002. 326 Seiten. 12,99 Pfund.