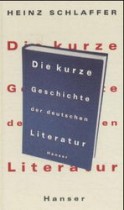 Kurze Blüte- und lange Schlafzeiten
Kurze Blüte- und lange Schlafzeiten
Deutsche Literaturgeschichten sind in der Regel von Heerscharen spezialisierter Wissenschaftler verfasst und umfassen locker mehrere tausend Seiten. Wie kann sich da nun ein gestandener Professor aus Stuttgart anmaßen, eine solche auf 150 Seiten abzuhandeln – ist das Frechheit, purer Übermut oder grandiose Ignoranz? Es ist nichts von alldem, sondern vielmehr der überzeugende Versuch, den durch die Germanistik sorgsam aufgebauten und gehüteten Mythos einer fruchtbaren und langen deutschen Literaturtradition die Luft abzulassen.
So beginnt die deutsche Literatur bei Schlaffer eigentlich erst in der Mitte des 18. Jahrhunderts – bis dahin registriert er nur eine „Serie verlorener Anfänge“ und ein verspätetes Epigonentum, das europäischen Maßstäben nicht gerecht wird: „Was vor 1750 in deutscher Sprache geschrieben wurde [… ] ist nahezu ausschließlich durch die Disziplin der Germanistik aufgespürt, veröffentlicht und kommentiert worden.“
Als Keimzelle der „unverhofften Verwandlung“ in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts markiert Schlaffer den Protestantismus und Calvinismus, dessen Sprech- und Schreibweisen von der akademischen Jugend in poetische Haltungen transformiert werden – vom „Hain“ in Göttingen über das romantische Gestirn um Novalis und Schlegel in Jena bis zum Tübinger Triumvirat Hölderlin, Hegel und Schelling. Sie überführen die Religion in die Kunst, dringen tief in den später von Rilke so benannten „Weltinnenraum“ vor und begründen dermaßen die Romantik. In diesem Kontext rückt Schlaffer auch den weit verbreiteten Irrtum einer von Goethe und Schiller geprägten deutschen Klassikepoche zurecht – diese sei lediglich eine „nicht gute aber erfolgreiche Erfindung“ der Germanistik des 19. Jahrhunderts.
In eben diesem 19. Jahrhundert, in dem in Frankreich und England die Moderne mit Vehemenz anbricht, sieht Schlaffer die deutscher Literatur erneut – Ausnahmen wie Büchner bestätigen die Regel – in einen epigonalen Dornröschenschlaf versinken. Erst mit Hofmansthal, Rilke, Kafka und Thomas Mann fände sie dann wieder internationalen Anschluss – die Heilsversprechen der Literatur der ersten Blütezeit wichen bei diesen „Parteigängern eines ästhetischen Konservatismus“ jedoch dem Ausdruck des wehmütigen Abschieds und des Untergangs (des Abendlandes).
Kaum ist die deutsche Literatur wieder auf der Höhe der Zeit, da ist es aus Schlaffers Perspektive auch schon wieder mit ihr vorbei: Die nationalsozialistische Machtergreifung sorgt für den „Niedergang der modernen deutschen Literatur und ihr geschwächtes Fortleben nach 1945“ – moralisch gehemmt und weitestgehend auf die „Freiheit des poetischen Zynismus verzichtend“ dümpele sie in das neue Jahrtausend.
Heinz Schlaffers essayistische Literaturgeschichte bietet eine pointierte und prägnante Lektüre. Sein ausgeprägter Mut zur Lücke provoziert natürlich Widerspruch und könnte zum fruchtbaren Ausgangspunkt einer längst überfälligen Debatte über die deutsche Literatur-Tradition mit ihren Brüchen, Gipfeln und Niederungen werden. So oder so bleibt dem Leser, wie Schlaffer abschließend anmerkt, nun zumindest aber die Zeit, „sich wieder der deutschen Literatur zuzuwenden“.
Karsten Herrmann
Heinz Schlaffer: Die kurze Geschichte der deutschen Literatur. Hanser, 156 S., 14,90 Euro.











