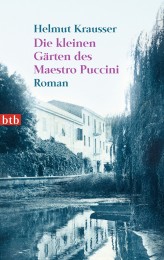 Libretto und Libido
Libretto und Libido
– Helmut Kraussers grandiose romanhafte Puccini-Biografie. Wiedergelesen von Peter Münder zum 87. Todestag des Komponisten am 29. November.
Er habe ja Verständnis „für die kleinen Gärten und Geheimnisse, für die gewissen Nischen in der Mauer, in der aparte Halbschattengewächse zu Hause sind und blühen dürfen“, erklärt der erregte Musikverleger Guilio Ricordi seinem besten Pferd im Stall, dem berühmten Komponisten Giacomo Puccini (1858–1924). Aber des Maestros Affäre mit einer 17-jährigen Näherin, „diesem niedrigen Fräulein“ Corinna, über die sich alle das Maul zerreißen, sei einfach nicht länger tolerierbar: „Die begeisterten jungen Damen möchten intim signiert werden? Schön. Sollen sie. Aber diese Proletin! Das geht nicht.“
Dieser Protest konnte den Erotomanen Puccini überhaupt nicht beeindrucken. Der Frauenschwarm ließ nichts anbrennen und prahlte sogar mit einem sieben Mal erzielten Orgasmus – in einer Nacht. Die kleinen Gärten und gewissen Nischen des weltberühmten Schöpfers von „Manon Lescaut“, „La Boheme“, „Tosca“ und „Madame Butterfly“ boten wahrlich Platz für Dutzende von mehr oder weniger „aparten Nachtschattengewächsen“. Und weshalb sollte der Meister diese so lustvoll auf dem Altar der Kunst dargebotenen Opfer ablehnen? „Jede Frau, mit der ich schlief, endete als Melodie in mir. Jede“, hatte Puccini schließlich behauptet.
In seinem Dokumentarroman, den Helmut Krausser („Eros“, „Der große Bagarozy“) im Puccini-Jahr 2008 zum 150. Geburtstag des Komponisten vorlegte, bewegt er sich souverän zwischen den Problemzonen einer permanent köchelnden, übersteigerten Libido und den triumphalen Erfolgen sowie grotesken künstlerischen und privaten Skandalen dieses Künstlers. Puccini hatte ja einen Hang zum Vulgär-Obszönen („Die Möse ist der einzige Trost der schmachtenden Menscheit“); am wohlsten fühlte er sich im abgelegenen Torra del Lago im Kreis seiner simpel gestrickten, trinkfreudigen Kumpane vom Club „La Boheme“, wo nicht jedes Wort auf die Goldwaage gelegt wurde. Die lauten Zecher irritierten ihn keineswegs, wenn er sich dann spät in der Nacht zum Komponieren ans Klavier setzte.
Erhellender Einblick in verklemmte Epoche
Mit geradezu obsessivem Erkenntnisinteresse geht Helmut Krausser Puccinis Eskapaden und amourösen Abenteuern nach, die auch reichlich Stoff für melodramatische opernhafte Szenarien bieten würden. Er verzichtet auf einen ausführlichen chronologischen Lebenslauf und konzentriert sich stattdessen auf markante, prägende Ereignisse wie den schweren Autounfall von 1903, den Selbstmord der Hausangestellten Doria Manfredi, die Begegnung und intensive Freundschaft mit der Engländerin Sybil Seligman und auf die skurrilen und deprimierenden Intrigen und Eifersüchteleien der Lebensgefährtin und erst spät zur Ehefrau avancierten Elvira Gemignani. Da er aus Briefen und Unterlagen zitiert, die Hintergründe von Beziehungs- und Schaffenskrisen, künstlerische Erfolge und Skandale packend beschreibt sowie die privaten Marotten des passionierten Autoliebhabers einfühlsam vor dem Leser entfaltet, ergibt sich ein liebevoll entwickeltes Psychogramm, das einen erhellenden Einblick in diese turbulente, aber eben auch unsagbar verklemmte Epoche bietet.
Mit souveräner Eleganz beleuchtet Krausser nebenher noch die Intrigen an der Mailänder Scala, die Usancen von Claqueuren, die sich Jubelschreie oder vernichtendes Protestgeheul bezahlen ließen. Verblüffend aktuell muten übrigens ebenso der beschriebene Konkurrenzdruck unter Komponisten wie das Gebaren im Musikverlagswesen an, wo man zwar Libretti in Auftrag gab, aber dann keine Aufführung realisierte, nur weil man anderen Interessenten den Stoff wegnehmen wollte – daran hat sich ja bis heute nicht viel geändert.
Seinen Recherche-Eifer hat Krausser jedoch übertrieben, wenn er noch akribisch Zensuren und Beurteilungen auflistet, die sich auf Puccinis lernresistenten Sohn Tonio beziehen. Der hatte sich am Technikum Mittweida bei Dresden mit einem Studium abgequält, das er dann vorzeitig abbrach. Für den Plot sind diese Details eher belanglos. Aber sei‘s drum – dem enorm vielseitigen Dramatiker, Lyriker, Hörspielautor und Romancier Helmut Krausser ist mit seinem Puccini-Roman ein äußerst spannendes, unterhaltsames Werk gelungen.
Peter Münder
Helmut Krausser: Die kleinen Gärten des Maestro Puccini. München: Du Mont Verlag 2008. 381 Seiten. 19,90 Euro. Vgl. auch: Karsten Herrmann über Kraussers Roman „Die letzten schönen Tage“.












