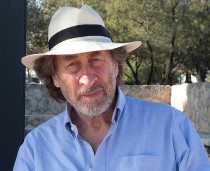Der eingebildete Jude
Der eingebildete Jude
– Es gibt sie noch, die Autoren, die über Jahre hinweg ihre Stimme finden und schließlich die verdiente Anerkennung finden: So geschehen im Falle Howard Jacobsons, dessen Roman „Die Finkler-Frage“ („The Finkler Question“) 2010 mit dem Man Booker Prize ausgezeichnet wurde. Erst mit der späten Würdigung durch die Booker-Jury bekommt nun auch eine deutschsprachige Leserschaft die Gelegenheit, Jacobson kennenzulernen – zunächst mit der „Finkler-Frage“, schließlich, wenn man der Ankündigung der DVA glauben darf, auch mit den früheren Romanen, die nach und nach übersetzt werden sollen. Von Joe Paul Kroll
Howard Jacobson, Jahrgang 1942, veröffentlichte 1983 seinen ersten Roman und wurde seitdem mit zunehmender Häufigkeit als einer der am sträflichsten vernachlässigten Autoren Großbritanniens gehandelt. Und tatsächlich wäre spätestens „Kalooki Nights“ (2006) so ziemlich jeden Preises würdig gewesen: Der Roman zeugt von der großen Kunst, noch der tiefsten Trauer Komik abzugewinnen, und dies nicht durch Verkleinerung der Figuren und ihrer Schicksale, sondern vielmehr durch ihre Vergrößerung – und durch einen Stil, dessen hohe Präzision stets die Abkürzung ins Gekünstelte vermeidet und der die Lebendigkeit von Jacobsons Charakteren vermittelt.
Es war vielleicht die Schilderung eines pubertierenden jüdischen Onanisten in „The Mighty Walzer“ (1999), der Vergleiche mit Philip Roth nahelegte. Neben dieser oberflächlichen Ähnlichkeit zwischen den Protagonisten Oliver Walzer und Alexander Portnoy beziehen solche Vergleiche ihre Substanz vor allem aus dem Milieu, das Jacobson hier und anderswo schilderte: Das jüdische Kleinbürgertum Manchesters in der Nachkriegszeit, eine Welt die, wie Roths Newark, von Deindustrialisierung und Abwanderung längst dahingerafft worden ist. Jacobson konterte den Vergleich mit der verschmitzten Bemerkung, er würde lieber als „die jüdische Jane Austen“ gelten. Dieser Anspruch ist weniger Absurd, als es zunächst erscheinen mag: Denn Jacobson sucht seine Vorbilder im klassischen englischen Roman des 19. Jahrhunderts, und er nimmt Anteil am Schicksal seiner Protagonisten, wie ihm auch das Vergnügen an deren Ausgestaltung anzumerken ist.
An dieser Hinwendung fehlt es in seinem jüngsten, im London der Gegenwart spielenden Roman zwar keineswegs, doch sie ist auf den ersten Blick womöglich etwas schwieriger auszumachen. Hatte Jacobson schon zuvor Fragen des jüdischen Selbstverständnisses und des Gedenkens behandelt, so mag „Die Finkler-Frage“ auf den ersten Blick ganz explizit als Thesenroman erscheinen, dessen Figuren mit Identität und Politik hadern.
Ein werdender Philosemit
Jacobsons Geniestreich ist es, die Probleme des Antisemitismus und des Antizionismus, die ständige Bedrohtheit des Judentums also, aus der Perspektive eines werdenden Philosemiten zu schildern, am Beispiel eines Goj, der sich schließlich einbildet, selbst Jude zu sein. Julian Treslove ist ein Mann ohne Eigenschaften, der sich als „Double von niemand bestimmtem“ verdingt. (Wenn dies zunächst wie eine Erfindung Wilhelm Genazinos klingen sollte, so ist Jacobsons Charakterzeichnung nicht nur komischer, sondern schlicht überzeugender.) Tresloves alter Schulfreund Sam Finkler, der es als Fernsehphilosoph (geschildert als eine Art Mischung aus Alain de Botton und Rüdiger Safranski) zu Ruhm gebracht hat, gilt ihm als Inbegriff des Juden, die er folglich alle als „Finkler“ bezeichnet. Beide sind um die 50 und befreundet mit dem eine Generation älteren Libor Sevcik. Treslove kommen die Frauen irgendwie abhanden, die beiden anderen sind Witwer: „Seither hatten Trauerfälle die Unterschiede in Alter und Karriere verwischt und ihre Zuneigung füreinander wieder entfacht.“
Für Treslove ist die Trauer eher eine Art selbstgewählte Lebenseinstellung, für ihn „gehörte die Melancholie unabdingbar zur Sehnsucht dazu“. Dieses Sehnen ist einerseits erotischer Natur. Treslove wird verfolgt von der Prophezeihung, er werde eines Tages einer „Juno“ begegnen. Andererseits fasziniert ihn das „Finklertum“ seiner beiden Freunde, wobei Sam klar erkennt: „Du weißt nämlich nicht, was du bist, und deshalb willst Du Jude sein.“ Seine „Jewno“ macht Treslove schließlich in einer leibhaftigen Jüdin aus, in deren Gestalt sich sein erotisches mit seinem spirituellen Sehnen verknüpft.
Unterdessen weiß auch Finkler nicht so Recht, was er sein will. Während Libor in den Dreierrunden Israel stets als Ärgernis für alle Antisemiten verteidigt, geht jener, der vom Vatermord träumt, mit seiner Scham ob der israelischen Politik hausieren. Als Gesicht einer Gruppe semiprominenter „Schandejiddn“ (später „ASCHandjiddn“, im Original „ASHamed Jews“) unterschreibt er Appelle und ruft zu Boykotten auf. Er „protzt [so Libor] mit seiner Scham vor einer gojischen Welt, die an weit besseres zu denken hat.“
Treslove ist dieses Verhalten rätselhaft. „Wie so oft fragte er sich, ob er je begreifen würde, was Finkler über sich sagen durften, Nicht-Finkler aber nicht.“ Wenn der Antisemitismus „das Gerücht über die Juden“ ist (so Adorno), dann ist für Treslove das Judentum selbst eine Art Gerücht und auch der Antisemitismus eine merkwürdig hermetische Angelegenheit, die nur Juden richtig verstehen.
Das ändert sich in dem Augenblick, da Treslove selbst sich als Opfer eines antisemitischen Anschlags vermeint. Eines Abends auf dem Nachhauseweg gerät er sozusagen in einen Hinterhalt des Schicksals, indem ihn eine Frau überfällt, die ihm seiner Wertsachen, einschließlich des hier unschwer zu deutenden Füllfederhalters, beraubt und ihm zu Abschied Worte mitgibt, die in Tresloves Ohren klingen wie „Du Jud!“.* Auf diesem Missverständnis baut Treslove schließlich einen Identitätsersatz auf, was seine Freunde bald mit Belustigung, bald mit Unverständnis zur Kenntnis nehmen.
Mehrdimensionale und bunt gestaltete Protagonisten
Natürlich sind jüdische Identität, Antisemitismus und Antizionismus dem selbsterklärten „liberalen Zionisten“ Jacobson drängende Probleme. Doch ein Missverständnis wäre auch, die „Finkler-Frage“ als einziges Thema des gleichnamigen Romans zu begreifen. Es geht um Liebe und Trauer, beide am schönsten geschildert in Libors zärtlichem Gedenken an seine verstorbene Frau Malkie. Es geht um Eitelkeit, Neid und Eifersucht, um die Schwierigkeiten der Vaterschaft, und was Identität mit Erotik zu tun hat. Es geht um Ernst und Absurdität des Lebens, um Freundschaft und Distanz. Und, was bei der Schilderung all dessen zu kurz gekommen ist: Jacobson ist wirklich sehr komisch, zumeist subtil, aber immer mit dem Gespür für Abgründe und Untiefen seiner Figuren.
Jacobson liebt seine Protagonisten, die für manchen Romancier eher ein Ärgernis sind. Er liebt sie, indem er sie mit Sympathie begleitet, aber vor allem, indem er sie prall und bunt gestaltet wie weiland sein großes Vorbild Dickens. Und diese Kunst bewahrt seine Figuren noch in diesem problembefrachteten Roman davor, zu Chiffren zu werden. Mit Ausnahme einiger Nebengestalten sind es keine Strohpuppen, die nur eine These untermauern, die Geschichte am Laufen halten sollen. Und selbst über eine so beiläufig erwähnte Gestalt wie den „Schandjiddn“ Poliakov, der unter Qualen seine Beschneidung rückgängig zu machen versucht, erfährt man in wenigen Zeilen soviel, dass man hinter seinem bizarren und leicht als Karikatur missverständlichen Verhalten doch eine tiefere psychologische Zerrissenheit erahnt. Diese Mehrdimensionalität, sei sie nur in wenigen Strichen, durch einen Nuance, angedeutet erhebt „Die Finkler-Frage“ weit über den gemeinen Thesenroman. Nicht nur deshalb darf man dankbar sein, dass dem fabelhaften Erzähler Jacobson endlich die verdiente Anerkennung zuteil wird.
Joe Paul Kroll
*) Hier muss nun doch auf die Schwierigkeit eingegangen werden, die Wortspiele zu übersetzen, um die es in den Schlüsselszenen des Buches geht: „D’jew know Jewno?“ ist die alles bestimmende Frage, die sowohl Treslove als seine rätselhafte Juno mit dem Judentum identifiziert. Bernhard Robben enthält den deutschsprachigen Lesern das Original nicht vor, übersetzt aber im Weiteren als „Kennt Jud einen Juden nich?“. Ebenso verfährt er, wo der schwerhörige Libor „bans“ und „bands“ nicht unterscheiden kann. Das ist zwar nicht das kunstfertigste aller denkbaren Verfahren, aber in der Annahme intelligenter Leser und der Treue der Ausgangssprache gegenüber völlig legitim.Howard Jacobson: Die Finkler-Frage. Roman. Aus dem Englischen von Bernhard Robben. Deutsche Verlags-Anstalt 2011. 448 Seiten. 22,99 Euro.