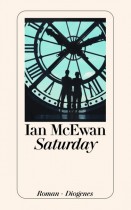 Kollabierende Ungewissheit
Kollabierende Ungewissheit
„Und wenn die erste Explosion London erschüttert…“ – kein Prophet, sondern wohl nur ein kritischer Realist musste Ian McEwan sein, um die Terroranschläge von London literarisch vorherzusagen.
Der im Jahr 2003 bevorstehende Irakkrieg und seine unabsehbaren Folgen bilden die Folie seines neuen Romans „Saturday“. In London versammeln sich am 15. Februar zwei Millionen Menschen zu einer Friedensdemonstration. Derweil fährt der Neurochirurg Henry Perowne mit seinem silbernen Mercedes S 500 zum Squash-Spiel mit einem Kollegen. Auf der Fahrt kommt es zu einer schicksalhaften Kollision mit dem Schläger und Kleinkriminellen Baxter, die ihm „wie ein gehaltener Klavierton im Kopf“ bleibt. Dramatisch-symbolisch soll diese Begegnung schließlich zeigen, „wie sich die Folgen einer Tat der Kontrolle entziehen“.
Erinnernd, reflektierend, räsonierend
Ian McEwan erzählt auf knapp 400 Seiten einen einzigen Tag aus der Perspektive seines Protagonisten. Erinnernd, reflektierend und räsonierend betrachtet dieser die Welt um sich herum und entfaltet dabei einen geradezu enzyklopädischen Horizont: Er führt nicht nur tief hinein in die faszinierende Welt der Hirnforschung, lässt sich kenntnisreich über Musik, Literatur und moderne Kunst aus, sondern wägt auch die bedrohliche Lage der Welt und das moralische Für und Wider eines Irak-Krieges ab. Und hier geht es dem disziplinierten und verantwortungsvollen Henry Perowne letztlich wie seinem Autoren Ian McEwan, der sich in dieser Frage tief zerrissen zeigt: „The hawks have my head, the doves my heart.“
Fluchtpunkt Familie
Als Gegenpol zu den krisenhaften Weltereignissen und dem drohenden Schatten des Terrors steht in „Saturday“ die Familie von Henry Perowne, die an diesem 15. Februar endlich wieder einmal im Haus am Londoner Fitzroy Square zusammen treffen soll: die erfolgreiche und treu geliebte Ehefrau Rosalind, die Kinder Theo (ein vielversprechender Bluesmusiker) und die in Paris lebende Daisy (eine vielversprechende Lyrikerin) sowie der Schwiegervater John Grammaticus (ein erfolgreicher Lyriker). Doch schließlich bricht auch in diese geschützte Welt von Henry Perowne der Terror ein und zeigt seine hässliche Fratze – mit überraschenden Folgen.
Aus dem Mikrokosmos eines einzigen Tages im Leben seines Protagonisten lässt Ian McEwan in „Saturday“ eine ganze Welt erstehen, in der es kein richtig oder falsch mehr ergibt, sondern letztlich nur noch eine kollabierende Unwissenheit, die in Fatalismus umzuschlagen droht: „Wie das Ergebnis auch ausfällt, es ist vorprogrammiert.“
Am Zahn der Zeit
Nachdem Ian McEwan in seinem Meisterwerk „Abbitte“ atmosphärisch dicht und dramatisch in eine vergangene Zeit eingetaucht war, stellt er sich in „Saturday“ nun einer höchst widersprüchlichen, bedrängenden und bedrohlichen Gegenwart. Dafür und für seine Fähigkeit, „in Zeiten der Krise an und für die Nation zu sprechen“ wurde der einst als literarisches Schmuddelkind gestartete Autor vom englischen Wochenmagazin „New Statesman“ jüngst zum „national novelist“ geadelt.
Vom literarischen Standpunkt aus gesehen offenbart „Saturday“ allerdings einige Schwächen. So bleiben Plot und psychologischer Spannungsaufbau etwas behäbig und der Protagonist erscheint mitsamt seiner Familie trotz aller selbstkritischen Zweifel etwas zu perfekt, tolerant und erfolgreich. Letztlich erweist sich McEwan in seinem neuen Roman eher als ein kritisch reflektierender Essayist, denn als mitreißender Romancier.
Karsten Herrmann
Ian McEwan: Saturday. Aus dem Englischen von Bernhard Robben. Diogenes 2005. Gebunden, 387 S., 19,90 Euro.











