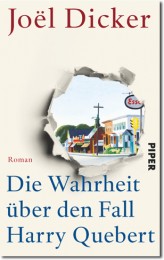 Die Faszination des schlechten Bestsellers
Die Faszination des schlechten Bestsellers
– Ein Buch steht auf Bestsellerlisten und gewinnt Preise. Dabei gehört es zu den ärgerlichsten Veröffentlichungen des Jahres. Wie das nur sein kann, fragt sich Anne Schüßler.
Ich lese selten schlechte Bücher. Oder anders gesagt: Ich lese selten Bücher, die ich schlecht finde. Das mag zum einen daran liegen, dass ich grundsätzlich vor allem erwarte, dass ich über eine Spanne von 300 bis 800 Seiten ausreichend unterhalten werde, und solange ein Buch das irgendwie schafft, auch geneigt bin, das okay zu finden. Zum anderen vielleicht auch, weil ich mittlerweile ein ganz gutes Gefühl dafür habe, was mir gefallen könnte und was nicht. Möglicherweise habe ich auch ein bisschen Glück bei der Wahl meiner Lektüre.
Diesem Umstand ist es vermutlich zu verdanken, dass ich, wenn ich dann mal ein schlechtes Buch lese, so fasziniert von dieser Tatsache bin, dass ich dann auch tatsächlich zu Ende bringe, was ich angefangen habe. Selbst wenn, wie im Fall von Joël Dickers “Die Wahrheit über den Fall Harry Quebert” das Buch über 700 Seiten hat oder – in diesem speziellen Fall – als Hörbuch über 20 Stunden geht.
Eine vielversprechende Mischung
Tatsächlich hatte ich anfangs noch Hoffnung. Die Rahmenbedingungen stimmten, alles passte so gut. Der Protagonist, ein erfolgreicher Jungschriftsteller aus New York City namens Marcus Goldman, wird in eine Mordgeschichte verwickelt, in dem sein langjähriger Professor, Mentor und Freund Harry Quebert als Hauptverdächtiger verhaftet wird. Das Mordopfer, die junge Nola, hatte eine Affäre mit dem damals 34-jährigen Quebert und verschwand mit 15 Jahren spurlos. Jetzt wird sie im Garten von Quebert in dem kleinen Ort Aurora in New Hampshire gefunden, zusammen mit dem Manuskript seines Bestsellers “Der Ursprung des Übels”. Die Beweislage scheint eindeutig, Harry wird verhaftet und Marcus beginnt, auf eigene Faust zu ermitteln.
Ein bisschen Whodunnit-Mystery, ein bisschen Ostküstencharme, eine Liebesgeschichte, eine Männerfreundschaft, ein bisschen Universitätskram und ein paar Seitenhiebe auf die Buchbranche. Das klingt erstmal gar nicht so schlecht. Und es wäre vielleicht auch gar nicht so schlecht geworden, wenn es jemand anders geschrieben hätte.
Man weiß auch gar nicht, wo man mit der Kritik anfangen soll, denn es stimmt eigentlich fast gar nichts in diesem Buch und man fragt sich die ganze Zeit nur, wie das so durchgehen konnte. Saßen da keine Lektoren? Und wenn doch, was haben die die ganze Zeit gemacht? Warum hat sich niemand über die grottigen Dialoge auf ZDF-Schmonzetten-Niveau beklagt? Warum hat niemand angemerkt, wie vollkommen unglaubwürdig und albern diese angeblich größte Liebesgeschichte der Welt, nämlich die der 15-jährigen Nola und dem 34-jährigen Harry Quebert daherkommt? Wieso hat niemand eingegriffen und die gefühlt dreihundert Seiten des Buches, die ohnehin nur aus Wiederholungen längst bekannter Fakten bestehen, rausgestrichen? Was um Himmels Willen ist da schief gelaufen, dass dieses Buch so gedruckt, herausgegeben, ins Deutsche übersetzt und dann in Deutschland herausgebracht wurde? Und die größte Frage von allen: Warum in Gottes Namen hat dieses Buch Preise gewonnen?
Seelenlos, blutleer und albern
Es bleibt ein Rätsel. Die Figuren in Dickers Roman sind größtenteils seelenlose Konzeptcharaktere, denen zwar auf dem Papier die tollsten Eigenschaften überhaupt zugeschrieben werden, was sich aber weder in ihren Worten noch in ihren Handlungen widerspiegelt. Die Dialoge sind ein einziges Drama. Ich habe zu Unterhaltungszwecken ein paar notiert, schon allein, weil ich es nicht geschafft hätte, dieses Buch durchzustehen, wenn ich meine Verwunderung nicht regelmäßig auf Facebook hätte kundtun können. Eine Unterhaltung zwischen Marcus und Harry endet beispielsweise so:
„Marcus?“
„Ja, Harry?“
„Wenn ich einen Sohn hätte…“
„Ich weiß, Harry. Ich weiß.“
Dialoge zwischen Harry und Nola folgen einem ähnlichen Prinzip:
„Kommen in Ihrem Buch auch Möwen vor, Harry?“
„Wenn du das möchtest. Ich schreibe alles in dieses Buch, was du willst.“
Oder aber Nola sagt so etwas:
„Glauben Sie an Gott, Harry? Wenn Sie an Gott glauben, glaube ich auch an Gott.“
Wenn Harry Quebert am Anfang des Buches erzählt, dass Nola seine Manuskripte gelesen und ihm ihre Meinung dazu gesagt hätte, dann meint er übrigens nicht, wie ich zunächst irrigerweise glaubte, dass wir es hier mit einer intelligenten, eigenständig denkenden Person zu tun hätten, die auch mal Kritik formulieren könnte. Wie sich später rausstellt, sieht die Meinung seiner allerliebsten Nola eher so aus:
„Mein Allerliebster, ich antworte sofort, nachdem ich Ihren Brief gelesen habe. Offen gestanden habe ich ihn zehn, vielleicht sogar hundert Mal gelesen. Wie schön Sie schreiben! Jedes Ihrer Worte ist wie ein Wunder! Sie haben so viel Talent!“
Seitenweise reden sich bei Dicker die Figuren alle Nase lang mit Namen oder Berufsbezeichnung an, fast, als würde man es dem Leser nicht zutrauen, ohne Hilfsmittel einem Dialog zu folgen. Gespräche zwischen Harry und Nola können auch leider nicht ohne die mehrmalige Verwendung der Worte “Oh, Harry, allerliebster Harry!” auskommen. Es ist schon faszinierend, wie die Beziehung dieser beiden Figuren, die über 700 Seiten quasi ausschließlich von Liebe schwafeln, so seelenlos bleibt, wie es kaum möglich ist. Schlimmer noch, dass selbst der gealterte Harry mit ausreichendem Zeitabstand und einem zumindest theoretisch möglichen Lebenserfahrungsgewinn immer noch einem Mädchen hinterhertrauert, das so komplett ohne jeglichen Charakter daherkommt und mit dem er anscheinend noch nicht mal Sex hat.
Zu viel gewollt, zu wenig gekonnt
Wo die Liebesgeschichte grandios an ihren eigenen Superlativen scheitert, sieht es bei dem Rest des Buches nicht besser aus. Dickers Buch ist eine wilde Mischung aus der intellektuellen Ostküstenromantik eines J.D. Salingers, der menschlichen Verstrickungen und Abgründe von Twin Peaks und eines versuchten, in diesem Fall jedoch fehlgeschlagenen Porträts des Amerikas der 1970er Jahre, wie es Stephen King zuletzt in “Der Anschlag” so schön mit den 1950er Jahren glückte. Ein bisschen Branchensatire dazu, fertig. Dicker will alles, aber er schafft leider nichts davon. Sämtliche Figuren handeln unmotiviert bis unlogisch, da, wo das Buch romantisch sein soll, wirkt es bestenfalls egal, schlimmstenfalls albern und da, wo es witzig sein soll, wird es schlicht ärgerlich. Würde man ihm übel wollen, müsste man eine latente Homophobie unterstellen, ich vermute jedoch schlicht eine gewisse Verklemmtheit des Autors, die es ihm auch unmöglich macht, bei den rar gesäten Sexszenen im Buch die Dinge oder vielmehr die primären Geschlechtsorgane beim Namen zu nennen, oder wie jemand bei Facebook kommentierte: “Hihi, er hat nicht Penis gesagt.” (Statt dessen erlebte ich zum ersten Mal, wie ich einem Autor im Geiste Penissynonyme zurief, weil ich dieses Herumgetänzel schlichtweg nicht mehr ertragen konnte.)
Übrig bleibt eine Geschichte, die noch nicht mal so schlecht ist. Die Wendungen sind okay bis trickreich, die Auflösung kann man so akzeptieren. Auf den letzten zwei Stunden des Hörbuchs wird man noch mal ordentlich in die Geschichte hineingezogen, sagt ein paar Mal “Oh!” und “Huch!”, wundert sich dann aber am Ende doch wieder, warum noch nicht mal die großen Enthüllungen, also die, die den Kern der Geschichte erschüttern müssten und alles auf den Kopf stellen sollten, den Elfenbeinturm der Geschichte von Harry und Nola ebensowenig ins Wanken bringen wie fast alle anderen Storykonstruktionen. Jede noch so große Wendung bleibt letztendlich bedeutungslos und banal und verpufft nach ihrem initialen Schockmoment ins Nichts.
Hilfestellungen für den besonders vergesslichen Leser
Als Leser fühlte ich mich irgendwann vom Autor schlichtweg verarscht. Die ewigen Wiederholungen von Fakten, die man als normal intelligenter Mensch spätestens beim dritten Mal kapiert hat, was soll das? Ja, Nola ist 15 und Harry 34! Kapiert. Ja, Harry hat sein ganzes Geld für die Miete des Hauses aufgeopfert! Ebenfalls kapiert! Ja, Harry hat ein ganz wunderbares Buch geschrieben und das nur für Nola! Alles klar! Ja, Marcus muss das Buch in sieben Wochen fertig schreiben, weil dann nämlich irgendwann Präsidentschaftswahl ist und sich dann keiner mehr für den Fall Harry Quebert interessiert! Ich hab es schon beim ersten Mal verstanden, aber gut, dass man es mir zehn Mal auf die Nase bindet.
Für wie tumb, muss man sich fragen, hält Joël Dicker seine Leser? Mal abgesehen davon, dass es fast immer eine schlechte Idee ist, ein Buch über geniale Autoren zu schreiben, und dann noch aus den fiktiven Meisterwerken dieser Autoren zu zitieren. Das kann nicht gut gehen, aber Dicker versucht es trotzdem und es geht natürlich nicht gut. Wie sollte es auch? Statt dessen müssen wir Leser einfach glauben, dass alles, was Marcus Goldman und Harry Quebert zu Papier bringen entweder “wundervoll”, “wunderschön”, “genial” oder “fantastisch” ist, denn andere Adjektive sind im Zusammenhang mit ihren Büchern schlicht nicht zulässig. Zu allem Überfluss ist Dicker so verliebt in sein Buch, dass es einfach nicht aufhört und sich ein Epilogkapitel ans nächste reiht, bis ich irgendwann aufhörte zu zählen.
Vielleicht hat Joël Dicker den Ausdruck “die Macht der Worte” schlicht missverstanden. Die Macht der Worte ist nämlich nicht, dem Leser durch permanente Wiederholung unmissverständlich zu Verstehen zu geben, was man von den Figuren und Beziehungen im Buch zu halten haben sollte. Es ist im Gegenteil die Fähigkeit, die Figuren durch das, was sie tun und sagen, so zum Leben zu erwecken, dass ich es merke, ohne, dass man es mir sagen muss.
„Dein Glück ist mein Geschenk, Nola“, sagt der 34-jährige Harry Quebert zu der 15-jährigen Nola und man möchte ein bisschen mit dem Kopf auf die Tischplatte fallen. Warum ich mir das antun würde, fragten mich Menschen im Internet. Eine berechtigte Frage, antwortete ich, aber das Buch sei ein bisschen wie ein sehr, sehr langer Autounfall, bei dem man einfach nicht weggucken kann.
So bleibt es dabei: “Die Wahrheit über den Fall Harry Quebert” ist eine Geschichte, die eigentlich gar nicht so schlecht wäre. Wenn sie jemand anders geschrieben hätte.
Anne Schüßler
Joël Dicker: Die Wahrheit über den Fall Harry Quebert (La Vérité sur l’affaire Harry Quebert, 2012), Roman. Deutsch von Carina von Enzenberg. München: Piper Verlag 2013, 736 Seiten, 22,99 Euro. Verlagsinformationen zum Buch. Zum Blog von Anne Schüßler.











