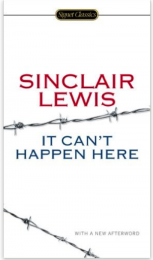 „Minute Men“ statt SA
„Minute Men“ statt SA
– Wie realistisch ist das von Lewis beschriebene Szenario einer faschistoiden US-Diktatur? Peter Münder macht den Klassiker-Check.
Mit seinen Bestsellern „Main Street“ und „Babbitt“ wurde Sinclair Lewis (1885–1951), der erste amerikanische Literatur-Nobelpreisträger (1930), weltberühmt. Er kaprizierte sich aber nicht nur auf die kritisch-satirische Charakterisierung einer selbstzufriedenen, engstirnigen Middle Class, sondern nahm auch Phänomene wie geldgierige, promiskuitive Erweckungsprediger („Elmer Gantry“) oder Mediziner eines inkompetenten, korrupten Gesundheitssystems („Arrowsmith“) ins Visier. Im Roman „It can’t happen here“ (1935) beschrieb Lewis die Karriere eines faschistoiden US-Politikers sowie den Aufbau von Strukturen, die denen der Nazis ähnelten, was das Undenkbare zur Realität werden ließ: eine US-Diktatur mit einem größenwahnsinnigen Schaumschläger an der Spitze, schlagkräftigen Kohorten, die sich nach den Milizen des Befreiungskrieges „Minute Men“ nennen: Sie wollen auch innerhalb einer Minute einsatzbereit sein. Abweichler werden im KZ weggesperrt oder einfach umgebracht. Angesichts der surrealistischen Success-Story des demagogischen Immobilien-Tycoons Donald Trump zum Präsidentschaftskandidaten wirkt diese kritische Dystopie beklemmend aktuell. Zeit für die Wiederentdeckung eines großen, enorm vielseitigen, aber auch sehr umstrittenen Autors.
Doremus Jessup ist der Inbegriff des liberalen Ostküsten-Intellektuellen: Als Chefredakteur und Herausgeber des „Daily Informer“ hat er im betulichen Fort Beulah, Vermont, schon viele Krisen und Stürme im Wasserglas erlebt. Trotz einer zunehmenden Polarisierung und Radikalisierung der Bevölkerung nach der Wirtschaftskrise glaubt er eigentlich nicht, dass der Demagoge mit der großen Klappe, Senator Berzelius Windrip, der den Leuten Milch, Honig und ein festes, vom Staat garantiertes 5000-Dollar-Einkommen verspricht, bei den bevorstehenden Wahlen eine realistische Chance auf das Präsidentenamt hat. Und dann gehen die Leute dem Rattenfänger doch auf den Leim.
Wir schreiben das Jahr 1937: Ermächtigungsgesetze, staatliche Eingriffe in das Wirtschaftssystem im Stil von Hitler und Mussolini, aber auch Moskauer Verstaatlichungsmethoden sind in dieser kritischen wirtschaftlichen Phase auch angesichts der vielen Arbeiterstreiks und Unruhen für viele Amerikaner denkbare Alternativen. Und angesichts der chaotischen Verhältnisse sehnen sich immer mehr Wähler nach einem Charismatiker, der mit starker Hand für Ordnung sorgt – Weimar lässt grüßen. Andererseits halten die meisten – besonders im beschaulichen Vermont – eine von extremistischen Gruppierungen installierte Regierung für undenkbar: „It can’t happen here“, lautet ihre Überzeugung. Genau diese naive Anschauung wollte Sinclair Lewis in seinem 1935 veröffentlichten Roman kritisch unter die Lupe nehmen: Natürlich kann es hier bei uns genauso passieren wie in Deutschland und Italien, war seine warnende Message, die sein düsteres Zukunftsszenario einer faschistoiden US-Diktatur als prophylaktische Fiktion und als Warnsignal antizipierte.
Hinweise auf die Möglichkeit einer solchen Entwicklung hatte der rechtsradikale Senator aus Louisiana, der Ku-Klux-Klan-affine Huey Long (1893–1935) geliefert, während Lewis fieberhaft vom Mai bis August 1935 an diesem Roman schrieb. Long hatte ein korruptes paternalistisches System entwickelt, das ihn als Landesvater praktisch unantastbar und die Landesregierung von seinem Einfluss total abhängig machte. Die Öl-Giganten und Staatsmonopole wollte er entmachten, jedem Amerikaner im Rahmen seines mit großem Aufwand propagierten „Share the Wealth“-Programms ein Grundeinkommen sichern, Infrastruktur und Bildungssysteme verbessern usw. – Doch dem Hyper-Populisten Long ging es nur um seine eigene Bereicherung, in Wirklichkeit kollaborierte er mit den großen Konzernen und kassierte von ihnen seine Anteile. Er wollte für die Präsidentenwahl kandidieren, wurde aber im September 1935 von einem Attentäter umgebracht.
 „America First“: Great Again mit Zero Hour!
„America First“: Great Again mit Zero Hour!
Die rhetorischen Versatzstücke, mit denen Demagogen wie Long, die Romanfigur Windrip und nun auch Donald Trump operieren, kreisen vor allem um die „Größe“ der USA, um die Abgrenzung von bedrohlichen oder „minderwertigen“ Systemen wie Mexiko und um militärische Stärke. Lewis blendet solche Propagandapassagen aus Windrips Buch „Zero Hour“ zu jedem Kapitelbeginn ein, was einen wirkungsvollen Kontrast von Sprechblasen-Größenwahn und trister Realität ergibt. Vor dem Hintergrund errichteter KZs, massiver Einschüchterung, praktizierter „Schutzhaft“, Drangsalierung und brutaler Willkür der Minute Men, der Zerschlagung von Universitäten und Verlagen, nach Bücherverbrennungen – darunter auch Jessups 34-bändige Dickens-Ausgabe (Lewis besaß auch so eine Ausgabe) und nach der Absetzung des „Informer“-Chefredakteurs, der nun als Propaganda-Assistent für die neuen faschistischen Corpos arbeiten muss, ist es schon krass, dann mit solchen Zitaten des Diktators Windslip konfrontiert zu werden, die genauso gut von Donald Trump stammen könnten:
„My one ambition is to get all Americans to realize that they are, and must continue to be, the greatest Race on the face of this old Earth, and second, to realize that whatever apparent differences there may be among us, in wealth, knowledge, skill, ancestry or strength- though, of course, all this does not apply to people who are racially different from us- we are all brothers, bound together in the great and wonderful bond of National Unity.“
Auch ein Krieg gegen Mexiko (allerdings ohne Mauerbau!) gehört zum „Make America Great Again“-Konzept, das die Frauen wieder als Heimchen am Herd ideal positioniert sieht. Jessup muss sich mit seinem angepassten, ambitionierten Juristensohn in unerträgliche Streitgespräche über die neuen Machthaber einlassen, weil der Filius unbedingt Karriere als juristischer Beisitzer der MM-Schlägertruppen machen will. Als sein Schwager von den Minute Men umgebracht wird, grübelt Jessup über eigene Fehler nach, er fragt sich, wie er diese Entwicklung hätte verhindern oder aufhalten können. Und geht es in diesem Konflikt wirklich nur um überschaubare Frontkämpfe zwischen Faschisten und Bolschewiken? Ist das Hauptproblem nicht die vorherrschende Heuchelei, die von allen Lagern praktiziert wird? Dieser verlogene Widerspruch von hehren Versprechungen und tatsächlich praktizierten Grausamkeiten ist für Jessup das eigentliche Grundübel. Nicht Big Business oder skrupellose Demagogen seien für die tyrannische Diktatur verantwortlich, räsoniert Jessup, sondern all die indifferenten, selbstzufriedenen Jessups, die wie er selbst, nicht rechtzeitig vehement gegen diese Demagogen vorgegangen seien. Daher entschließt er sich zum radikalen, lebensgefährlichen Schritt, für die kommunistische Untergrundgruppe „New Underground“ Flugblätter zu verteilen, auf denen die Gräueltaten der faschistoiden Corpos enthüllt werden.
Diese selbstkritischen Zweifel des liberalen Redakteurs, die ideologischen Risse, die aus dem harmonischen Familiengefüge einen brisanten Konfliktherd machen, die unterschiedlichen Lebensbedingungen von Stadt und Land, all das hat Sinclair Lewis in ein grandioses Gesellschaftspanorama eingebunden, das auf einfache Wahrheiten verzichtet. Wenn Kritiker ihm vorwerfen, keinen klaren parteilichen Standpunkt einzunehmen – was sein Biograf Mark Schorer auch tut – dann haben sie nicht verstanden, dass er zwar immer eine liberal-demokratische Haltung einnahm, aber nie das Sprachrohr für Agitprop-Grüppchen spielen wollte: „Ich bin Diagnostiker, aber kein Reformer“, hatte der Zola aus der Prairie immer betont.
Die differenzierte Erzählperspektive sorgt neben den realistischen Figuren dafür, dass der fünf Jahre nach der Nobelpreisverleihung (danach soll es ja laut Schorer mit der Kreativität des Romanciers rapide abwärts gegangen sein! – was für ein Bullshit!) geschriebene Roman einer der spannendsten und besten von Lewis geworden ist. „It can’t happen“ wurde mit über 300 000 verkauften Exemplaren schnell zum Bestseller, MGM erwarb die Filmrechte, wollte den Film aber trotz eines gelungenen Drehbuchs von Sidney Howard nicht realisieren- offenbar aus falscher Rücksichtnahme auf mögliche deutsche und italienische Boykottandrohungen. Umso erfolgreicher war dann die 1937 angefertigte Bühnenversion von Lewis mit dem Co-Autor Jack Moffit, mit dem Lewis permanent im Clinch lag. Lewis spielte die Hauptfigur Jessup selbst (in einer Produktion des Theaters in Cohasset, Massachusetts), das Stück wurde über fünf Jahre lang – auch auf Spanisch und Jiddisch – an Dutzenden von US-Theatern aufgeführt.
Berliner Impressionen beim Rowohlt-Besuch: Hochpolitisch und hochprozentig
Nicht ohne Dorothy: Wie Schorer feststellte, wäre der Roman ohne den Einfluß der US-Reporterin und Auslandskorrespondentin der New York Evening Post Dorothy Thompson (1893–1961) – sie wurde seine zweite Ehefrau – wohl nicht geschrieben worden. Lewis hatte sie 1928 in Berlin bei einer Pressekonferenz kennengelernt und war so hingerissen, dass er ihr sofort Heiratsanträge machte, obwohl seine kriselnde Ehe mit Grace noch nicht geschieden war. Thompson war Expertin für den Aufstieg der Nazis geworden, sie hatte Hitler interviewt und ihn als pathologischen Schwachkopf beschrieben, der im Berliner Hotel Kaiserhof während ihres Gesprächs so theatralisch herumdröhnte, als wäre er bei einer Massenversammlung im Olympia Stadion. Wegen dieser kritischen Veröffentlichung in ihrem Buch „I saw Hitler“ veranlasste Hitler 1934 ihre sofortige Ausweisung- sie musste Deutschland innerhalb von 24 Stunden verlassen. Lewis hatte nicht nur ihre Erfahrungen mit den Nazis verarbeitet, sondern auch die unzähligen Diskussionen mit anderen Reportern über den Aufstieg der Nazis.
Sinclair Lewis hatte seinen deutschen Verleger Ernst Rowohlt 1928 in Berlin besucht. Der war vom Extremtrinker und Bestsellerautor mit guten deutschen Sprachkenntnissen absolut begeistert: Das Duo zog nächtelang durch die Stadt, konsumierte Unmengen an Bier, Wein, Whisky und Schnaps, doch Lewis brauchte zwischendurch nur gelegentlich eine halbstündige Schlafpause, dann war er wieder hellwach und und bereit für die nächsten Flaschen. Lewis inhalierte in Berlin die besondere politische Atmosphäre, er registrierte die aufgeladene, gereizte Umbruch- und Aufbruchstimmung. Nach seiner Rückkehr in die USA nahm er auch zur Kenntnis, dass die Kontroversen um eine Radikalisierung und zunehmende Sympathien für Demagogen immer heftiger ausgetragen wurden: War Huey Long nicht ein Musterbeispiel für den Aufstieg eines Faschisten? War die Hinrichtung von Sacco und Vanzetti, das Urteil gegen die Scottsboro Boys nicht ein Indiz für diese schleichende Akzeptanz von Willkür und Tyrannei ?
Lewis hatte mit seinem sieben Jahre nach diesem Berlin-Besuch veröffentlichten Roman jedenfalls einen neuralgischen Punkt während dieser erregten Debatte getroffen.
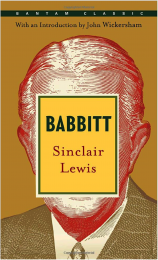 Statussymbol und Mythen des Alltags
Statussymbol und Mythen des Alltags
Als sein erster großer Erfolgsroman „Main Street“ am 23. Oktober 1920 erschien, war dies keine alltägliche Buchveröffentlichung, sondern das „sensationellste Ereignis der amerikanischen Verlagsgeschichte“, konstatierte Lewis-Biograf Mark Schorer. Der Roman sorgte für eine gigantische mediale Aufmerksamkeit und ein ebenso riesiges Leserinteresse; bereits zwei Jahre später hatten ca. zwei Millionen Amerikaner das Buch gekauft. Und mit dem kontrovers diskutierten „Babbitt“ (1922) nahm die Erfolgsgeschichte des pickligen, rothaarigen Autors (Spitzname: „Red“) aus dem Provinzkaff Sauk Center in Minnesota noch mehr Fahrt auf.
Dieser Mix aus kritischer, aber nicht zu polemischer Satire und behaglichem Puppenstuben-Realismus, der Charaktere wie den plump- materialistischen Immobilienmakler George F. Babbitt aus dem Nest Zenith mit milder Ironie beschrieb, erfasste den Zeitgeist und ein glattgebügeltes konformistisches Wertsystem, das hauptsächlich auf hoher Rendite, Mitgliedschaft im richtigen Club und Status-Symbolen basierte, zu denen neben den neuesten Automodellen auch Gimmicks wie etwa ein Wecker gehörten, dessen Alarmgeklingel wie das Glockenspiel einer Kathedrale dröhnt:
„Babbitt war stolz darauf, von so einem teuren Apparat geweckt zu werden“, heißt es, natürlich ironisch überhöht, im Roman, „sein gesellschaftlicher Status war dadurch beinah so enorm gestiegen wie durch den Erwerb teurer Gürtelreifen“.
Anerkennung verschafft ihm auch der am Armaturenbrett seines Autos anschließbare elektrische Zigarrenanzünder, den sich Babbitt gönnt: So spart er sich die wertvolle Zeit, die er sonst mit dem Anhalten und Anzünden vergeudet hätte – mit seinen Kumpeln kann er lang und breit über diese bedeutende fortschrittliche Errungenschaft schwadronieren. Lewis ist ein wahrer Meister im Registrieren solcher banaler Details – seine Kunst besteht darin, den Stellenwert der ratternden, schnatternden „Konversationsmaschine“ (Vgl. die Soziologen Berger/Luckmann: „Konstruktion gesellschaftlicher Wirklichkeit“) für die Identitätsstärkung im sozialen Kontext so früh und präzise (lange vor Goffman et al.) auf den Punkt zu gebracht zu haben. Kaum etwas scheint schöner und wichtiger für diese Männer zu sein als die Anerkennung durch die Peer Group – aber gleichzeitig möchte Babbitt auch aus dem Rudel der angepassten grauen Mäuse ausbrechen und einfach mal, wie weiland Thoreau, abtauchen in einem idyllischen „Walden“, in dem man sich- Prohibition hin oder her – ungestört einige Drinks genehmigen kann, ohne an den aufreibenden Job, die kleinkarierte Ehefrau oder an die anspruchsvollen Kids denken zu müssen.
Über die Lyrik der Industrialisierung und intellektuelle Stimulation von Werbetexten kann Babbitt mit seinem Nachbarn, dem Freizeit-Dichter und Werbetexter Frink palavern, wobei sie sich selbstzufrieden auf die Schulter klopfen können: Sind wir nicht sagenhaft aufgeklärt, zivilisiert und liberal ?
Da Frink gerade an einem Text für das neue „Zeeco“-Automobil laboriert, liefert er Babbitt einige Beispiele seiner Kunst futuristischer Speed-Verherrlichung:
„Hinter den Hügeln lockt das lange weiße Heck jeden Mann und jede Frau mit echtem Blut in den Adern und einem alten Piraten-Song auf den Lippen … Speed – glorious speed – das ist weit mehr als momentanes Glücksgefühl, es ist das wahre Leben … Rasant wie die Antilope, sanft wie der Flug der Schwalbe, doch stark wie der Sprint eines Elefanten – das ist der Zeeco!“
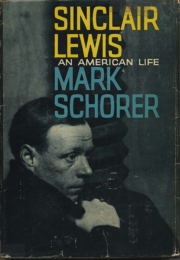 Kultur oder Kohle
Kultur oder Kohle
Nicht nur der unstete „On the Road“-Freak Lewis, der die USA auf unzähligen Autofahrten im Ford-T, Buick oder Hupmobile (Vgl. „Free Air“/ 1919, dt. Titel „Benzinstation“, Rowohlt 1954) durchquerte, sich dabei Dutzende von Domizilen für einige Wochen oder Monate anmietete und dann nach Paris, London oder an die Cote d’Azur (für die „Arrowsmith“-Recherchen sogar in die Karibik und nach Südamerika) weiterzog, ist hier erkennbar. Die Faszination der neuen motorisierten Mobilität, als Synonym für ein völlig neues Freiheitsgefühl kam diesem hyper-kreativen, manisch-depressiven Außenseiter sehr entgegen. Hinter diesen Einblicken in das Leben und die Sehnsüchte eines saturierten Kleinbürgertums schimmert die Ambivalenz des Eindeutigen auf: Denn Lewis liefert neben seiner ironischen, mit mildem Spott eingefärbten Erzählhaltung streckenweise auch eine vernichtende, hämische Karikatur einer Dumpfbacken- Provinz, in der kulturelle Interessen beim Tanz um den Big Buck völlig auf der Strecke bleiben. Das war ja schon das „Main Street“-Thema gewesen: Mit ihren ambitionierten Plänen, das Provinznest Gopher Prairie kulturell zu beglücken und auf eine „höhere“ zivilisierte Ebene zu transportieren, scheitert die College-Absolventin Carol Milford in jeder Beziehung. In „Babbitt“ werden Konflikte wie der Ehebruch der Hauptfigur zwar ausgetragen und führen vorübergehend zur Isolation, doch nimmt ihn die Zenith-Gemeinde schließlich wieder auf, so dass die vermeintliche Butzenscheiben-Idylle wieder intakt ist.
„Babbitt“ als abwertendes Etikett verweist zwar auf ein Segment engstirniger Spießigkeit, aber Lewis hatte sich mit dieser Schwäche meistens ganz gut arrangieren und identifizieren können. Jedenfalls hatte der Arztsohn aus Sauk Center schon früh eine extreme Aversion gegen offizielle Würdenträger und Wichtigtuer entwickelt und sich lieber unter das „einfache“ Volk gemischt . Als Yale-Student war er zwar Herausgeber des Literaturmagazins, aber unzufrieden mit den meisten Professoren sowie mit dem curriculum; daher setzte er sich nach dem ersten Studienjahr ab, um vorübergehend in das exotische Ambiente der sozialistischen Helicon-Hall-Kommune von Upton Sinclair einzutauchen. Er verdiente sich mit Büroarbeiten bei Zeitungen, mit Hausmeister- und Nachtportier-Jobs sein Taschengeld und heuerte unter mörderischen Bedingungen auf Viehtransportern nach Liverpool an, um sich dann in London umzusehen und die englischen Provinz zu erwandern.
Seine ersten journalistischen Arbeiten fabrizierte er schon als Student, wobei sein übertriebener Ehrgeiz wohl als Kompensation seiner Außenseiterposition als ewig verhöhnter, rothaariger, ungelenker häßlicher Pickelknabe ( nach mißglückter Bestrahlung der Akne) verstanden werden muß. Hatte es ihn aber gepackt und war er fasziniert von einem Romanthema, konnte er die Außenwelt während einer längeren heißen Produktionszeit fast völlig ausblenden. Doch in der euphorischen Postproduktionsphase betrank er sich sinnlos, hielt stundenlange Reden, heckte alberne Streiche als kostümierter Hanswurst aus oder er beschimpfte auf Festbanketten nichtsahnende Gäste hemmungslos. Die Dollarzeichen, die der entrüstete Lewis in den Augen der so heftig kritisierten Kleinstadt-Philister und Kulturbanausen aufblitzen sah, waren für ihn selbst früh zum Lebensmittelpunkt geworden: Er prahlte schon als junger Magazinautor mit den kassierten hohen Honoraren und war entzückt, wenn Kleinstadt-Bankiers angesichts dieser exorbitanten Summen vor Neid erblassten – über den Inhalt seiner Geschichten wurde bei diesen Diskussionen meistens kein Wort verloren. Er wollte ja, wie auch Schorer zugeben muß, der Kunst zur Anerkennung verhelfen, obwohl die Umwelt nur einen plumpen Materialismus anbetete.
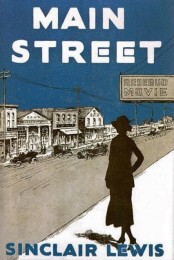 Lewis war allerdings selbst so stark abhängig von Statussymbolen und Big Bucks, dass er glaubte, nur mit einer gut abgefederten materiellen Basis die Heuchelei und Selbstgefälligkeit des Kleinbürgertums entlarven zu können, die ja letztlich auch noch in ihm selbst steckte. „Sie wissen wohl nicht, dass ich ein 60.000-Dollar-Mann bin!“, blaffte der Bestsellerautor Lewis einmal einen Kellner an, der ihm keine beflissene Sonderbehandlung zukommen ließ, sondern ihn mit derselben mürrischen Indifferenz bediente wie alle anderen Gäste auch. Die Selbstbefreiung von provinziellen Zwängen und spießigen Vorurteilen, die er als Leitmotive seiner Romane in den Fokus nahm, hat Lewis selbst ja auch angestrebt- mit wechselndem Erfolg. Seine exzessiven Irrungen und Wirrungen, die clownesken Einlagen und theatralischen Auftritte waren ebenso Indizien für diese innere Zerrissenheit wie sein Alkoholismus.
Lewis war allerdings selbst so stark abhängig von Statussymbolen und Big Bucks, dass er glaubte, nur mit einer gut abgefederten materiellen Basis die Heuchelei und Selbstgefälligkeit des Kleinbürgertums entlarven zu können, die ja letztlich auch noch in ihm selbst steckte. „Sie wissen wohl nicht, dass ich ein 60.000-Dollar-Mann bin!“, blaffte der Bestsellerautor Lewis einmal einen Kellner an, der ihm keine beflissene Sonderbehandlung zukommen ließ, sondern ihn mit derselben mürrischen Indifferenz bediente wie alle anderen Gäste auch. Die Selbstbefreiung von provinziellen Zwängen und spießigen Vorurteilen, die er als Leitmotive seiner Romane in den Fokus nahm, hat Lewis selbst ja auch angestrebt- mit wechselndem Erfolg. Seine exzessiven Irrungen und Wirrungen, die clownesken Einlagen und theatralischen Auftritte waren ebenso Indizien für diese innere Zerrissenheit wie sein Alkoholismus.
Hinter seiner Dickens-Affinität war zwar immer die Freude des Erzählers am Schwelgen in Alltagsdetails erkennbar, aber dahinter verbarg sich auch, wie Alfred Kazin („On Native Grounds“) konstatierte, „der Schrecken des Alltäglichen und das Grauen, das aus Verdrängungen und der Gemeinheit der Welt aufsteigt“ – das macht auch heute noch die wahre Größe und Aktualität von Sinclair Lewis aus.
Peter Münder
Literaturhinweise/Anmerkungen:
Sinclair Lewis: It can’t happen here. New York 2014 (Penguin Classics)
Mark Schorer: Sinclair Lewis. An American Life, New York 1961
(dt. Ausgabe: Sinclair Lewis. Ein amerikanisches Leben. München 1964, 968 S.)
ders.: Sinclair Lewis. A Collection of Critical Essays. New York 1956
Schorers Lewis-Biografie müsste eigentlich mit einem Beipackzettel (Warnung: ätzend und giftig!) versehen werden, denn er lässt keine Gelegenheit aus, Lewis mit Häme, Spott und Kritik zu überziehen. Neun Jahre hat er für das Recherchieren und Schreiben des fast tausend Seiten starken Bandes benötigt; sehr angebracht ist natürlich seine grundsätzlich kritische Einstellung, die jede Heldenverehrung vermeidet. Doch letztendlich hat man den Verdacht, er würde seine unbändige Wut über einen zu komplexen und widersprüchlichen Charakter in seinem giftigen Text abreagieren. Bewundernswert ist zwar die detailfreudige, akribisch recherchierte Demontage dieses Diagnostikers eines auf plumpen Materialismus fixierten Lifestyle. Grotesk und irritierend ist trotzdem Schorers abschließendes Verdikt: „Lewis war einer der schlechtesten Schriftsteller der modernen amerikanischen Literatur, aber die moderne amerikanische Literatur ist ohne sein schriftstellerisches Werk nicht vorstellbar“.
Gore Vidal: The Romance of Sinclair Lewis. In: New York Review of Books, October 8, 1992
Jan Peter Verhave: Arrowsmith, a Synergy of Talents. In:
The Sinclair Lewis Society Newsletter, spring 2016, edt. by
Sally E. Parry/ Engl. Department Illinois State Univ. (separry@ilstu.edu.)
Roger Lathbury: „It Can’t Happen Here and Politics“. (Diskussion/ Anmerkungen). In: Lewis Society Newsletter, spring 2016












