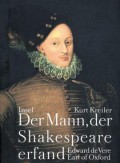 Shakespeare und sein Ghostwriter
Shakespeare und sein Ghostwriter
Die Dispute gab es schon vor 150 Jahren: Konnte Shakespeare mit seiner angeblich so einfachen Schulbildung tatsächlich der Verfasser all der Dramen mit den hochgelehrten Anspielungen und so profundem Allgemeinwissen sein? Schrieb vielleicht ein ganz anderer, gut betuchter Aristokrat die Stücke und bediente sich des Mannes aus Stratford als literarischem Strohmann? Diese Thesen vertritt der Kölner Germanist Kurt Kreiler. Sein Shakespeare-Kandidat ist der Aristokrat Edward de Vere, Earl of Oxford, was er mit seiner Studie Der Mann, der Shakespeare erfand beweisen möchte. Feinstes True Crime mit hohem kriminellem Potenzial. Peter Münder rekonstruiert …
Vor fünf Jahren übersetzte Kurt Kreiler die Gedichte von Edward de Vere, ein Jahr später hatte Kreiler wohl sein Erweckungserlebnis, als er die in einer 1573 anonym publizierten Anthologie erschienene Novelle „The Adventures of Master F.I.“ übersetzte und in mächtiger philologischer Fleißarbeit eruierte, dass sich hinter dem Autor George Gascoigne offenbar derselbe umstrittene, berüchtigte Aristokrat Edward de Vere, 17. Earl of Oxford (1550–1604) verbarg.
Diese sensationelle Enthüllung muss den promovierten Germanisten Kreiler dermaßen fasziniert haben, dass er wohl den großen literarischen Scoop witterte und sich der Kontroversen um Shakespeares (1564–1616) Autorschaft entsann. Hatte de Vere sich vielleicht auch als Dramatiker betätigt? War er vielleicht sogar Shakespeares Ghostwriter gewesen? Sein Favorit Edward de Vere wurde ja schon gelegentlich neben dem Staatsmann und Philosophen Francis Bacon (1561–1626), William Stanley, dem 6. Earl of Derby, und anderen als der „wahre Shakespeare“ gehandelt. Könnte man diese Ghostwriter-Variante jetzt nicht mit neuen Spekulationen, Indizien und Mutmaßungen belegen? So dürfte Kreiler kalkuliert haben.
Munteres Identitäten-Rätseln
Und warum auch nicht? Schließlich hatte sich sogar der Shakespeare-Kenner- und -Interpret Sigmund Freud in späten Jahren als „Oxfordianer“ geoutet. Außerdem findet das muntere Rätselraten um Shakespeares Identität nun schon seit über 150 Jahren statt. Beim Spiel „England sucht den Super-Dramatiker“ wurden bisher rund einhundert (!) Kandidaten vorgestellt, getestet und meistens wieder fallengelassen. Neben Francis Bacon gehörten dazu auch der Dramatiker-Kollege und Spion Christopher Marlowe (1564–1591), und neuerdings (seit 2005) auch Sir Henry Neville (1529–1593).
Ausgangspunkt der Shakespeare-Skeptiker ist dabei vor allem die angeblich so mangelhafte Schulbildung, die der junge William an einer Lateinschule in Stratford genoss. Kann man mit diesem dürftigen Bildungsfundament tatsächlich über ein so breites Spektrum verfügen und all die klugen Anspielungen auf historische Episoden, auf Intrigen und Machtkämpfe in Königshäusern sowie plastische Beschreibungen aus fernen Ländern zu Papier bringen? Wie kann ein einfacher Handschuhmachersohn aus der Provinz die existenziellen Probleme eines selbstkritischen, melancholischen dänischen Prinzen erörtern, die Konflikte eines von Familienfehden zerriebenen Liebespaares oder die Zweifel eines Attentäters artikulieren, der einen römischen Diktator beseitigen will?
Das trauten die Skeptiker dem simpel gestrickten „Speerschüttler“ nicht zu und plädieren daher für einen gebildeten Ghostwriter, der Shakespeares Stücke in Wahrheit geschrieben haben soll. Unterschlagen wird von den „Anti-Stratfordianern“ dabei jedoch, dass Shakespeares Latein-Schule keineswegs eine Dumpfbacken-Klitsche für Analphaten, sondern eine anspruchsvolle, an den Klassikern orientierte Schule war, an der man das Schreiben, Redigieren und Interpretieren eigener Texte (auch von kurzen Stücken!) lehrte. Es war für den angehenden Dramatiker einfach die beste Schule.
Außerdem war Shakespeare, wie Peter Ackroyd in seiner wunderbaren Shakespeare-Biografie von 2005 zeigte, ein extrem lernbegieriger, auffassungsstarker und hoch motivierter Autor und Schauspieler, der am liebsten im Diskurs mit anderen Schauspielern neue Ideen für aufführbare Stücke diskutierte. Er war eben kein Bewohner eines einsamen Elfenbeinturms, sondern ein volkstümlicher Teamworker, der fast alles für die Bühne verwertbar hielt: Zeitgenössische Chroniken, Putschgerüchte, politische Intrigen, Klatsch und Tratsch, Geschichten vom Hof, antike Sagen. Warum sollte er – wie der von Kreiler verehrte Earl of Oxford – lange Auslandsreisen unternehmen, wenn er während seiner Exkursionen mit diversen Wanderschauspieltruppen durch die englische Provinz aus erster Hand mit brisanten Themen konfrontiert wurde und diese bühnenwirksam verwerten konnte?
Doppelgänger?
Der aristokratische Earl soll sich – so Kreilers These – als Ghostwriter bedeckt gehalten haben, weil eine Autorschaft der Dramen und das gesamte Theater-Ambiente in Aristokratenkreisen damals angeblich zu peinlich oder anrüchig gewesen sein soll. Und bei seinen Reisen auf dem Kontinent, so Kreiler, habe sich der Earl all die geographisch-literarischen Kenntnisse angeeignet, über die ein Provinz-Mime wie Shakespeare niemals verfügen konnte.
Der französische Anglist Jean Paris hatte auf diese große, bunte Schar angeblicher literarischer Doppelgänger und Ghostwriter schon in seiner Shakespeare-Biografie von 1958 hingewiesen. Und er mokierte sich darin auch über die Unsitte linguistischer Komparatisten, banale Alltagsfloskeln verschiedener Autoren auf mögliche Übereinstimmungen abzugleichen. Als die amerikanische Bacon-Verwandte Miss Delia Bacon 1856 vor ihrer Einweisung in eine psychiatrische Anstalt triumphierend verkündete, in 4400 Zitaten und Anmerkungen bemerkenswerte Wortwahl-Übereinstimmungen zwischen Shakespeare und Francis Bacon entdeckt zu haben, stellte sich heraus, dass die meisten Floskeln so profunde Aussagen wie „Guten Morgen“, „Amen“, „ich versichere euch“ oder „glaubt mir“ enthielten. So ähnlich argumentiert und insinuiert Kreiler mit Verweisen auf Christopher Marlowe, Thomas Kyd und anderen auch, nur um Shakespeare irgendwie als einfallslosen Plagiator bloßstellen zu können.
Für Kreiler steht nie außer Frage, dass „der Mann, der Shakespeare erfand“, der Earl of Oxford war. Sein Vorverständnis, seinen hermeneutischen Tunnelblick deutet er lediglich im Nachwort an – im diffusen Umfeld früherer Doppelgänger-Fabrikanten, über deren Argumente er sich ereifert und lustig macht. Seine sprunghaft und assoziativ formulierte Studie geht weder chronologisch vor noch bleibt sie längere Zeit an seiner Hauptfigur oder einem bestimmten Kontext dran.
Intrigen, Häscher, Hochverrat
Mögliche Gegenbeweise blendet Kreiler systematisch aus: Den aufsehenerregenden Hochverratsprozess gegen den Earl of Essex vom Februar 1601 etwa, in dem sich Essex und seine Komplizen wegen des geplanten Sturzes von Königin Elisabeth verantworten mussten, stellt Kreiler eher flüchtig und oberflächlich als merkwürdiges Resultat eines Dummenjungenstreichs dar. Essex hatte ja im Globe Theatre für eine Aufführung von Shakespeares Richard II. gesorgt, um den geplanten Königsmord propagandistisch auszuschlachten und wurde deswegen nach seinem Prozess am 25. Februar 1601 geköpft.
Was Kreiler nicht erwähnt, weil es ihm nicht in sein Konzept passt: Unter den Schauspielern der Burbage-Truppe, die von Essex 40 Schilling erhielt, war Shakespeare selbst gewesen und zu den Anklägern gehörte sowohl der Earl of Oxford als auch Francis Bacon und Graf Derby – also gleich drei der prominentesten vermeintlichen „Ghostwriter“. Wie soll sich das zusammenreimen mit Kreilers These? Und könnte man nicht vermuten, dass in dieser kritischen Umbruchphase mörderischer politischer Intrigen und Krisen, da die Geheimpolizei Jagd auf katholische Rebellen machte und belastende Dossiers in Umlauf brachte, um Dissidenten dingfest zu machen, ein Dramen schreibender Schöngeist wie der Earl sofort denunziert und überführt worden wäre? Dazu äußerst sich Kreiler nicht, weil er eindeutige Fakten gern im Nebel seiner de Vere-Spekulationen untergehen lässt.
Für ihn ist es auch banal, dass der Earl of Oxford bereits 1604 verstarb. Welcher Ghostwriter soll dann nach dem Exitus des Earls die Spätwerke bis zum Tod des großen Barden im Jahre 1616 verfasst haben? Die „Problem Plays“ König Lear, Heinrich VIII. und Macbeth seiner „dunklen Periode“ hat die Forschung ja auf 1608–1609 terminiert und Spätwerke wie Pericles, Ein Wintermärchen, Cymbeline oder den legendären Sturm auf die Zeit zwischen 1611–1613 taxiert. Kreiler beruft sich einfach nur auf Shakespeares frühere Beschäftigung mit überlieferten Stoffen und datiert die Spätwerke einfach so weit zurück in frühere Perioden, dass es gar kein Spätwerk mehr gibt. Sein Wunschdenken und seine dominierende „self-fulfilling prophecy“ verdrängen unliebsame Fakten und lassen keinen Schatten auf das strahlende Denkmal seines Helden Edward de Veres fallen.
Fatale Obsession
„Shakespeare verfolgt keine Mission“, konstatiert Kreiler – wer wollte da widersprechen? Eine Mission verfolgt hier nur der Autor Kreiler: nämlich seine obsessive de Vere-Fixierung als Resultat akribischer Recherchen und, wie er im Vorwort behauptet, als „Buch der Findungen“ zu präsentieren. Die Quintessenz dieser Fixierung möchte Kreiler als Rehabilitierung eines rauflustigen, leichtlebigen und unzuverlässigen Aristokraten verstanden wissen, den er hier als zu Unrecht diskriminierten Märtyrer hinstellt.
„Dreihundert Jahre lang hielt man den Earl of Oxford für einen Abseitigen und Halbkriminellen und den Mann aus Stratford für das Genie vom Dorf.“ Kreiler kann seine These zwar nicht plausibel beweisen, für ihn stand jedoch von Anfang an fest: Das Genie saß am Hof. Wer sich nach wie vor zum alten Barden als dem echten Shakespeare bekennt, ist laut Kreiler offenbar kleinkariert und reaktionär. Denn Shakespeares Erben, meint Kreiler „kauen wie im Traum am Knochen ihrer fixen Idee“. „Ihr biederes Vorurteil klammert sich an die Leugnung aristokratischer Kultur. Deshalb hat die Wissenschaft ihre Erkenntnisse auf eine Falschaussage hin passend gemacht – den Earl diffamiert und mit dem Geschwätz vom Barden dem Bauern ein Denkmal gesetzt.“ Ja, der arme, verkannte Earl!
Kreiler hat zwar keinen neuen Kandidaten entdeckt, aber immerhin tief in die historische Anekdotenkiste gegriffen, um die turbulente Epoche zur Shakespeare-Zeit, die ja eine Periode extremer religiöser und politischer Sinnkrisen war, vor uns auszubreiten. Das mag ein hübsches Abfallprodukt dieses angeblichen Findungsprozesses sein, es ändert jedoch nichts daran, dass auch Kreilers Kandidat aus dem „Super-Dramatiker“-Spiel rausfliegen muss – wenn es noch kritisch-analytische Leser gibt, die sich vom bunten Historien-Mix eines Aristokraten-Fans nicht einnebeln lassen. Kreiler hat nichts bewiesen, dafür aber einen diffusen „Viel Lärm um Nichts“-Effekt produziert: heiße Luft, immerhin sehr effektvoll verwirbelt, aber eben doch nur Luft.
Peter Münder
Kurt Kreiler: Der Mann, der Shakespeare erfand. Edward de Vere Earl of Oxford.
Frankfurt/M.: Insel Verlag 2009. 595 Seiten. 29,80 Euro.
| Kurt Kreiler bei Suhrkamp
| Kurt Kreiler-Interview auf Deutschlandradio Kultur
| Artikel im Tagesspiegel vom 06.11.2009











