Neue Sachbücher, vorgestellt von Alf Mayer (AM) und Michael Höfler (MH).
 Heute mehr denn je
Heute mehr denn je
(AM) Diese Fotos zeigen einen Teil der Gegenwart, wir können es uns nicht leisten, unseren Blick davon abzuwenden, schrieb der Fotograf Sebastião Salgado in seinem Vorwort, damals im Jahr 2000, als dieses Buch zum ersten Mal erschien. Keine Seite davon und kein einziges Bild hat seitdem an Aktualität verloren. Im Gegenteil. Diesen Band jetzt wieder zu veröffentlichen, ist eine politische Tat.
Heute wissen wir noch mehr als damals, dass die Auswirkungen von Armut, Unterdrückung, Krieg und Terror und Verzweiflung – so weit entfernt ihre Herde sein mögen – sehr wohl direkt und nah mit uns zu tun haben. Wissen wir, dass Wegschieben nicht hilft. Mehr als sechs Jahre war Sebastião Salgado in den 1990ern unterwegs, dokumentierte das Thema Migration und Vertreibung in 40 Ländern. Er porträtierte Menschen, die durch Krieg, Völkermord, Unterdrückung, Elend und Hunger gezwungen waren, ihre Heimat aufzugeben und sich auf eine Reise mit ungewissem Ausgang zu begeben, dies in Südamerika, auf dem Balkan, in den Slums der Megacitys Asiens, im Nahen Osten und im Herzen Afrikas.
Gut eineinhalb Jahrzehnte, beinahe die Spanne einer ganzen Generation, ist seit der Erstpublikation von „Exodus“ vergangen. Das Buch hat nichts von seiner Wucht verloren, wirkte heute unmittelbarer denn je. Und nach wie vor bewundernswert ist bei den Fotos wie in der Gesamtkomposition des Buchs der Balanceakt zwischen der Dramatik der Situation und den ästhetischen Ansprüchen an Aufbau und Komposition der Bilder. Salgado, im armen ländlichen Brasilien aufgewachsen hat einen Blick für die Menschen und für ihre Würde. Er ermöglicht uns, hinzuschauen.
Die Fotos sind in erstklassiger Qualität gedruckt. Ein 32seitiges Begleitheft – wie angenehm, dass man dafür in dem schweren Band nicht immer nach hinten blättern muss –bietet zu jedem Bild ausführliche Informationen und vermittelt viel Hintergrund. Politische Bildung auf hohem ästhetischem Niveau. Ein Bravo für diese verlegerische Tat.
Sebastião Salgado, Lélia Wanick Salgado: Exodus. Fotoband. Hardcover mit Begleitheft, 24,8 x 33 cm. Taschen Verlag, Köln 2016. 432 Seiten, 49,99 Euro. Verlagsinformationen.
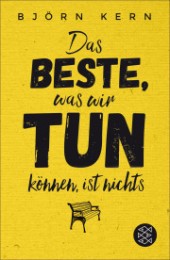 Eigenbeispiel der Genügsamkeit
Eigenbeispiel der Genügsamkeit
(MH) Als Björn Kern 2009 bei der Verleihung eines Literaturpreises in Brandenburg sagte, das Beste an Berlin sei die Nähe zur guten Luft Brandenburgs, war das nicht einfach so dahingesagt. Ein paar Jahre später nämlich bezog Kern ein altes Haus im Oderbruch, um sein voriges, von Tatendrang getriebenes Leben hinter sich zu lassen. Er beschreibt auf 246 Seiten, wie er sich in Nichtstun (eigentlich: Genügsamkeit) geübt und damit sein Scherflein Beitrag zum Elend der Welt reduziert habe. Diesem Geist entsprechend fließt der Inhalt mählich und unaufgeregt dahin. Kern erzählt bescheiden, vermeidet, und dies kostet ihn dann doch etwas Anstrengung, was ideologisch klingen könnte. Getragen wird die sparsame Handlung in dem inzwischen in vierter Auflage gedruckten Buch durch den Nachbarn, der den Zuzügler aus Berlin in pointiertem Brandenburgisch immer wieder in vermeintlichen Notsituationen mit praktischer Klugheit bisher nicht gelesenen Ausmaßes vom Impuls des Tuns und Kaufens abbringt.
Sicher dem Lektorat und dem Buchmarkt geschuldet, verfällt der Duktus zwischen Selbstreflektionen und Naturbetrachtungen literarischer Qualität zunehmend häufig in den überstrapazierten Imperativ eines Ratgebers. Mit seinem Buch erreicht Kern sicher viele, die erst ahnen, dass sie sich in einem Hamsterrad aus sinnfreier Arbeit und dem kurzen Glück des damit ermöglichten Konsums verrennen. Wer sich aber schon einige Gedanken über Konsumverzicht gemacht hat, vermisst die Tiefe in den bloß berührten Konflikten, beispielsweise dem zwischen passivem Raushalten und aktivem Engagement gegen den Irrsinn. Allerdings war Kern hierzu im Schreiben dieses Buch aktiv.
Björn Kern: Das Beste, was wir tun können, ist nichts. S. Fischer, 2016. 256 Seiten. 9,99 Euro.
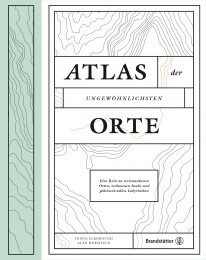 Fliegender Teppich im Buchformat
Fliegender Teppich im Buchformat
(AM) Eine meiner Lieblingspostkarten an der Reise-Pinwand hat die Aufschrift:
„I haven’t been everywhere
but it’s on my list.“
Immer kommen weitere Ziele hinzu, an denen ich noch nie war, vielleicht auch nie sein werde, mich aber dennoch (vielleicht bald oder gleich) mit ihnen beschäftige. Oder auch nicht. Sich aus der vertrauten Umgebung zu träumen, in welcher Form auch immer auf Reisen zu gehen, das scheint ein unstillbares menschliches Bedürfnis zu sein. Längst hat sich neben dem alltagspraktischen Reiseführermarkt ein Meta-Reich etabliert, nämlich das für ungewöhnliche Destinationen. Zu wohl mehr als 99,9 Prozent werden nur Kopf-Reisen daraus, das Angebot dafür wird allmählich unübersichtlich. Vergleichsportale sind nicht in Sicht, auch diese Besprechung kann das nicht leisten.
Dass sich solche fliegenden Teppiche im Buchformat verlegerisch lohnen können, das zeigt seit 2009 Judith Schalanskys Bestseller „Atlas der abgelegenen Inseln. Fünfzig Inseln, auf denen ich nie war und niemals sein werde“ (mare). Inzwischen gibt es – die Liste ist keineswegs vollständig – Werner Nells „Atlas der fiktiven Orte: Utopia, Camelot und Mittelerde. Eine Entdeckungsreise zu erfundenen Schauplätzen (2011), Judyth A. McLeods „Atlas der legendären Länder: Von Atlantis bis zum Garten Eden“ (2012), Karin Doering-Frogers „Atlas der verlorenen Städte“ (2015) und alleine aus 2016 Alastair Bonnetts „Die seltsamsten Orte der Welt: Geheime Städte, Wilde Plätze, Verlorene Räume, Vergessene Inseln“, Olivier Le Carrers „Verwunschene Orte: Atlas der unheimlichen Orte. Eine düstere Reise um die Welt“, Nick Middletons „Atlas der Länder, die es nicht gibt. Ein Kompendium über fünfzig nicht anerkannte und weithin unbekannte Staaten“, den „Atlas der unentdeckten Länder“ von Dennis Gastmann oder den Bildband „Stillgelegt: 100 verlassene Orte in Deutschland“. Mir hat aus 2015 das minimalistische, von den Auslandskorrespondenten der NZZ verfasste „Grenzen erzählen Geschichten“ sehr gefallen (ein LitBit dazu hier).
Nun also Travis Elborough und sein „Atlas der ungewöhnlichen Orte“. Es kommt aus einem Verlag, dem man trauen kann, was Inhalt und feine Ausstattung angeht. Brandstätter aus Wien hat das schon oft bewiesen. Die Karten hat Alan Horsfield gezeichnet, zur weiteren Anschauung gibt es je ein Foto des Ortes dazu. Die gut recherchierten Texte enthalten manche weit über den jeweiligen Ort hinausführende und sich im Hinterkopf festsetzende Geschichtslektion. Zum Beispiel über die verlassene japanische Insel Hashima, über die asbestverseuchte australische Kleinstadt Wittenoom, die Grabhöhlen der Ibaloi auf der philippinischen Insel Benguet, die einstige Hauptstadt des Königreichs Armenien (Ani), die hängende Bergkirche von Spiazzi in Italien, die 1967 zum Lake Havasu in Arizona umgezogene London Bridge oder das Kolonialismus-Relikt Ross Island vor Indien. Ungewöhnlich sind sie alle, die 51 Orte. Wie gesagt, meine Liste wird immer länger.
Travis Elborough, Alan Horsfield: Atlas der ungewöhnlichen Orte. Eine Reise zu verwunschenen Plätzen, verlassenen Inseln und geheimnisvollen Labyrinthen (Atlas of Improbable Places. A Journey to the World’s Most Unusual Corners, 2016). Übersetzt von Barbara Sternthal. Verlag Brandstätter, Wien 2016. Hardcover, 224 Seiten, 100 Abbildungen, 29,90 Euro. Verlagsinformationen.
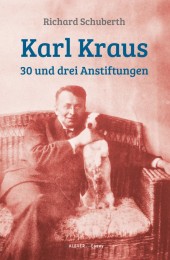 Karl Kraus für heute
Karl Kraus für heute
(AM) Der Gedankenlose denkt, man habe nur dann einen Gedanken, wenn man ihn hat und in Worte kleidet. Er versteht nicht, dass in Wahrheit nur der ihn hat, der das Wort hat, in das der Gedanke hineinwächst – so lautet ein Diktum von Karl Kraus, der nun auch schon 80 Jahre tot ist. Form und Inhalt gehören bei diesem Sprach- und Kulturkritiker zusammen, so wie Leib und Seele. „Die wahren Agitatoren für eine Sache“, sagt er, „sind die, denen die Form wichtiger ist. Wer nichts der Sprache vergibt, vergibt nichts der Sache.“
Der österreichische Schriftsteller, Dramatiker, Aphoristiker, Essayist, Ethnologe, Cartoonist, Songwriter und Regisseur Richard Schuberth, 1968 in Ybbs an der Donau geboren, bekennender Kommunist, gehört zu jenen wenigen Karl-Kraus-Nachfahren, die sich auf sprachlichem Niveau mit dem Meister messen können. Es ist eine Freude, seine „30 und drei Anstiftungen“ zu einer neuerlichen Begegnung mit Karl Kraus zu lesen. Schuberth, der uns schon „Das neue Wörterbuch des Teufels“ bescherte, gelingt eine Gratwanderung. Kraus-Kennern eröffnet er neue Blickwinkel, Neuankömmlingen bietet er in den vier- bis sechsseitigen Essays viele Zugänge. Insgesamt holt er Kraus in die Gegenwart. Zitat: „Alle Versuche, ihn in die linke Pragmatik seiner Zeit einzubinden, scheiterten, wohl aber bietet er linker Gesellschaftskritik von heute wertvolle Impulse, so sie bloß bereit wäre, diese zu empfangen.“ Man beachte den Konjunktiv.
Schuberth debattiert erstaunlich offen, wie Karl Kraus heute gelesen und verstanden werden könnte. Die klugen und polemischen Essays, dreißig an der Zahl, erschienen zuerst als Serie in der Wiener Straßenzeitung „Augustin“, 2008 dann bei Turia + Kant. Um drei weitere Anstiftungen erweitert, mit einem sehr lesbaren Satzbild ausgestattet – alle Zitate von Karl Kraus im Text sind sofort auszumachen – und einem Nachwort von Thomas Rothschild zum „Lob der Unkorrumpierbarkeit“ abgerundet, ist das Buch im kleinen feinen Wiener Verlag Klever erschienen. Es steht auf der Hotlist 2016 der „Besten Bücher aus unabhängigen Verlagen“.
Zwei kleine Wegzehrungen daraus: Von Karl Kraus lässt sich als Erstes lernen, sich von Phrasen fernzuhalten. Und zweitens zu beherzigen, „einen geistreichen Gegner mehr zu achten als einen geistlosen Mitläufer“.
Richard Schuberth: Karl Kraus. 30 und drei Anstiftungen. Nachwort von Thomas Rothschild. Verlag Klever, Wien 2016. Klappenbroschur, 250 Seiten, 22 Euro. Verlagsinformationen.
 Feuilleton in Buchform
Feuilleton in Buchform
(AM) Ehrlich gesagt, hatte ich mir mehr versprochen. Aber so geht es einem inzwischen ja auch oft bei der Zeitungslektüre. Warum sollte ein Buch über das Zeitunglesen nicht seine Daumendrehmomente haben? Michael Angele ist stellvertretender Chefredakteur der Wochenzeitung „Der Freitag“, als „Monument der Lebensform Zeitung“, wie der Klappentext es tut, würde ich sein Buch nicht unbedingt bezeichnen. Es gehört eher zur Gattung Tischfeuerwerk. Macht etwas her, verpufft aber auch schnell. Der Band ist schmal, der Text wie eine schmale Zeitungsspalte mittig gesetzt, 5,5 cm breit und 11,5 cm hoch. Zwei Absätze in der Zeitung. Hier sind sie eine Buchseite. Hübsche Idee, aber die armen Bäume.
Natürlich wird dieses „Gestaltungsargument“ irgendwann zum Sinnbild für die inhaltliche Substanz. Ich gehöre einer Journalistengeneration an, der sich bei den belanglosen und riesengroßen XY-Zeitungsfotos die Zehen krümmen, kann dem aber folgen, dass man damit Zeilen, Zeit, Schreiber und Honorare spart. Kaufe ich aber Zeitung der Platzfüller oder der Inhalte wegen? Michael Angele geht auf so etwas nicht ein, mit seiner Zunft und deren Zukunft eckt er nicht sonderlich an. Sein großer Aufhänger ist Thomas Bernhard, der zwar ein passionierter Zeitungsleser war, schwerlich aber ein Normalo.
Immerhin, diese Klammer wird bis zu einem größeren Interview mit Claus Peymann durchgehalten. Angele macht sogar die NZZ-Ausgabe vom 30. August 1968 ausfindig, um die es bei Bernhard einmal in einer Zeitungs-Anekdote geht, und er erzählt auch von jenem Leserbrief Bernhards, der einer Straßenbahn beim Überleben half. In Nebenkapiteln fällt ihm auf, dass in all den großen Romanen Balzacs über Journalisten, Verleger und Kritiker immer der Leser fehlt. Er beschreibt den inneren Konflikt, den ein Preis von acht Euro für eine FAZ an einem Kiosk in Istanbul auslösen kann. Natürlich ist sie dann weg, das Zögern war verständlich, aber wird bereut. Zeitungssüchtige und Zeitungssammler werden gestreift, scherzhaft wird geraten, den Verkauf von Zeitungen auf die Urlaubsgebiete zu beschränken.
Immer öfter geht es vom Hölzchen aufs Stöckchen, allmählich fällt auf, dass Angele gerne Leute trifft, die etwas zum Thema erzählen, etwa Professor Eberhard Schütz, den er aus einer Kneipe kennt. Claus Peymann bekommt auf die erst Frage monumentale achteinhalb Seiten/ Spalten ungebremste wörtliche Rede. Und immer gibt es noch ein Thomas-Bernhard-Fitzelchen, wahrscheinlich ist er ein dankbares Volltextsuchobjekt. Gutes Konzept eigentlich, aber ordentlich viel Weiß-Raum. Karl Kraus, der Zeitung wie kein anderer las, kommt gar nicht vor.
Michael Angele: Der letzte Zeitungsleser. Galiani Berlin, 2016. 160 Seiten, gebunden, 16 Euro. Verlagsinformationen.











