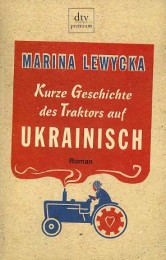 Von Titten und Traktoren
Von Titten und Traktoren
Leichtherzig und organisch verwebt Marina Lewycka Tragödie und Komödie zu einem berührenden Roman, der originell und pointiert osteuropäische Immigrantenschicksale lebendig werden lässt.
Nadeshda „Nadja“ Majevski ist als ukrainische Immigrantin der zweiten Generation angekommen in der Mitte der englischen Gesellschaft. Die liberale Universitäts-Dozentin hat ein hübsches Haus, einen intelligenten Mann und eine wohl geratene Tochter. Nur das feindselige Verhältnis zu ihrer älteren Schwester und die gestörte Beziehung zu ihrem wunderlichen 84-jährigen Vater Nikolai stört das Idyll. Papas jüngster Coup: der Witwer heiratet, zwei Jahre nach dem Tod seiner Frau, eine 36-jährige Ukrainerin ohne Aufenthaltsgenehmigung, aber mit guten Argumenten: „blondes Haar, wunderschöne Augen, fantastischer Busen“.
Diese dynamische Braut ist eine Naturgewalt. Wie eine „flauschige rosa Handgranate“ schießt Valentina in das Leben der Majevskis, wirbelt die eingefahrenen Beziehungen kräftig durcheinander und befördert gut verdrängte Familiengeheimnisse an die Oberfläche. Erfüllt von den konsumistischen Glücksverheißungen des goldenen Westens ist die junge Immigrantin wild entschlossen, ein großes Stück vom Kuchen abzubeißen. Grell geschminkt, in engem Top und Minirock verwandelt sie Nikolai in einen „84jährigen Teenager“, der bereitwillig den letzten Cent für Valentinas überzogene Wünsche opfert. Brustvergrößerung, Rolls Royce und E-Herd sind nur der Beginn einer langen Reihe von Forderungen.
Komische Dialoge, skurrile Szenen
Die Ich-Erzählerin Nadja und ihre Schwester sind sich einig, das erste Mal nach langer Zeit: „Papa hat eine Nutte geheiratet“, die sofortige Scheidung muss her. Wie die beiden ungleichen Schwestern – und später auch der sture Nikolai – im Kampf gegen die schrille Stiefmutter ihre gestörten Beziehungen neu justieren und schließlich zusammenfinden, davon erzählt Lewycka mit leichter Hand. In ungeheuer komischen Dialogen und skurrilen Szenen reizt sie die möglichen Verstrickungen der Grundkonstellation gnadenlos aus. Pointiert schildert sie die Auseinandersetzungen der grundverschiedenen Personen, deren widerstreitende Wünsche und Bedürfnisse sie in immer neue Konflikte treibt.
Doch der Roman erschöpft sich nicht in burleskenhaftem Slapstick. Bei aller derben Komik, trotz mancher Übertreibung und großer Exzentrik verkommen die Charaktere nie zu Abziehbildern, bleiben mehrdimensional und lebendig und behalten auch in den demütigsten Situationen ihre Würde. Zum Beispiel der kauzige Nikolai: Den „Botticelli-Brüsten“ seiner jungen Frau hilflos ausgeliefert, entgeht er kaum einer Erniedrigung. Auf seinen Altersstarsinn, seine Impotenz und Inkontinenz reagiert die enttäuschte Valentina, die ihren westlichen Ehemann monetär und physisch potenter erwartet hatte, mit Schlägen und Beschimpfungen: „Du nichtsnutz Schrumpelhirn und Schrumpelschwanz, Esel. Du eingetrocknet alter Ziegenbockmist.“ Nikolai flüchtet in einen kleinen Verschlag neben der Küche, wo er verwahrlost und unterernährt zur überzeichneten Karikatur verkommen könnte. Tut er aber nicht, denn der „Pulschlag der Liebe“, der ewige Kampf mit dem russischen Vollweib, schenkt ihm neue Geisteskraft und so gelingt dem Ingenieur endlich die Beendigung seines Lebenswerks, die „Geschichte des Traktors auf Ukrainisch“, in dem er über die traurigen Folgen der maßlosen Industrialisierung und die von Stalin angestrebte psychische Formierung des Menschen nach dem Vorbild von technischen Maschinen philosophiert.
Slapstick und Hungersnot
In der gelungenen Verbindung von geschichtlichen und persönlichen Tragödien mit punktgenauer Situationskomik liegt die große Stärke des Romans. Während der mit allen Tricks geführte Scheidungskrieg eskaliert, erfährt Nadja mehr und mehr Details ihrer lange verdrängten Familiengeschichte. Die bitteren Lebensverhältnisse während der Stalin-Diktatur, die Hungersnöte, der blutige Bürgerkrieg werden lebendig, ebenso die Gefangennahme ihrer Eltern und der älteren Schwester durch die Deutschen, die Misshandlungen im KZ und den Waffenfabriken der Nazis. Und Stück für Stück wird das größere Bild sichtbar: Bei allen sozialen und intellektuellen Barrieren zwischen der ungehobelten Valentina und den gebildeten Majevskis gibt es doch eine entscheidende Gemeinsamkeit. In dem energischen Versuch Valentinas, dem Chaos und der Brutalität des kriminellen Raubtierkapitalismus der Ukraine nach dem Zusammenbruch des Kommunismus zu entkommen, spiegelt sich die gelungene Flucht der Majevskis aus den Wirrnissen der Nachkriegsära ins sichere England. Was die einen erreicht haben, soll der anderen mit aller Macht gelingen.
Ironisch, spritzig und organisch verwebt Marina Lewycka Tragödie und Komödie zu einem berührenden Roman, der zu Recht auch in Deutschland den Sprung auf die Bestsellerlisten geschaft hat.
Jan Karsten
Marina Lewycka: Kurze Geschichte des Traktors auf Ukrainisch. DTV, Oktober 2006. Aus dem Englischen von Elfi Hartenstein. 360 Seiten. 14,00 Euro.











