Ein (Werk-) Porträt des Michael Roes
Roman ohne Ufer
Kaum ein deutscher Autor nutzt den Roman gegenwärtig so intensiv als Gattung unbeschränkter Möglichkeiten wie der 1960 geborene Michael Roes. Statt eines linearen Plots mit stetig steigendem Spannungsbogen und der fesselnden Illusion des Tatsächlichen finden wir bei ihm den Schnitt, die irritierende Leerstelle und ein wahres Feuerwerk der Perspektiven und Diskurse – Ethnologischer Forschungsbericht, (Trans-) Gender Studies, Dokument, Literaturkritik und reflexive Selbsterforschung gehen hier eine faszinierende Verbindung mit Elementen des Abenteuerromans und actionreichen „hard boiled“-Passagen ein. Michael Roes macht es dem Leser ganz bewusst nicht leicht und hat das Lesen seiner Romane einmal selber mit einem Marathonlauf verglichen: Am Ende sei man zwar erschöpft, aber doch auch stolz auf das Geleistete.
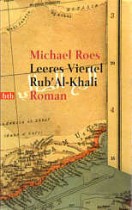 Nach einigen früheren Romanen und Theaterstücken schaffte Michael Roes 1997 den Durchbruch mit „Rub‘ Al-Khali – Leeres Viertel“, das zu einem der meistbesprochenen Bücher des Jahres wurde. In diesem über achthundertseitigen Mammutwerk unternimmt ein junger deutscher Ethnologe eine Forschungsreise in den Jemen, um die dortige Spielkultur zu untersuchen. „Unausgeschlafen, durchgefroren“ besteigt er das Flugzeug, sinniert über die sich unter ihm fortbewegende Welt und beginnt einen in der Herzogin-Anna-Bibliothek in Weimar entdeckten Expeditionsbericht zu lesen. In ihm berichtet ein gewisser Alois F. Schnittke von einer Expedition, die unter dem adligen Mäzen Ernst-Eugen de la Motte in der größten Sandwüste der Welt, der Rub‘ Al Khali, nach den mosaischen Gesetzestafeln suchte. Auf dieser langen Reise sind naturgemäß eine Unmenge von Abenteuern zu bestehen, die auch einem Karl May keine Schande gemacht hätten: Stürmische Seefahrten, Beduinenüberfälle, Pest-Epidemien, Giftanschläge, Meuchelmorde und Verfolgungsjagden. Doch dem promovierten Geisteswissenschaftler Michael Roes, der selber lange Zeit im Jemen lebte, geht es weniger um die äußere Handlungsebene, als vielmehr um die innere Erkenntnis-Reise:
Nach einigen früheren Romanen und Theaterstücken schaffte Michael Roes 1997 den Durchbruch mit „Rub‘ Al-Khali – Leeres Viertel“, das zu einem der meistbesprochenen Bücher des Jahres wurde. In diesem über achthundertseitigen Mammutwerk unternimmt ein junger deutscher Ethnologe eine Forschungsreise in den Jemen, um die dortige Spielkultur zu untersuchen. „Unausgeschlafen, durchgefroren“ besteigt er das Flugzeug, sinniert über die sich unter ihm fortbewegende Welt und beginnt einen in der Herzogin-Anna-Bibliothek in Weimar entdeckten Expeditionsbericht zu lesen. In ihm berichtet ein gewisser Alois F. Schnittke von einer Expedition, die unter dem adligen Mäzen Ernst-Eugen de la Motte in der größten Sandwüste der Welt, der Rub‘ Al Khali, nach den mosaischen Gesetzestafeln suchte. Auf dieser langen Reise sind naturgemäß eine Unmenge von Abenteuern zu bestehen, die auch einem Karl May keine Schande gemacht hätten: Stürmische Seefahrten, Beduinenüberfälle, Pest-Epidemien, Giftanschläge, Meuchelmorde und Verfolgungsjagden. Doch dem promovierten Geisteswissenschaftler Michael Roes, der selber lange Zeit im Jemen lebte, geht es weniger um die äußere Handlungsebene, als vielmehr um die innere Erkenntnis-Reise:
„Wollen wir Nordländer wirklich verreisen, das heisst, uns von dem Eigensten und Heimlichsten entfernen, so reisen wir gen Süden. Nur dort erhoffen wir blassen, in uns gekehrten Eigenbrödler, uns selber zu begegnen. Fremder unter Fremden.“
In immer neuen Ansätzen lässt Michael Roes seine beiden Protagonisten, deren Berichte sich kontrastierend abwechseln und immer wieder irritierende Lücken aufweisen, die Philosophie des Reisens und die damit enge verknüpfte Dialektik von Eigenem und Fremdem, von Heimat und Ferne betrachten:
„Nun bin ich so lange und so weit fort von der Heimat gereist, doch bin ich ihr nicht wirklich entronnen. Vielmehr scheint es, als hätte ich mich in dem gleichen Maße der Entfernung dem Tieferen, dem Eigentlichen des Heimat Genannten angenähert.“
Alois Schnittke, der aus dem „Stand der Musiker, Spötter und Possenreisser“ stammt und die Expedition als Schreiber und Illustrator begleitet, stellt sich im Laufe seines Expeditionsberichtes als ein höchst sympathischer, aufmerksamer und vorurteilsfreier Beobachter heraus. Während seine Expeditionsbegleiter in typisch kolonialer Arroganz die Überlegenheit ihrer westlichen Lebensform behaupten und unbeirrt pflegen, passt er sich den Verhältnissen vor Ort geschmeidig an und wechselt die Perspektive:
„Ich nehme Veränderungen an mir wahr, nicht Äussere, Unbedeutende, nein, Veränderungen der Wahrnehmung an sich. Würde ich meinen Leib mit einem Haus vergleichen, so hätte sich nicht nur die Fassade geändert, sondern das ganze Gebäude befände sich im Umbau, Fenster und Türen werden erweitert, Geschosse aufgestockt, geheime Verbindungen zu anderen Gebäuden hergestellt.“
Und so nimmt Schnittke beispielsweise nicht mehr die von scharfen und fremden Gewürzen stammenden Ausdünstungen der Orientalen wahr, sondern ihm wird im konkreten wie übertragenen Sinne „der vertraute Geruch der Gefährten fremd“ – so „Schlichters Miasmen der Verwahrlosung, Schotenbauers essigsaurer Dunst des Misanthropismus, de la Mottes pomadisierte Aura des Müssiggangs und der Arrogance.“
Ein Postmoderner vor der Zeit
Über den engagierten Aufklärer hinaus ist Schnittke aber auch schon ein Postmoderner vor der Zeit, der den Zerfall feststehender Werte und den Verlust jeglicher Universalität vorwegnimmt:
„Und je mehr ich die Fragwürdigkeit jeder Objektivität erkennen muss, um so mehr scheint mir gerade der ausschmückende und ironisierende Teil die einzige Möglichkeit, der Lüge zu entgehen: Kein ungerührter Chronist berichtet hier, sondern Alois F. Schnittke, der immer schon weiss, ehe er sieht; der immer schon das Worth auf der Zunge hat, ehe er benennt; der reist, um seine Mutmassungen bestätigt zu finden.“
Während Alois F. Schnittke seine anachronistischen Erfahrungen und Erkenntnisse noch in einer blumigen, spöttischen, lustvollen und warmherzigen Sprache niederschreiben kann, sind die Tagebucheintragungen des jungen Völkerkundlers schon unabweisbares Dokument einer zutiefst durchlittenen postmodernen Situation, in der jeglicher (metaphysische) Boden unter den Füßen entwichen ist. Hier wird die Prosa brüchiger, fragmentarischer, wissenschaftlich-kühler und von tastenden, kreiselnden (Selbst-) Reflexionen bestimmt. Die unsichere „conditio humana“ der westlichen Zivilisationen verdeutlicht sich dem jungen Völkerkundler dabei natürlich insbesondere auch durch das tiefe Eintauchen in eine fremde und von ebenso genau beobachteten wie plastisch beschriebenen Werten, Traditionen und Ritualen bestimmten Kultur. Detailliert führen seine Berichte dem Leser das Leben in einer orientalischen Gesellschaft vor Augen, lassen ihn intensivst teilhaben an der lähmenden Hitze, am Inschallah der quatkauenden Männerrunden, an Beschneidungs- und Teezeremonien, an flüchtigen homosexuellen Abenteuern, schwülen Fieber-Deliren und aufkeimenden Freundschaften – ohne jedoch jemals die Illusion zu erzeugen, dass Fremdheit und Einsamkeit auf Dauer überwunden, dass die Gräben zwischen Reflexion und Sein noch einmal zugeschüttet werden könnten. Die Identität des Berichterstatters bleibt unabdingbar ein durchlöcherter und von bunten Flicken übersäter Mantel, seine Existenz hat jede Selbstgewissheit sowie jede gesicherte Beobachter- und Erzählposition eingebüßt – und mit der Aufgabe letzterer scheint auch die auktorial gesicherte „Biographie, eher im sinne von lebensschreibung als -beschreibung, verlorenen gegangen.“
Die Existenz in den westlichen Zivilisationen, die sich in der Fremde erfährt, gleicht letztlich jenem großen Ensemble von verschiedenen Spielen, die der junge Völkerkundler im Jemen kennenlernt und für die er kein System, kein übergreifendes Regelwerk mehr erkennen kann:
„Ist nicht allein im spiel jeder gott vollständig entthront und durch die (all-) macht und schöpferkraft der spielenden ersetzt?“
Michael Roes öffnet mit seiner Prosa, in der sich die Diskurse und Erzählweisen dynamisch abwechseln, einen weiten und offenen Raum voller intellektuellem Esprit – und mit den Längen eines Marathonlaufes ergeben sich vielfache Gelegenheiten für assoziative Abschweifungen in den eigenen Bewusstseinsraum.
 Von assoziativen Abschweifungen lebt auch Michael Roes‘ Psycho- und Gender-Thriller „Der Coup der Berdache“. Ausgangspunkt ist dabei ein bestialischer Anschlag auf einen FBI-Agenten in einem New Leydener (= New Yorker) Sado-Maso-Club, bei der dieser seinen gesamten Skalp, nicht jedoch sein Leben verliert – und dennoch kaum Angaben zu Tathergang und Täter bzw. Täterin machen kann. Um der mysteriösen Chimäre ein Profil zu geben, wendet sich der schwarze Polizeipsychologe Thor Voelcker an die indianische Ethnologin John Bayou und die schillernde Drag Queen Mad Cow. Er kommt dabei schließlich einem ungeheuerlichen Staatskomplott auf die Spur, welches im 2. Weltkrieg seinen Ausgang nahm und fast in einem unerwarteten Showdown á la „Little Big Horn“ endet.
Von assoziativen Abschweifungen lebt auch Michael Roes‘ Psycho- und Gender-Thriller „Der Coup der Berdache“. Ausgangspunkt ist dabei ein bestialischer Anschlag auf einen FBI-Agenten in einem New Leydener (= New Yorker) Sado-Maso-Club, bei der dieser seinen gesamten Skalp, nicht jedoch sein Leben verliert – und dennoch kaum Angaben zu Tathergang und Täter bzw. Täterin machen kann. Um der mysteriösen Chimäre ein Profil zu geben, wendet sich der schwarze Polizeipsychologe Thor Voelcker an die indianische Ethnologin John Bayou und die schillernde Drag Queen Mad Cow. Er kommt dabei schließlich einem ungeheuerlichen Staatskomplott auf die Spur, welches im 2. Weltkrieg seinen Ausgang nahm und fast in einem unerwarteten Showdown á la „Little Big Horn“ endet.
Literatur als Puzzle
Was in den letzten Zeilen linear zusammengefasst wurde, muss sich der Leser des „Coup der Berdache“ allerdings wie ein schwankendes und schwindelndes Puzzle Stück für Stück zusammensetzen und zusammenreimen – denn der Roman besteht allein aus den höchst subjektiven Berichten der drei Protagonisten, die Michael Roes in kunstvoller und nicht-chronologischer Reihenfolge ineinandergeschnitten hat. Indem man nie genau weiß, an welchem Punkt der Zeitleiste und des Handlungsablaufes man sich befindet, entsteht ein schmaler Grat zwischen knisternder Spannung und verwirrender Orientierungslosigkeit – wie der Polizeipsychologe Thor Voelcker ist der Leser über weite Strecken auf die vage Verbindung von Indizien und Vermutungen angewiesen:
„Wir filtern, wir fokussieren, wir blenden aus, ebnen ein, betonen, schärfen, vernetzen unsere Eindrücke. Erinnerte Bilder beeinflussen die gegenwärtigen, Sprache beeinflusst unsere Erinnerung. Geschehnisse werden vereinfacht, gekürzt, umgestaltet, mit Bedeutung belegt.“
Auf der kriminologischen Oberflächenhandlung präsentiert uns Michael Roes in bester hard-boiled-Manier und in Anklang an die einschlägigen Literatur- und Filmklassiker düstere und ungeschminkte Bilder aus dem Großstadtdschungel New Leydens – da prasselt der Regen, huschen Schatten über beleuchtete Fenster und stapelt sich der Müll in Hinterhöfen. Tiefer und tiefer führt er uns in die schwärenden Gedärme der Stadt und seine bizarren Sex-Rituale:
„Eine kleine, von ihm bisher noch unentdeckte Tür führt in den Keller, die ehemaligen Eis- und Kühlräume der Fleischerei. Eine Gruppe von Gästen zieht sich dorthin zurück, um ihre archaischen Riten im Verborgenen zu feiern. Er folgt ihnen aus rein kriminologischen Interesse, da es sich laut Akten um den Tatort im Fall Van Couvering handeln muss. Hier unten herrscht nur noch das polarblaue Licht vor. Der größte Teil der Kachelwände liegt im Dunkeln, an einigen Stellen aber brennen Kerzen oder Fackeln. Dort lehnen Holzbalken an der Wand, zu Gabel- und Andreaskreuzen zusammengebunden. An eines dieser Kreuze ist ein Mann gefesselt, das Gesicht zum Holz. Ein Folterknecht, das eigene Antlitz unter einer schwarzen Ledermaske verbirgen, fährt dem Gekreuzigten mit der geballten Faust in den Anus, langsam, vor und zurück, und immer tiefer in den Leib hinein, bis der Arm bis zum Ellbogen im Darm des Opfers verschwindet. […]
Für eine ungewisse Zeit setzen seine Gedanken aus. Der Vorgang ist von so elementarer Körperlichkeit, dass er die Faust selber in sich zu spüren glaubt […]. Er fährt sich mit beiden Händen über das Gesicht. Nicht die Drastik des Aktes erschreckt ihn, sondern die schwarze Ledermaske des Folterers, die ihm wie ein höhnisches Spiegelbild seiner selbst erscheint. Er wendet sich ab. Dies ist kein Verbrechen, sagt er sich, dies macht ein Verbrechen überflüssig.“
Doch so wenig wie sich das „Leere Viertel“ auf das Genre des Abenteuerromans beschränkt, so wenig beschränkt sich der „Coup der Berdache“ auf das Genre des Krimis. Die zur Aufklärung erstellten Berichte von John Bayou, Mad Cow und Thor Voelcker schweifen vom Plot weit in den inneren Bewusstseinsraum mit seinen unkontrollierbaren Erinnerungen, Assoziationen, Halluzinationen und dunkle Mythen der amerikanischen Urgeschichte ab. Sie umkreisen dabei aus den unterschiedlichsten Perspektiven die Rassen- und Geschlechterordnung sowie die damit verbundenen Differenzen und Verschiebungen, die exemplarisch in der indianischen Figur der Berdache zum Ausdruck kommen:
„Du sagst, es seien keine Transvestiten und auch keine heimlichen Schwulen, die durch den Kleider- und Geschlechterwechsel sich nur vor dem Kriegerdasein drücken wollen. Was sind sie dann?
In einer Kultur mit nur zwei anerkannten Geschlechtern, männlich und weiblich, muss dieses Phänomen natürlich bizarr wirken. Für die Indianer aber hat die Berdache einen klar definierten Platz in der sozialen Ordnung inne: Morphologisch ist sie ein Mann, dem sozialen, dem gesellschaftlich relevanten Geschlecht nach aber ein Nicht-Mann, was nicht mit Frau gleichzusetzen ist.“
Faszinierendes Konglomerat
Michael Roes hat mit dem „Coup der Berdache“ ein faszinierendes und zuweilen auch verstörendes literarisches Konglomerat geschaffen, welches von der klassischen Krimi-Oberfläche über bizzare Geschlechterspiele und Identitätsprobleme bis in die geheimnisvollen Tiefen indianischer Mythen und gegensätzlicher Weltauffassungen reicht. Ohne die Brüche zwischen den verschiedenen Genres und Diskursen zu glätten, spielt er dabei zuweilen bis an die Schmerzgrenze den Kontrast von roher, unmittelbarer Sinnlichkeit und fein verästelter kultureller Reflexion aus. Eines darf man von Michael Roes Romanen nach dieser Lektüre also wohl keineswegs mehr erwarten: Eindeutigkeit.
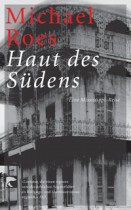 „Haut des Südens“ – Eine brennende Anklageschrift
„Haut des Südens“ – Eine brennende Anklageschrift
„Jeder von uns kann ein Buch über Rassismus schreiben […] Viel schwieriger ist es, ein Buch über Gleichheit und Gerechtigkeit zu schreiben […].“ Diesen Satz aus dem „Coup der Berdache“ hätte sich Michael Roes beim Schreibens seines jüngsten Buches noch einmal vergegenwärtigen sollen. Denn die „Haut des Südens“ – die im Untertitel nicht mehr als Roman, sondern als „Eine Mississipi-Reise“ deklariert wird – erscheint als eine nur notdürftig literarisierte Geschichte der Sklaverei und des Rassismus in den USA, insbesondere der Südstaaten. Es ist im Grunde eine brennende Anklageschrift, die durch ihren oftmals dokumentarischen Charakter betroffen macht, aber auch Wut und Widerstand provoziert – denn unbarmherzig und mit latent erhobenem Zeigefinger bohrt Michael Roes in einer schwärenden Wunde und im Off ist leise ein monotoner „Mea Culpa“-Rosenkranz vernehmbar.
Das fast alibihafte literarische Gerüst bildet in der „Haut des Südens“ die auf den Spuren von Mark Twain, Hermann Melville, William Faulkner und Ernest Hemingway stattfindende Mississippi-Reise eines namenlosen und an einer hässlichen Hautkrankheit leidenden Ich-Erzählers. Seinen Ausgang nimmt der junge Mann, müde mit den Greyhound mitten in der Nacht ankommend, in dem kleinen Ort Hannibal, der bei Mark Twain als St. Petersburg bekanntgeworden ist. Hier trifft er auf ein skurriles Figuren-Ensemble, das den Büchern Mark Twains alle Ehre machen könnte – so der knorrige Heimatforscher Reverend Warfield oder die Buchhändlerin Ann Hermann, die „wie ein Taucher oder Astronaut […] eine aluminiumglänzende Sauerstoffflasche auf dem Rücken“ trägt und in ihrer Freizeit rasante Wasserski-Kunststücke aufführt. Doch mit dem Fortgang der Reise wird das erzählerische Element immer weiter in den Hintergrund gedrängt und es schieben sich mit reichlich Zitaten untermauerte literaturwissenschaftliche Überlegungen zum Werk der amerikanischen (Südstaaten-) Klassiker und ihres Verhältnisses zum Rassismus nach vorne. So wird „Huckleberry Finn“ vor allem als „ein Buch über das Zusammenleben verschiedener Rassen“ und das Schiff Peqoud aus Melvilles „Moby Dick“ als „beispielhafter Mikrokosmos der amerikanischen Gesellschaft, ihrer Mängel, aber auch ihrer Möglichkeiten“, interpretiert. Das hat eine Weile durchaus seinen intellektuellen Reiz und lässt auch einige Bilder früherer Lektüre-Erlebnisse wieder satt und sinnlich aus den Tiefen des Gedächtnisses hervorquellen – doch mit zunehmender Dauer schlägt die weitgehende Inkonsistenz dieses Buches durch. Das, was bei Melville noch gelungen erscheint und auch den Reiz der früheren Bücher von Roes ausmacht, nämlich dass „scheinbar unvereinbare Stimmen und Gattungen nebeneinander koexistieren, ohne dass der Text auseinanderfällt“, das Zusammenführen von „heterogenen Sprachebenen“, das misslingt hier leider zunehmend. Mehr und mehr wird die „Haut des Südens“ zu einer Materialsammlung ohne Fluss und Atmosphäre, in der die grausamsten Fälle des amerikanischen Rassismus dokumentarisch aneinandergereiht werden und in der die sich explosionsartig ausbreitende Hautkrankheit des Protagonisten als übersteigertes Symbol dafür herhalten muss, beschrieben, gezeichnet zu sein: „Was wir in uns tragen, können wir verbergen. Aber nicht, was aus der Haut wächst.“
Schreiben gegen den Trend
Michael Roes‘ bleibt in der „Haut des Südens“ hinter seinen schon unter Beweis gestellten avancierten literarischen Möglichkeiten zurück und lässt durch eine fast manische Fixierung auf den Rassismus und das Anders-, das Aussätzig-Sein, keinen poetischen Frei-Raum für den Leser – fast scheint es, als würde er ganz bewusst den Erwartungen an eine angenehme Lektüre zuwiderschreiben und in den Zeiten einer allgemeinen ästhetischen Verkleisterung und Lifestyle-Literatur das Nicht-Kompatible und Schmerzende ungeniert zur Schau stellen. Zugegebenermaßen unbefriedigt und irritiert klappe ich das Buch zu – und bin doch schon wieder gespannt auf den nächsten Coup des Michael Roes.
Karsten Herrmann
Michael Roes: Rub‘ Al-Khali – Leeres Viertel,
Bertelsmann Taschenbuch (btb) 1998, 828 Seiten,
26 DM ISBN: 3-442-72226-8Michael Roes: Der Coup der Berdache,
Berlin Verlag 1999, Gebunden, 491 Seiten,
44 DM ISBN 3-8270-0313-X
auch als Taschenbuch bei Bertelsmann
Taschenbuch (btb), 490 Seiten,
22 DM ISBN: 3-442-72666-2Michael Roes: Haut des Südens,
Berlin Verlag 2000, Gebunden, 259 Seiten,
36 DM ISBN 3-8270-0366-0











