Dass Damien Hirst und Jeff Koons in diesem Sommer die Reisewege der Kunsttouristen dominieren (neben der documenta, natürlich), hat Michel Houellebecq schon 2010 vorausgesehen und in „Karte und Gebiet“ einen ernsthaften Konkurrenten für sie erfunden. Literatur und Malerei, Teil drei (zu eins und zwei)
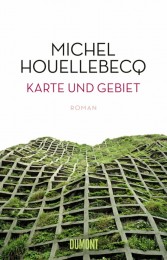 Jed Martin, Autist
Jed Martin, Autist
Punktgenau zu den großen Retrospektiven von Damien Hirst und Jeff Koons in London bzw. Frankfurt ist jetzt die Taschenbuchausgabe von Michel Houellebecqs „Karte und Gebiet“ erschienen. Nicht als folgsames Buch zum Event, sondern als Dokument ergrimmten Widerstands. So nicht! ruft es und beginnt mit der Schilderung eines Doppelporträts, betitelt: „Damien Hirst und Jeff Koons teilen den Kunstmarkt unter sich auf“, die an Deutlichkeit nichts zu wünschen übrig lässt. Hirsts Gesicht hat dort „die typisch englischen Züge eines jener hitzköpfigen, pöbelhaften Kerle, wie man sie von den Fans des FC Arsenal kennt.“ Koons Gesichtsausdruck ist widersprüchlicher, er gleicht einem „pornografischen Mormonen“.
Gemalt hat dieses Bild der Protagonist des Romans, ein französischer Künstler mit dem vielsprachig kompatiblen Namen Jed Martin. „Karte und Gebiet“ ist seine fiktive Biographie. Jed kommt nicht zu Rande mit dem Bild seiner Kollegen, eines Nachts kotzt er darauf und zerstört es schließlich. Inzwischen hat es aber in der Imagination der Leser einen soliden Platz erobert. Und da die Leser bei Houellebecq nach Hunderttausenden zählen, kann hier wohl die Literatur rein quantitativ zu den optischen Künsten aufschließen. Besonders bemerkenswert ist dabei, dass der Autor seinen Helden ein konventionelles Ölbild malen lässt (mit den Mussini-Farben der Düsseldorfer Firma Schmincke übrigens) und tatsächlich glauben macht, dass es etwas taugen könnte.
Jed arbeitet auch mit technischen Medien, vor allem Fotografie und Video. Was ihn von Hirst und Koons unterscheidet und zu einem Spätest-Nachfahren der Romantiker macht, ist das felsenfeste Credo der Einsamkeit. Kein Jet-Set, kein Glamour, keine Freunde, kaum Sex. Der Künstler als genialer Autist: conditio sine qua non des schöpferischen Akts. Als sein Ruhm dem von Koons und Hirst gleicht, flüchtet Jed aus Paris in die Provinz, benutzt seine Millionen zum Bau hoher Mauern und wird endgültig zum Eremiten.
Darin gleicht er dem Schriftsteller Houellebecq, der zweiten Hauptfigur des Romans und Quelle aller Lesefreude. Wortkarg, unattraktiv, ständig erschöpft und ein bisschen spießig, sitzt dieser Schriftsteller im gleichermaßen trüben Irland wie Frankreich und mault. Der Leser sieht ihn immer mit Jeds Augen, aus der Ehrfurchtsperspektive, was einen erheiternden Kontrast bildet zu Houellebecqs elaboriertem Messitum zwischen Umzugskisten und Weinflaschen. Allerdings: dass seine Bücher Meisterwerke sind, bleibt komplett unbezweifelt, da versteht der Autor offenbar keinen Spaß.
Heizkörper
In einer wunderbaren, hochkomischen Szene unterhalten sich Jed und Michel darüber, was sie bzw. ihre jeweilige Kunst mit dem Heizkörper „machen“ würden, neben dem sie sitzen. Der sonst so schweigsame Houellebecq redet sich in Hitze und entwirft mehrere Romane, in denen Heizkörper eine Rolle spielen, wobei er ein staunenswertes Wissen über Heizsysteme, Gusseisengewinnung und Architektenhaftung demonstriert. „‘Ein interessantes Thema, ein echtes menschliches Drama!‘ rief der Autor von Plattform begeistert“, und der Leser beginnt sich schon auf den Gusseisenroman zu freuen. In jedem Fall, antwortet Jed, der Maler: was auch immer ein Autor über Heizkörper schreibe, welche Ideen er damit verfolge, er brauche Personen. Und das sei überhaupt der wesentliche Unterschied zwischen der Literatur und den optischen Medien, welche sich mit den Gegenständen oder überhaupt mit dem Vorhandenen begnügen können. Ihr Problem sei die Fülle der Welt. Auch der rastlos arbeitende und einzig für die Kunst lebende Künstler schaffe nur ein paar Fragmente.
Im Vergleich zu den Wortgebirgen, die französische Theoretiker über l’image und l’écriture, über Zeichen und Bedeutung, différence und différance und überhaupt jedes erdenkliche schöpferische Räuspern in allen denkbaren Medien aufgehäuft haben, ist das vielleicht ein bisschen schlicht?
Aber was kümmert es uns! „Karte und Gebiet“ ist great fun (bis auf die Krimi-Handlung, dem Buch eingepflanzt wie ein Fremdkörper). Munter und meinungsfroh teilt Houellebecq seine leicht verständlichen und unterhaltsam formulierten Urteilsschläge über Kunst und Künstler, aber auch über Sterbehilfe, Automarken und Supermarktketten aus. Sympathisch wie immer ist seine Unerschrockenheit, um cultural correctness schert er sich nicht. Dieser Autor hat als Autor einfach keine Angst, und das ist für seinen Erfolg mindestens so wichtig wie das Leben hinter Mauern. Literarisch innovativ ist das alles nicht, aber während man liest und sich amüsiert, denkt man: muss ja nicht. Intelligent, witzig und auf Augenhöhe mit dem Thema reicht auch und steht zur Zeit ziemlich einzig da.
Gisela Trahms
Michel Houellebecq: Karte und Gebiet (La carte et le territoire, 2010). Aus dem Französischen von Uli Wittmann. Taschenbuch. Dumont 2012. 416 Seiten. 9,99 Euro.











