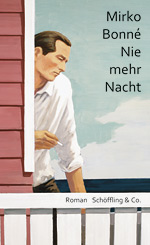 Weg mit der kummervollen Bürde!
Weg mit der kummervollen Bürde!
– „Wie wir verschwinden“ nannte Mirko Bonné seinen 2009 veröffentlichten wunderbaren Roman über zwei französische Jugendfreunde, in dem die Rückblende auf turbulente Erfahrungen verquickt ist mit der Momentaufnahme des tragischen Autounfalls von Albert Camus. Im neuen Roman „Nie mehr Nacht“ beschreibt Bonné die Krise des Hamburger Grafikers Markus Lee, der den Selbstmord seiner Schwester nie verkraftet hat und sich während eines Aufenthalts in der Normandie am liebsten aus dem Leben davonschleichen möchte Von Peter Münder
Mag sein, dass Mirko Bonné, 48, in Hamburg lebender Romancier und Übersetzer der Lyrik von Emily Dickinson, Keats und Yeats, für einige Leser zu anspruchsvoll ist und dazu tendiert, mit Hinweisen auf berühmte Künstler und ihre Werke oder mit Anspielungen auf klassische Romanhelden manchmal zu bedeutungsschwanger aufzutrumpfen. Trotzdem gelingen ihm spannende Plots, differenziert gezeichnete Figuren und brillante Dialoge.
So geht er etwa in „Der eiskalte Himmel“ dem irritierend-beflügelnden Gefühl der Forscher und Abenteurer nach, allmählich während Shackletons legendärer Antarktis-Expedition aus der Welt zu fallen und fängt diese unwirkliche Polar-Szenerie ebenso subtil wie mitreißend ein. Er kann entscheidende Szenen in „Wie wir verschwinden“ wie etwa den am 4. Januar 1960 auf einer verregneten Chaussee bei Villeblevin rasenden, mit dem Verleger Gallimard und Albert Camus besetzten und von einem Schwarm geifernder Krähen verfolgten Facel Vega so eindringlich verdichten und aufladen, dass man sich mitten in einer Tragödie von Sophokles wähnt: Als der rasante Sportwagen schließlich mit hohem Tempo gegen eine Platane kracht und der Beifahrer Albert Camus gestorben ist, scheint sich Zeus‘ lang aufgestauter göttlicher Zorn entladen zu haben. Aber macht es den Hamburger Grafiker Markus Lee, Hauptfigur im neuen Roman „Nie mehr Nacht“, irgendwie sympathischer, interessanter oder dessen Aktionen verständlicher, wenn er mit Gottfried Kellers „Grünem Heinrich“, Heinrich Lee, verglichen wird? Lassen die Anspielungen auf die Landschaftsmaler-Ambitionen des Schweizers uns die Sichtweise des Malers von der Waterkant plausibler erscheinen?
Geradezu kafkaesker, introspektiver Furor
Der Ich-Erzähler Markus beschreibt schon auf den ersten Seiten seine enge, intensive Beziehung zur Schwester Ira, die offenbar depressiv wurde, als beide ihre getrennten Wege gingen: Er studierte Kunst, sie reiste viel in ausländische Metropolen, um dort Sprachen zu erlernen: Portugiesisch in Brasilien, Hebräisch in Israel, auch Französisch und Englisch sprach sie fließend. Dann muss es einen deprimierenden Wendepunkt gegeben haben, als Iras Sohn Jesse geboren wurde und sie sich von allem überfordert fühlte: Sie war alleinerziehende Mutter und wurde so depressiv, dass sie sich behandeln ließ. Marks Tröstungsversuche geraten nur zu hilflosen Floskeln, auch mit Hemingway-Zitaten wie „sicher ist nur, dass kein Pferd mit Namen Trübsal je ein Rennen gewonnen hat“, kann er seiner Schwester nicht weiterhelfen. In ihrer ausweglosen Situation bringt sie sich schließlich um.
Und Markus laboriert an seinen eigenen zermürbenden Schuldvorwürfen mit einem geradezu kafkaesken, introspektiven Furor herum. Auf seine Umgebung, die spießigen Eltern, den inzwischen 15-jährigen Jesse – auf nichts und niemanden kann er mehr unbeschwert zugehen. Als Künstler ist er immerhin ganz erfolgreich: Sein alter Studienfreund gibt ein renommiertes Kunst-Magazin heraus und beauftragt ihn mit Illustrationen anspruchsvoller Beiträge. Ein vielversprechender Auftrag könnte ihn aus seiner düsteren depressiven Phase befreien: Er soll Illustrationen zu einem Beitrag über die wichtigsten, während der alliierten Invasion umkämpften Brücken in der Normandie anfertigen. Da Jesse gleichzeitig von den Eltern seines Freundes in ein leerstehendes altes Hotel in der Normandie eingeladen wird, fährt Mark mit dem Jungen zusammen in seinem Mercedes-Kombi, im Handgepäck Kellers „Grüner Heinrich“, an die alten Kriegsschauplätze bei Bayeux und Omaha Beach. „Wir waren uns nicht gerade von Herzen zugetan“, erklärt Mark sein Verhältnis zu Jesse, „doch weil meine tote Schwester in ihm fortlebte, liebte ich ihn.“ Und tatsächlich ergibt sich nach anfänglichen Streitereien eine fast harmonische Beziehung zum sensiblen, intelligenten Jungen.
Da sind wir auch schon mitten drin in Bonnés unwiderstehlichem Erzählsog: Er fabriziert nämlich keine gefälligen Floskeln oder leicht antizipierbare Plot-Wendungen, sondern eher kapriziöse Überlegungen und Entscheidungen des eigenwilligen Hamburgers.
Schaffenskrise, Sinnkrise, Selbstzweifel, Schuldgefühle, Identitätskrise? Gerade als sich Markus im leerstehenden Hotel und im Kreis der interessanten einhütenden Patchwork-Familie pudelwohl fühlt, fällt er plötzlich in ein tiefes depressives Loch und wird desorientiert und antriebslos. Markus hat zufällig in einem Kaufhaus ein Foto entdeckt, auf dem er seine Schwester zu erkennen glaubt, und steigert sich in den Wahn, an der französischen Küste Bekannte und Freunde ausfindig machen zu können, die Ira damals gut kannten. Die Suche verläuft erfolglos; wahrscheinlich treibt diese Enttäuschung Markus dazu, alles hinter sich zu lassen, seinen Besitz wegzugeben oder zu verschenken – auch seine Papiere und Ausweise, sogar sein Konto will er auflösen und einfach irgendwo abtauchen. Vielleicht wäre England als „Last Exit“ ideal, wo ihn niemand kennen würde? Ohne Ballast will er zu neuen Ufern aufbrechen bzw. sich einfach nur treiben lassen. Seine Illustrationen hat er aufgegeben – die Brücken hatte er zwar inspiziert, doch die Geschichten über die dort gestorbenen jungen Soldaten fand er viel spannender und anrührender als die Bauwerke selbst, die er prompt mit dümmlichen Graffiti besprüht.
Einer der wenigen ganz großen deutschen Gegenwartsautoren
Das von Bonné in früheren Büchern thematisierte Verschwinden aus der Welt hängt offenbar mit dem Wunsch zusammen, den banalen Ballast abzuwerfen, der einen nur belastet: Nicht nur den materiellen Plunder, auch die zermürbenden Erinnerungen an seine Schwester, die ihn geradezu paralysierten. Aber die Auflösungserscheinungen erfassen auch seinen innersten Kern: „Alle kummervolle Bürde verlor an Gewicht, wenn man begann, niemand mehr zu sein. Ein Kilo wog vielleicht noch vierhundert Gramm, mehr nicht. Ich nahm mir vor, einen Plan zu fassen, was mit mir geschehen sollte.“ Mit einer fatalistischen Schicksalsergebenheit lässt er sich treiben – mal sehen, wohin die Kugel des großen Weltenlenkers rollt.
Markus trifft dann doch noch eine neue Liebe, es gibt nach einer überraschenden Volte, die seine Beziehung zur Schwester betrifft, ein beinah euphorisches Happy End in der Hamburger Kunsthalle, das auf einen neuen künstlerischen Schub des Illustrators hinweist. Begeistert legt man schließlich diesen großartigen Roman zur Seite, der einen noch lange beschäftigt. Und plötzlich überfällt einen die Erkenntnis – wenn man sich etwa eins dieser impressionistischen Landschaftsbilder von Alfred Sisley vor Augen führt, die Bonné im Roman so genau beschrieben hat: Dies ist, trotz einiger überraschender und mitunter düster-larmoyant anmutenden Sentenzen, einer der wenigen ganz großen deutschen Gegenwartsautoren, der mit einer eindringlichen Ernsthaftigkeit Krisen und beglückende Situationen, Figuren und Ereignisse beschreibt, die uns faszinieren und bewegen.
Nie unterschätzt Mirko Bonné den Leser, nie biedert er sich mit Mainstream-Plattitüden an. „Nie mehr Nacht“ ist einfach ein fabelhaftes und doch so unscheinbar und unspektakulär daherkommendes Meisterwerk.
Peter Münder
Mirko Bonné: Nie mehr Nacht. Schöffling Verlag 2013, 354 Seiten. 19, 95 Euro. Bild des Autors: Wikimedia Commons, Autor: Amrei-Marie, Quelle.












