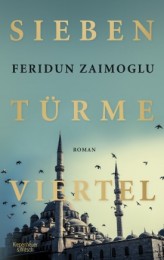 Wenn Wolf zu Kurt wird
Wenn Wolf zu Kurt wird
— Feridun Zaimoglus neues Epos entführt uns in eine fremde Welt, in der sich auch der Protagonist erst einmal zurechtfinden muss. Von Andreas Pittler
Wolf ist ein kleiner Junge, als er Hals über Kopf aus Deutschland fliehen muss, da die Nazis hinter seiner Familie her sind. Er landet im Haus eines Geschäftspartners seines Vaters im Istanbul des Jahres 1939, wo er, in bizarrer Umkehrung der Realität, als Nazi wahrgenommen wird. „Hitlersohn“ und „Arier“ sind daher die Spitznamen, die Wolf erst einmal bekommt, und es wird lange dauern, bis er endlich zum „Kurt“ wird, was nicht etwa eine neue Taufe darstellt, sondern schlicht das türkische Wort für Wolf.
Zunächst also ist Wolf ein Außenseiter. Und das noch dazu in einem Viertel, das selbst ein Außenseiter unter den Stadtteilen Istanbuls ist. Das „Siebentürmeviertel“, türkisch Yedi Kule, entstand rund um jene schroff-abweisende Festung, in denen die Sultane ihre ärgsten Feinde einzukerkern pflegten. Und so wohnen dort nur jene, die sich nichts Besseres leisten können. Arme Händler, Taglöhner und die Angehörigen diverser nationaler Minderheiten, die eben auch an den Rand der Gesellschaft gedrängt sind.
Eine solche Soziostruktur ist nicht dazu angetan, Konflikte im Konsenswege zu lösen. Im Gegenteil. Die Sitten sind rau unter Tschetschenen, Armeniern, Juden, Zigeunern und Griechen. Vor allem, wenn man nirgendwo dazugehört. So verwundert es wenig, dass Wolf just unter jenen erste Freunde findet, die selbst „anders“ sind. Cenk, der sich nach einigen erotischen Debakeln seine Homosexualität eingesteht, und Derya, die ebenso schöne wie hingebungsvolle Kommunistin, nehmen Wolf als Mensch, ungeachtet seiner Herkunft, seines Ausländer-Seins. Und da ist dann auch noch Frau Senay, die kluge Lehrerin, für die Wolf bald mehr empfindet als die Begeisterung für ihre Unterrichtsmethoden.
Und während Wolf zwischen Auseinandersetzungen, jugendlichen Abenteuern und romantischen Sehnsüchten heranwächst, spitzt sich draußen in der Welt die finale Konfrontation zwischen dem Nationalsozialismus und der Anti-Hitler-Koalition zu. Die Türkei versucht sich, so gut es eben geht, aus dem Konflikt herauszuhalten, doch das bedeutet nicht, dass nicht auch die Bewohner Istanbuls für die eine oder andere Seite Partei ergreifen. Der große Krieg in der Welt findet seine Widerspiegelung im Kleinen zwischen Moschee, Bazar und Hamam.
Im zweiten Teil des Buches erleben wir Wolf, mittlerweile um 10 Jahre gealtert, als jugendlichen Möchtegern-Helden, der vor allem endlich selbst Sex haben will. Dazu heckt er so manchen Plan aus, entwirft Strategien und pirscht sich an diverse Frauen heran, in der Hoffnung, endlich einmal geschlechtlich verkehren zu können. Alles andere, das Ende des Krieges, das eigentlich seinen Aufenthalt am Bosporus überflüssig macht, seine eigene Identität, die nicht mehr wirklich deutsch, aber doch auch noch nicht türkisch ist, interessiert ihn weit weniger. Die Frauen, das ewige Mysterium. Zumindest aus der Sicht eines Pubertierenden.
Star der gegenwärtigen Literaturszene
Der 50jährige Feridun Zaimoglu ist einer der unumstrittenen Stars der gegenwärtigen Literaturszene. Kaum ein Buch aus seiner Feder, das nicht sofort mit Dutzenden Preisen überschüttet wird. Dies nicht zuletzt auch deshalb, weil er seine eigene Person – Deutscher mit Migrationshintergrund – perfekt zu inszenieren weiß. Mal macht er den Wahlmann für die Grünen, dann tritt er wieder für einen konservativen Islam ein, ganz nach dem Geschmack der jeweiligen gesellschaftlichen Gruppe, die er gerade bedienen will, möchte man meinen.
Und gerade dieser sein Grundzug, es allen rechtmachen zu wollen, ist vielleicht auch das Grundproblem des vorliegenden Romans. Er ist zu überbordend, zu zerfasert, zu weitschweifig. Es ist garantiert ein lobenswertes Ansinnen, ein Viertel und eine bestimmte Zeit in allen Facetten darlegen zu wollen, doch in unserer unmittelbaren Lebenswirklichkeit halten wir einen solchen Anspruch ja auch nicht aus. Wir blenden Dinge, die uns weniger interessieren aus und wenden uns dafür denen zu, die bestimmte Empfindungen in uns auslösen. Und wir wissen vielleicht, dass in unserer Straße hunderte Menschen leben, aber wir kennen davon höchstens ein paar Dutzend, von denen wiederum höchsten ein, zwei Dutzend wirklich zu unseren Bekannten oder Freunden zählen.
Und so hat Zaimoglu des Guten entschieden zu viel. Zu viele Personen, zu viele Handlungsstränge, zu viele Abschweifungen. Und letztlich auch zu viele Seiten, nämlich derer 794. Hier hätte Straffung und Fokussierung der Geschichte durchaus gut getan, zumal sich einige Bilder immer wieder wiederholen, und das durchaus nicht aus einem didaktischen Impetus heraus. Schließlich greift auch die Idee, eine Art umgekehrte Integrationsgeschichte zu schreiben – statt Türken in Deutschland eben Deutsche in der Türkei – nicht wirklich, denn genau diese entscheidende Frage wird immer wieder durch andere, zum Teil sehr vordergründige, überdeckt. Man könnte auch sagen: um genau diese Kernfrage drückt sich Zaimoglu 800 Seiten lang herum.
Was aber nicht heißt, dass das Buch nicht auch seine Stärken hätte. Wer Istanbul mag, wer vielleicht sogar schon einmal in Yedikule war (wie etwa auch der Autor dieser Zeilen), der kann ob der pittoresken Schilderungen der markanten Gebäude, der Straßen und Gassen leicht ins Schwärmen kommen. Die Legenden und Sagen, die Zaimoglu wie nebenbei in seine Erzählungen einstreut, sind ebenso poetisch wie literarisch wertvoll, und das Personal des Buches – nun, zumindest die wesentlichen Protagonisten – wächst einen, ob man nun will oder nicht, mit der Zeit so richtig ans Herz.
Auf „Siebentürmeviertel“ muss man sich einlassen. Es ist kein Buch, das man schnell einmal während einer Zugsreise konsumiert, es verlangt Konzentration und Auseinandersetzung. Dann erschließt es sich einem auch – mit all seinen Widersprüchen. Und dann ist es trotz mancher Schwäche auch ein literarischer Gewinn.
Bleibt die Frage, warum der Verlag sich dazu entschieden hat, nicht die malerische Festung Yedi Kule aufs Cover zu geben, sondern die Süleymaniye, und warum die Namen im Buch nicht im türkischen Alphabet wiedergegeben werden, sondern in einer seltsam anmutenden deutschen Lautschrift (Dschenk statt Cenk, Schenay statt Senay etc.). Da hätten sich Autor und Verlag durchaus ein wenig mehr ins Türkische integrieren können.
Andreas Pittler
Feridun Zaimoglu: Siebentürmeviertel. Kiepenheuer & Witsch Köln 2015. 798 Seiten. 24,99 Euro.
P.S.: In seinem Roman behauptet Zaimoglu, die Griechen würden die Festung „Fünf Türme“ nennen, weil angeblich nur fünf der sieben Türme aus byzantinischer Zeit stammen. Doch die griechische Bezeichnung ist „Heptapyrgio“, also ebenfalls „sieben Türme“ – von denen übrigens nur vier von den Byzantinern stammen.











