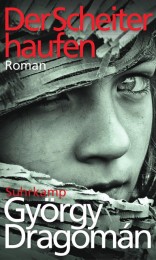 Die große Leere
Die große Leere
− György Dragomán beweist in seinem neuen Roman „Der Scheiterhaufen“, dass Demokratie mehr sein muss als bloß ein neues Etikett auf einer alten Flasche. Von Andreas Pittler
Emma ist 13 und verwirrt. Plötzlich steht da eine alte Frau, die behauptet, ihre Großmutter zu sein. Die Eltern sind bei einem Autounfall ums Leben gekommen, und Emma hat nichts mehr als ein paar vage Erinnerungen, also folgt sie der Frau in eine fremde Stadt. Dort erfährt sie, dass auch ihr Großvater tot ist. Ermordet, erzählt die Oma, von einem fanatischen Mob, der in ihm einen Spitzel der kommunistischen Staatssicherheit sah. Und wie fanatisch der Mob zwei Jahre nach der Ermordung von Nicolae Ceauşescu sein kann, erlebt Emma an ihrer neuen Schule gleich zu Beginn. Ihre Mutter war eine begabte Turnerin, die Rumänien bei diversen internationalen Meisterschaften, ja sogar bei Olympia, vertrat. Und so trägt Emma voller Stolz das Trikot, das ihr die Mutter einst geschenkt hat. Die Turnlehrerin aber bekommt einen Tobsuchtsanfall, zwingt Emma, das Trikot auszuziehen und reißt diesem sodann das alte Ceauşescu-Wappen heraus, sodass der Dress unbrauchbar wird. Diese Säule der neuen, europäischen Demokratie beweist sogleich mit menschenverachtenden Schindermethoden am Sportplatz, dass ein politischer Systemwechsel noch lange kein Ende finsterster Methoden bedeuten muss.
Das Rumänien des Jahres 1991 ist ein merkwürdiges Land. Die alten Werte zählen nicht mehr, neue sind nicht in Sicht. Die Menschen haben keine Ahnung, wonach sie sich richten sollen und tappen zwischen alt angelernten Stereotypen und tollpatschigen Versuchen, sich als westliche Demokraten zu erweisen, durch eine Landschaft, die nach dem Untergang des realen Sozialismus erst so wirklich untergeht. Wer kann, flüchtet ins Ausland, andere leben von erbärmlicher Subsistenzwirtschaft, während ein paar findige Opportunisten, jäh gewendete Systemstützen allesamt, sich eine goldene Nase verdienen, indem sie den Vorgaben der neoliberalen EU folgen.
Für Emma bleibt völlig unverständlich, was da vorgeht. Praktisch alle Erwachsenen haben schreckliche Geheimnisse, biegen sich die eigene Vergangenheit zurecht, wie sie es gerade brauchen und weisen eifrig darauf hin, dass der jeweils andere nichts als Lügen erzählt. Halt findet Emma nur in ein paar Gleichaltrigen, die gleich ihr Außenseiter sind, und in der Großmutter, die ihr bald ans Herz gewachsen ist.
Und als wäre der große Umbruch zu Ende des Jahres 1989 nicht schon schwer genug zu verdauen – vom Verstehen gar nicht zu reden -, so stellt sich nach und nach heraus, dass die Großmutter noch ihre ganz eigene Geschichte hat, die in die Zeit des Zweiten Weltkriegs zurückreicht, da sie mit ihren Eltern jüdische Flüchtlinge vor den Nazis versteckt hat. Auch diese „Geschichte“ eine Tragödie. Emma, die langsam begreift, dass sie vom Mädchen zur Frau wird, würde sich viel lieber ihrer eigenen Pubertät und vor allem ihrer aufkeimenden Liebe zu Peter widmen, doch das Rumänien der neuen Demokratie ist kein Ort für Romantik und Gefühle. Der Mensch erweist sich dem Menschen als Wolf, ist der Schrecken aller Schrecken, egal, welchem politischen Wahn er zu seiner Rechtfertigung auch immer anführt.
Sparsam, aber umso gewaltiger
Man kann dem 1973 in Targu Mures geborenen György Dragomán nicht vorwerfen, ein Vielschreiber zu sein. 2002 veröffentlichte er seinen ersten Roman, der gleich wie eine Bombe einschlug. Mit kaum erträglicher Lakonie schildert er drei Tage im Leben eines zum Militär eingezogenen Architekten, der so Zeuge einer Massenvernichtung wird. Nachdem dieses Opus mit nennenswerten Preisen gewürdigt worden war, verschrieb sich Dragomán erst einmal der Übersetzung und brachte Beckett, Joyce und Ian McEwan in ungarischen Fassungen auf den Markt. 2005 folgte dann sein zweiter Roman, „Der weiße König“, der in zahlreiche Sprachen übersetzt und von der internationalen Kritik hymnisch gefeiert wurde. Daraufhin brauchte Dragomán beinahe zehn Jahre, ehe er seinen dritten Roman, „Der Scheiterhaufen“ eben, der Öffentlichkeit übergab. Und man kann getrost sagen, das lange Warten auf das neue Werk hat sich mehr als gelohnt.
„Der Scheiterhaufen“ ist eine literarisch hochwertige Autopsie eines gescheiterten Landes. Und wie schon in seinen beiden ersten Romanen bleibt sich Dragomán auch diesmal treu. Eine ruhige, unaufgeregte Sprache, eine beinahe bukolisch wirkende Langsamkeit in der Erzählung, eine überaus behutsame, bedächtige Wortwahl lässt gerade ob dieser idyllischen Anklänge die Schrecken der Wirklichkeit umso deutlicher zutage treten. Wohin man blickt, tun sich Abgründe auf, die nur deshalb nicht mehr erschüttern, weil man sie zeitlebens gewöhnt ist. Die Finsternis, die das Leben prägt, sie ist für jene, die in ihr leben, so selbstverständlich und natürlich wie die Schatten an der Höhlenwand für die Gefangenen in Platons Gleichnis. Und Dragomán kennt mit seiner Leserschaft kein Mitleid. Er zwingt sie, genau hinzusehen. Jedes einzelne Wort zu lesen. Jeder Satz ein Pfahl im Fleische jener, die sich unsere neue Welt gerne schönreden würden. Die Zeit, so lehrt er uns, heilt keine Wunden. Sie verursacht sie vielmehr. Immer und immer wieder.
Die Lehre vom Kommunismus als Paradies auf Erden mag sich als große Illusion erwiesen haben. Doch ersetzt wurde sie durch eine große Leere der (Pseudo-, Post-, was auch immer-)Demokratie. In diesem moralischen Vakuum müssen die Menschen sich zurechtfinden – die Großmütter wie die Enkelinnen. Oder, um es mit dem von Dragomán ins Ungarische übersetzten Samuel Beckett zu sagen: man kann nicht weitermachen, man muss weitermachen.
György Dragomán: Der Scheiterhaufen (Magyla). Aus dem Ungarischen von Lacy Kornitzer. Suhrkamp Verlag, Frankfurt/Main 2015. 494 Seiten. 24,95 Euro.











