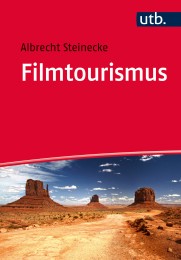 Basiswissen für Filmtouristen
Basiswissen für Filmtouristen
Breaking-Bad-Cocktail in Albuquerque probieren, Aschenbrödels Haselnüsse in Moritzburg suchen, den Weinkeller in Downton Abbey inspizieren: Was fasziniert an Reisen zu bekannten Film-Locations? Über Albrecht Steineckes Filmtourismusführer. Von Peter Münder
Auch in diesem Jahr tummeln sich wieder Tausende von Touristen an nordirischen Schauplätzen wie Castle Ward, Dark Hedges, Dragonstone oder Audleys Castle, um als echte Thronies die abgelegenen und verwunschenen Drehorte der „Game of Thrones“ TV-Serie zu besichtigen. Viele Thronies tragen dabei auch Kostüme, die von den Schauspielern im Film benutzt wurden, man sieht inzwischen immer mehr touristische Reiter und auch Bogenschützen, die hier begeistert in die Mittelaltersaga eintauchen. Andere Filmfans reisen nach Barcelona, um die Locations aus dem Streifen „Vicky Christina Barcelona“ kennenzulernen, Fans der trällernden Trapp-Familie, die den vor fünfzig Jahren gezeigten Musikfilm „The Sound of Music“ bewundern, machen Busrundfahrten durch Österreich und singen dabei die aus dem Film beliebten Songs. Die Beispiele für den Besuch von Film-Locations lassen sich beliebig fortsetzen – von Hobbit-Touren nach Neuseeland bis zur blauen Tür im Londoner Notting Hill, vom „Breaking Bad“-Nest Albuquerque, wo sogar „Blue Ice Candy“ als Crystal-Meth-Imitat angeboten wird, bis zur deutschen Destination für Wilsberg-Fans. Offenbar sind nicht mehr spannende Lektüre-Erlebnisse wie „Budenbrooks“ oder „Die Blechtrommel“ Auslöser für diese Form von Kulturtourismus, sondern Filme, die meistens nachhaltigere Wirkungen ausübten.
Um diese Effekte des Filmtourismus auszuloten und ihnen genauer auf die Spur zu kommen, hat der Tourismusforscher Albrecht Steinecke, der als Professor an der Uni Paderborn (inzwischen ist er emeritiert) bereits einen faszinierenden Reader über das Phänomen „Dark Tourism“ (Besuch von düsteren Destinationen wie die Killing Fields in Kambodscha, Kriegsschauplätzen, Auschwitz usw., hier gehts zur CM-Rezension) veröffentlichte, diesen für Studenten und Tourismusexperten gedachten Band verfasst. Steinecke wertet Besucherumfragen und Statistiken aus, die verblüffende Resultate liefern: Siebzig Prozent aller japanischen England-Touristen gaben an, dass ihr Interesse am England-Besuch durch Filme geweckt wurden – Bücher, Reiseführer, Prospekte usw. spielten keine so große Rolle. Am meisten genannt wurden TV-Serien wie „The Adventures of Sherlock Holmes“, „Agatha Christie’s Poirot“, die „Harry Potter“-Filme und „Notting Hill“. Dazu erklärt Steinecke, dass viele der Befragten aufgrund dieser selektiven medialen Erfahrungen den stereotypen Eindruck gehabt hätten, dass Großbritannien ein besonders traditionsreiches Biotop mit reizvollem kulturellem Erbe und höflichen Menschen in idyllischen Dörfern und Kleinstädten sei. Tja, Film und Realität – das war schon immer ein weites Feld …
In einigen Fällen ist der Vorher-Nachher-Effekt besonders stark: So war etwa nach der Premiere von „Vier Hochzeiten und ein Todesfall“ das „Crown Hotel“ in Amersham für drei Jahre ständig ausgebucht. Nach der TV-Serie „Stolz und Vorurteil“ hatte sich die Besucherzahl in Lyme Park von 1994 auf 1995 verdreifacht. Legendär ist inzwischen auch der Ansturm ausländischer Rucksacktouristen auf die thailändische Insel Phi Phi nach der Premiere des Films „The Beach“.
Als simples Erfolgsmodell für brachliegende, unterentwickelte Tourismuszonen könne man den Filmtourismus laut Steinecke jedoch nicht bezeichnen: Bei besonders aufwendigen Produktionen, die das Leben in kleineren Kommunen beeinträchtigten, gab es Protestaktionen mit Hupkonzerten sowie aggressive Übergriffe gegen Filmcrews, Autos und Bühnenbilder. „Baywatch“ konnte aus diesem Grund nicht im australischen Küstenort Avalon gedreht werden, sondern musste die Location an die Gold Coast in Queensland verlagern.
Bemerkenswerte positive Effekte, die über den rein kommerziellen Effekt hinausgingen und von engagierten Besuchern der Schauplätze von zwei beliebten chinesischen TV-Serien („Soldier Sortie“ und „My Chief an My Regiment“) ausgelöst wurden, nennt Steinecke auch: Die Besucher organisierten sich in Online-Foren, sammelten Geld und veranstalteten Charity Sales für den Bau von Schulen und um notleidenden Kriegsveteranen zu helfen.
Statistiken, Exkurse, historische Rückblicke vertiefen alle wichtigen Aspekte des Filmtourismus. Wer weiß schon, dass der kleine Ort Juliet/Georgia in den frühen 1990er Jahren nur vier Einwohner hatte, als der Film „Fried Green Tomatoes“ dort gedreht wurde und damals keine Geschäfte oder Betriebe dort existierten? Doch nach dem Film gab es einen regelrechten Boom mit jährlich über 100.000 Besuchern und einer Neuansiedlung von Unternehmen und einem Anstieg der Einwohnerzahl auf 2800. Und das florierende „Whistle Blow Cafe“ firmiert inzwischen als „Home of the Fried Green Tomatoes“.
Dieser erste deutsche Studienführer zum Thema Filmtourismus versteht sich vor allem auch als praktischer Hands-on-Guide und liefert dementsprechend handfeste Tipps zu Merchandising und Marketing, zu Schnittstellen mit anderen Tourismusarten, Location Placement als Marketing-Strategie, Destinationsmanagement usw. Ausführliche Literaturlisten, Stichwortregister und viele Illustrationen machen das Buch zum faszinierenden, unterhaltsamen Kompendium, in dem man immer wieder gern blättert und sich dann schnell festliest.
Peter Münder
Albrecht Steinecke: Filmtourismus. UVK Verlagsgesellschaft Konstanz 2016, 252 Seiten. 24,99 Euro.














