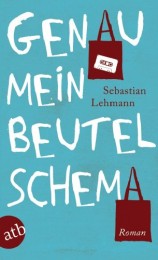 Dezente Hipster-Häme
Dezente Hipster-Häme
– Der Debüt-Roman des Berliner Autors dekonstruiert mit Witz und Verve den Hipster-Mythos, das Berlin-Image als große Spielwiese und illustriert die Erweiterung prekärer Arbeitsverhältnisse fernab des Billig-Lohnsektors. Von Ronald Klein
Die Mauer war gerade gefallen, Techno-Klänge eroberten ungenutzte Keller und Lagerhallen. Nebenan spielten Punkbands in Hinterhof-Clubs und Galerien, die junge Künstler für sich entdeckt hatten. Öffentliche Räume wurden besetzt und nach Gusto gestaltet. Berlin war in den 90er-Jahre der große Abenteuerspielplatz, der Raum für Experimente und einen Lebensstil bot, den sonst die Mauer in Köpfen, die Ost wie West den bürgerlichen Alltag lenkte, verhinderte. Die Stadt lebt noch immer von diesem Image.
Mit der Realität hat es dieses jedoch nur noch wenig gemein. Während einst unterschiedliche, oftmals auch konträre Subkulturen ihre Nische fanden, die in der Regel den Mainstream, wenn schon nicht explizit ablehnten, so zumindest kaum Schnittmengen zum gesellschaftlich Akzeptiertem oder kommerziell Nutzbarem boten. Langsam, aber schleichend erkauften und erklagten Labels, die längst auch die Alltagskultur in New York, London und Paris dominierten, den öffentlichen Raum. Die Vertreter der Subkulturen, mittlerweile als „hängen geblieben“ verlacht, verschwanden wieder aus dem öffentlichen Straßenbild und wurden durch „Hipster“ ersetzt. Im Gegensatz zu den „Hängengebliebenen“ erweist sich diese Klientel als durchaus konsumfreudig und weniger renitent, wenn es um Eingliederung in etablierte Strukturen geht: Arbeiten, Essen, Fernsehen. Obwohl als Avantgarde des urbanen Lebensstiles gefeiert, spiegelt sich in Ihrer Mode, ihrem Musikgeschmack und den Freizeitgewohnheiten die Sehnsucht nach der Heimeligkeit der Kindheit. Mit anderen Worten, die Reizüberflutung der Metropole wird durch ein Koordinatensystem aus Zeichen und Symbolen aus der Zeit des Aufwachsens entschleunigt.
Mit deutlichem Entsetzen realisiert Mark, Protagonist in Sebastian Lehmanns Romandebüt „Genau mein Beutelschema“, dass in den Neuköllner Kellerclubs genau die Musik läuft, der er in den 90er-Jahren in den Großraum-Discos aus dem Weg gegangen ist: Euro-Trash. Dr. Alban erschien damals schrecklich und auch im Alter von 30 Jahren, folglich mit gehörigem zeitlichen Abstand, und einem hohen Alkohol-Pegel kann Mark den Klängen des rappenden Zahnarztes aus Schweden nichts abgewinnen. Jedoch begegnet er an einem dieser drögen Abende Christina, so nennt er seine Bekanntschaft aufgrund ihrer optischen Ähnlichkeit mit Christina Aguilera. Die junge Frau arbeitet für einen Musik-Major, der sich vor einigen Jahren an der Spree niederließ. Selbst am Wochenende springt sie freudig an den Schreibtisch und konterkariert Marks nöligen Kommentar bezüglich Selbstausbeutung: „Das ist doch keine Arbeit. Das macht mir Spaß!“ Sie führt Mark in die Welt der Hipster mit schicken Undercut-Frisuren. Eine Welt, die aus Galerie-Eröffnungen, Bars ohne Namen und viel Reminiszenzen an die 90er-Jahre besteht, die jedoch „post-ironisch“ verwendet werden. Oder kulturwissenschaftlich ausgedrückt: Die doppelte Codierung wird invers verwendet. Noch Fragen?
Mark arbeitet bei einem großen Stadtmagazin als Kleinanzeigen-Redakteur und wohnt in Tiergarten. Das ist so ziemlich der unhippste Stadtbezirk innerhalb des S-Bahn-Rings, der das oben beschriebene Berlin-Image ausmacht. Vororte wie Britz, Mariendorf oder Heiligensee unterscheiden sich hinsichtlich ihres Aufregungs-Faktors nicht wesentlich von Braunschweig, Paderborn oder Münster. Dank Christina verbringt Mark mehr und mehr Zeit in Neukölln, entdeckt auf dem Hipster-Accessoire Jutebeutel Botschaften, die ihn scheinbar direkt ansprechen. Und plötzlich scheint die Zeit aus den Fugen: Marks Chef bricht aus seinem überschaubaren Journalisten-Alltag aus und flüchtet in eine verdrogte Spät-Hippie-Kommune in die Sächsische Schweiz. Christina verliert schließlich ihren Job und entgeht einem Amoklauf in der Plattenfirma. Gleichzeitig verschwinden immer mehr Hipster aus Neukölln und wachen plötzlich in Tiergarten auf, ohne sich erinnern zu können, wie sie dorthin gelangten.
Witziger Berlin-Roman
Sebastian Lehmann ist seit langem Star der Berliner Lesebühnen und Poetry-Slams. Ihm gelingt ein flüssig lesbarer und vor allem witziger Berlin-Roman, der sich jedoch in der nuancierten Beobachtung der Veränderung in der Stadt deutlich von den Genre-Kollegen abhebt. Der Text verweigert sich der Harmlosigkeit, die viele Fast-Food-Romane auszeichnen, die als literarische Debüts getarnt in die Läden drängen und letztlich doch nur die Aneinanderreihung von Plattitüden und Belanglosigkeiten darstellen. Stattdessen oszilliert „Genau mein Beutelschema“ anfangs zwischen Medien-Satire und dezenter Hipster-Häme. Angenehm dabei der Ton: Lehmann gerät nicht in die Falle, Berliner gegen Zugezogene auszuspielen. Wichtiger erscheint das Aufzeigen der Bedingungen und Möglichkeiten, in denen agiert wird. Die prekären Verhältnisse des Kultursektors spielen dabei ebenso eine Rolle wie die Sozialisation der Protagonisten, dessen Kenntnis ihr nicht immer nachvollziehbares Handeln zumindest ein Stück weit verständlicher macht. Die eigentliche Protagonistin bleibt jedoch die Stadt selbst, in der sich langsam aber eine stetig eine bedrohliche Atmosphäre zusammenbraut, die in ihrer Intensität an Tim Staffels Meilenstein „Terrordrome“ erinnert. Jedoch erfolgt quasi vor dem Klimax ein Plot-Twist. Für einen kurzen Augenblick scheinen die Antinomien auflösbar. Mark glaubt, einer Verschwörung riesigen Ausmaßes auf die Spur gekommen zu sein.
Doch Lehmann liegt nichts daran, den gordischen Knoten zu durchtrennen. Nur für einen Augenblick offenbaren sich Antworten auf Fragen, die sich in den ersten zwei Dritteln des Textes aufbauten. Doch die vermeintlichen Antworten sind nichts als Hypothesen, und so wird man sich des Glatteises bewusst, auf das das Verlangen, sämtliche Vorgänge linear erklären zu wollen, führt. Mit diesem Gefühl entlässt das Buch seine Leser. Lehmann porträtiert letztlich nicht nur eine Szene, die auf die 90er-Jahre referiert, sondern lässt diese in einer Matrix agieren, die kulturwissenschaftliche Diskurse dieser Dekade ausmachten und illustriert deren reale, das Alltagsleben betreffende Manifestation anhand kleiner Beobachtungen und Anekdoten, die geschickt in die Dramaturgie des Romans eingewebt wurden: Fragen nach einer allgemeingültigen Realität, der wechselseitigen Beeinflussung von Selbst-Inszenierung und gesellschaftlich normierten Rollenbildern sowie der Frage nach Hyperrealität und Authentizität.
Ronald Klein
Sebastian Lehmann: Genau mein Beutelschema. Aufbau Verlag, Berlin. 234 Seiten,. Taschenbuch 8,99 Euro, eBook 6,99 Euro.











