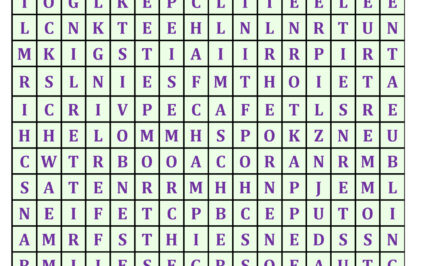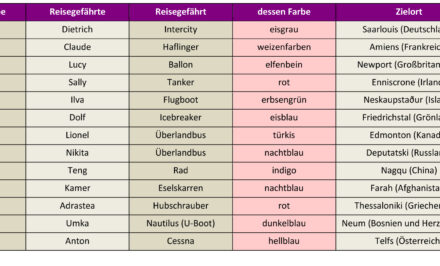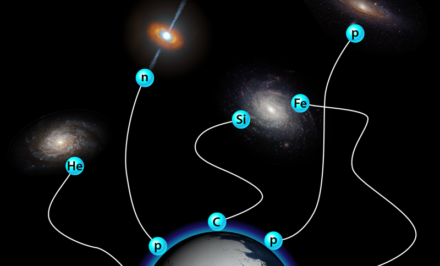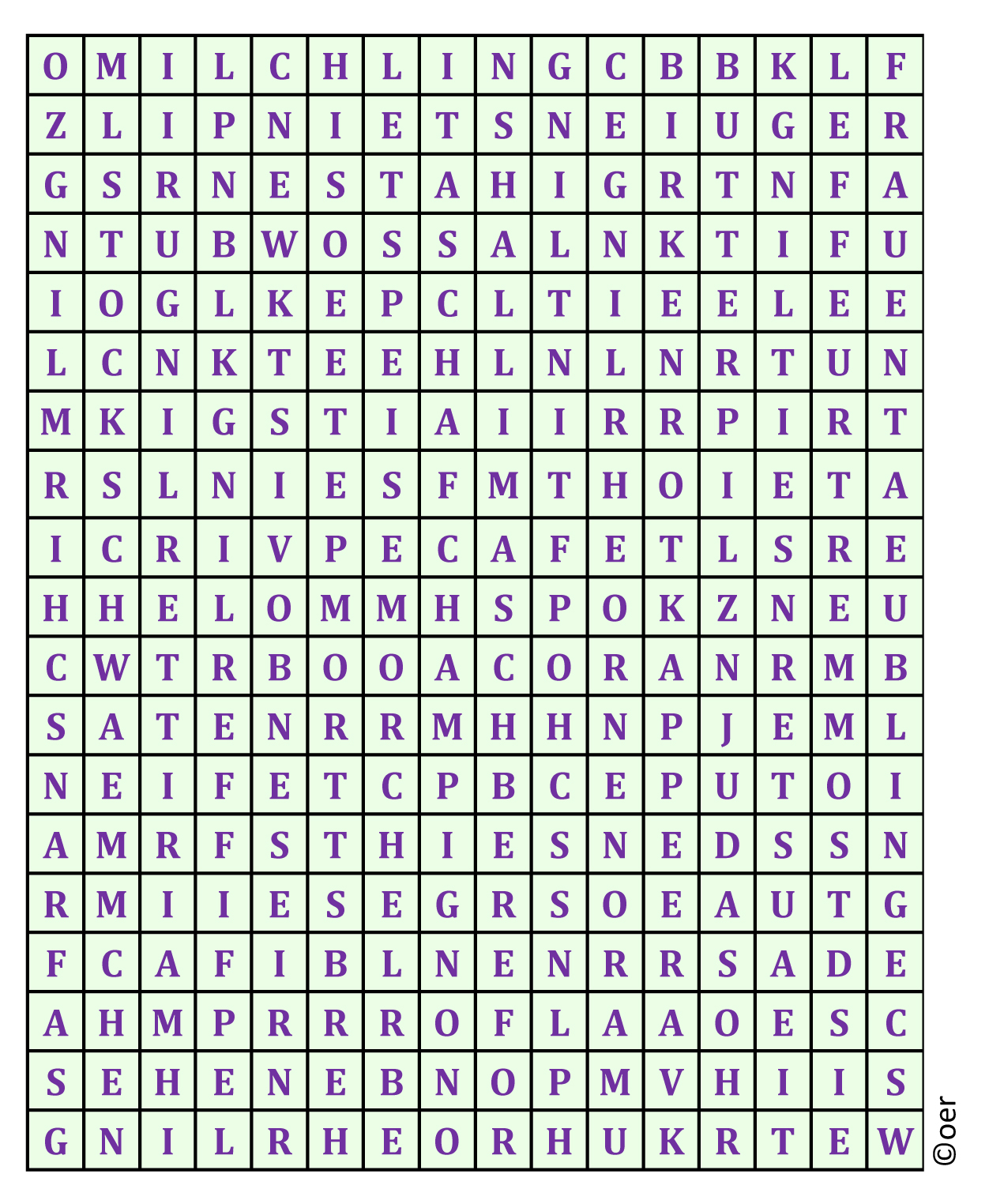Verweile doch, du bist so schön!
Verweile doch, du bist so schön!
Bereits zum Erscheinen der Originalausgabe wurde auch bei uns in Deutschland viel über Simon Reynolds „Retromania“ diskutiert. Nun hat der Popjournalist die deutsche Ausgabe seines Buches auf einer Lesereise präsentiert, Joe Paul Kroll war in Frankfurt mit dabei.
„Übersättigung einer Zeit in Historie“, so die bekannte Klage, sei nicht nur „dem Leben feindlich und gefährlich“, sondern besonders der Kunst. Ganze Welten künstlerischen Ausdrucks waren noch gar nicht entdeckt worden, als es Friedrich Nietzsche vor einem Übermaß der verfügbaren Historie graute. Doch mit dem, was da an Neuem kam – insbesondere mit dem, das im Laufe des 20. Jahrhunderts unter der Rubrik „Pop(ulär)kultur“ subsumiert wurde, wuchs auch die Menge dessen, was (um wieder mit Nietzsche zu sprechen) „wiedergekäut“ und zum Stoff für Antiquare werden konnte. Nietzsche deutete indessen an, dass „der Glaube, Spätling und Epigone zu sein“, selbst nicht neu sei. Tatsächlich könnte man darin nur eine weitere Form des Endzeitglaubens vermuten und in diesem den Versuch, der eigenen Zeit wenigstens im Negativen Bedeutsamkeit anzudichten.
Diese Möglichkeit gibt der Popkritiker Simon Reynolds im Gespräch gerne zu. Doch in seinem jüngst auf Deutsch erschienenen Buch „Retromania“ hat er eine Fülle von Phänomenen beschrieben, die den Verdacht, der Autor betreibe selbst nur grantelnde Kulturkritik, entkräftet. Nun ist „Retromania“, das schon bei Erscheinen der Originalausgabe 2011 auch im deutschen Feuilleton auf erstaunliche Resonanz stieß, kein durchgängig theoretisch argumentierendes Buch. Dies hat ihm der deutsche Popintellektualismus mitunter schwer verübelt. Zwar lässt Reynolds seinen Gegenstand gerne von einschlägigen Denkern illuminieren, ob nun von Gilles Deleuze oder Oswald Spengler, aber weit wichtiger sind Reynolds seine eigenen Beobachtungen aus Alltag und Popkultur. Den Vorwurf, selbst ein Wühler in den Archiven der Popgeschichte zu sein, sucht er denn gar nicht erst von sich abzulenken. Simon Reynolds steht als Kritiker nicht über den Dingen, und seine eigene Affiziertheit ist es wohl, die ihrerseits starke Reaktionen bei den Lesern hervorruft.
Nerv getroffen
Der Rezensent gibt gerne zu, bei der ersten Lektüre große Begeisterung und Anregung verspürt zu haben, und einigen Zuhörern im Frankfurter Club „Orange Peel“, wo Reynolds gegen Ende einer Lesereise durch den deutschsprachigen Raum über sein Buch sprach, ging es anscheinend nicht anders: Fragen an den Autor wurden zu Statements, als breche sich gestauter Mitteilungsdrang Bahn. Was sonst schnell ärgerlich wird, erschien hier jedoch eher als geradezu rührender Beleg dafür, welcher Nerv hier getroffen wurde. Dies steht nicht nur zur Entlastung der Redner an diesem Abend, sondern auch zu jener des Rezensenten.
Es gehört zu den Eigenheiten von Reynolds’ Buch, dass es die Vielzahl der Retro-Phänomene nicht auf einen Begriff bringt, sondern von einem Befund ausgeht: „pop and the museum don’t go together“. Das Museum ist aber nicht nur in Form der British Music Experience in der Londoner O2-Arena zu besichtigen, oder der Rock and Roll Hall of Fame in Cleveland, Ohio, sondern auch in Subkulturen von Rockabilly über Northern Soul bis hin zu japanschen Retro-Punks. Ihren Stoff erhalten diese Vergangenheitssüchtigen von einer Reissue-Industrie, die von Boxsets berühmter Künstler bis hin zu Neupressungen obskurster Vinylsingles den Markt ständig mit brandneuen Antiquitäten versorgt.
Vor lauter Subkultur-Miniaturen läuft Reynolds’ Sozialkritik Gefahr, übersehen zu werden – vielleicht auch, weil sie nur verhalten artikuliert wird. Doch er geht auf das mit „Prolls“ nur unzureichend übersetzte „Chav“-Phänomen, das er als Nostalgieverweigerung der Marginalisierten deutet, ebenso ein wie auf die wirtschaftlichen Aspekte einer Industrie, in der Originalität als Unberechenbarkeit gefürchtet wird. Besonders spannend wird es aber, wo Reynolds auf die „Nostalgie nach der Zukunft“ zu sprechen kommt, welche die Kehrseite der Retromanie ausmache: Die jüngst auch von David Graeber artikulierte Enttäuschung ob des Ausbleibens einer Zukunft, die einem in der Kindheit viel aufregender geschildert wurde – und vor allem: ganz anders, mit fliegenden Autos und Städten auf dem Mond. Doch der Fortschritt hat andere Akzente gesetzt, er hat, so Graeber, die Mittel bevorzugt, mit denen sich die Effizienz des kapitalistischen Systems optimieren lässt: Techniken der Organisation und der Überwachung, schnellere Prozessoren und geräumigere Festplatten, und damit – um zu Reynolds zurückzukehren – auch diejenigen Technologien, welche dem Fundus des Vergangenen zu ständiger Verfügbarkeit verhelfen.
Retro ist demnach eine kulturelle Erscheinung, die sowohl teilhat an der schlechten Unendlichkeit des Neoliberalismus als auch diffuses Unbehagen an ihr zum Ausdruck bringt – etwa, indem die Zukunftsvisionen der 50er und 60er Jahre selbst zum Gegenstand nostalgischer Sehnsucht werden. Dass Reynolds das Einsetzen der ersten großen Retro-Welle auf 1973 datiert, auf das Jahr der ersten Ölkrise und ein Jahr nach dem Bericht des Club of Rome – beides Fanale eines nicht nur ins Stocken geratenen, sondern in seinen Voraussetzungen fragwürdig gewordenen Fortschritts – ist ein Umstand, der näher zu beleuchten wäre.
Dinge verkörpern ein Lebensgefühl
Noch eine zweite Dialektik innerhalb der Retromanie lässt sich feststellen: Der Begriff umfasst sowohl die minutiöse Nachahmung der Vergangenheit als auch die Herauslösung bestimmter Gegenstände aus ihrem ursprünglichen Kontext – womit insbesondere ihr ökonomischer Kontext gemeint ist: „Retro is a vision of a world in which commodity production has come to a halt, in which objects have been handed down, not for our consumption, but for our care“, schreibt der amerikanische Literaturwissenschaftler Christian Thorne. Gegenstände aus der Massenproduktion – und damit wohl auch Produkte der Kulturindustrie – werden so mit einer sekundären Aura versehen, die zu den Bedingungen ihres Entstehens im Widerspruch steht.
Statt von den marxistischen Implikationen dieser These soll jedoch hier vom Begriff „care“ ausgegangen werden, den Thorne hier gebraucht. Cura wird im Deutschen gemeinhin als „Sorge“ übersetzt, und es ließe sich wohl behaupten, aller Retromanie liege eine Sorge zugrunde: Die Sorge, dass in einer sich scheinbar beschleunigenden Gegenwart allein die Vergangenheit einen festen Bestand, einen sicheren Besitz darstellt, der seinerseits Gegenstand der Sorge wird, die ihn vor dem Verschwinden zu erretten sucht. Die Dinge sollen ein Lebensgefühl verkörpern: „Verlorene Momente, für die Ewigkeit eingefangen“, wie es bei Reynolds heißt. Retro versucht, die Einsinnigkeit der Zeit aufzubrechen, wo diese als unzumutbar empfunden wird, und es wählt dafür die Sphäre, in der die Wünsche des kollektiven Unterbewusstseins ihren Ausdruck finden: die Popkultur.
Von der Wurzel cura leitet sich auch der Begriff des von Berufs wegen um die Gegenstände Sorgenden ab, des Kurators also, dem Reynolds ein Kapitel widmet. Gab es Kuratoren bis vor kurzem nur in Museen, so hat sich der Begriff im letzten Jahrzehnt auf die Gestalter von Festivals ausgedehnt, etwa des Meltdown, das jährlich in London veranstaltet wird und bei dem namhafte Musiker wie David Bowie, Elvis Costello oder Ornette Coleman die Programmverantwortung übernehmen. Der Künstler wird also seinerseits zum auswählenden, die Landschaft ordnenden Kenner – eine Tendenz, der im kleinen die „Kuratierung“ der eigenen Plattensammlung entspricht, die wiederum in die ebenso sorgsame Auswahl der Vorbilder bei avancierten Popmusikern münden kann.
Distinktion durch die Abwegigkeit eines Samples
An diesem Punkt setzte Reynolds’ Frankfurter Vortrag ein, der nicht aus einer Lesung aus dem Buch bestand, sondern in einer Fortführung einiger darin enthaltener Gedanken- und Themenstränge. Reynolds sprach davon, wie in der Underground-Szene des vergangenen Jahrzehnts ein archäologischer Zugang zum Musikmachen vorgeherrscht habe und das beträchtliche künstlerische Selbstbewusstsein dieser Bewegung nicht aus dem Anspruch hergeleitet habe, die Zukunft zu gestalten, sondern aus der immer raffinierteren Anverwandlung der Popgeschichte bezogen habe. So seien zum Rohstoff für Sampling, Mashups und Remixes nicht nur marginale Genres wie Gothic und New Age geworden, sondern auch frühe Formen noch vitaler Musikrichtungen, etwa des House. „Hipster House“ klinge wie 1991, sei aber – durchaus mühevoll! – 2011 entstanden. Wo die Vergangenheit so gründlich erschlossen ist, lasse sich Distinktion nur durch die Abwegigkeit des Samples erreichen. Gute, unverschnittene Vergangenheit sei zunehmend knapper Stoff.
Die Theoretiker, so Reynolds, könnten zwar behaupten, alles sei ein Remix und sei es schon immer gewesen – die deutschen Zuhörer werden wohl an die Debatte um Helene Hegemann gedacht haben – doch er spüre selbst, wie resistent gegen alle Dekonstruktionsversuche Vorstellungen von Originalität und gar Genialität seien. Und Originalität habe es in der Popgeschichte tatsächlich gegeben: Als Beispiel ließ Reynolds „Drugs“ von den Talking Heads erklingen, sich wohl bewusst, dass sich Kritiker fänden, welche das Schaffen der Talking Heads auf ihre Einflüsse reduzieren würden: Die haben doch nur von Fela Kuti und Lee „Scratch“ Perry geklaut!
Hier machte sich allerdings auch die Notwendigkeit einer genaueren Begriffsbestimmung bemerkbar, an deren Fehlen auch die Hegemann- und andere Plagiatsdebatten gekrankt haben: Es wäre zu unterscheiden zwischen Plagiat, Zitat, Anspielung und Anverwandlung und zudem festzustellen, dass alle diese Verfahren sich sowohl in der Literatur als auch in der Musik ausmachen lassen, aber nicht problemlos übertragbar sind, weil sich Verfahren und Struktur der jeweiligen Kunstformen unterscheiden. Noch schwieriger wird es, wenn Begriffe wie Mashup und Remix, die sich außerhalb ihrer Entstehungssphäre noch nicht bewährt haben, wie Totschlagargumente in den Diskurs eingeführt werden.
Simon Reynolds übt hier Zurückhaltung. Zwar zeige, wer Nachahmt, dass er den Mut verloren habe, doch er spreche sich in „Retromania“ keineswegs gegen Bezugnahmen aus. Worauf es aber ankomme sei, das Material zu verdrehen, verformen, ja zu beschädigen. Das ist das Gegenteil eines kuratorischen Verhältnisses zur Vergangenheit. Ob sich mit diesem Programm die paradoxe Sehnsucht unserer zeitgenössischen Kultur nach einer stets in der Vergangenheit erahnten Gegenwart stillen lässt – darüber macht Reynolds keine Voraussagen. „Ich glaube immer noch, dass die Zukunft da draußen liegt.“ – Dieser Schlusssatz klingt etwas wie eine nachgeschobene Beschwörung in einem Buch, dessen eher pessimistischen Charakter sein Autor an diesem Abend in Frankfurt freimütig zugibt. Doch wenn Simon Reynolds in „Retromania“ mehr Fragen aufwirft, als er zu beantworten vermag, dann ist es gerade dieses Undogmatische, Tastende und für die mannigfachen Erscheinungen der Popkultur Offene, das den Reiz, das ungemein Anregende seines Buches ausmacht.
Joe Paul Kroll
Simon Reynolds: Retromania. Warum Pop nicht von seiner Vergangenheit lassen kann (Retromania: Pop Culture’s Addiction to Its Own Past, 2011). Übersetzt von Chris Wilpert. Ventil Verlag, Mainz 2012. 424 Seiten, 29,90 Euro.