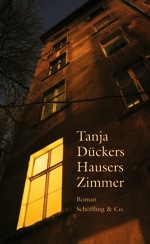 Westberlin, frühe 1980er-Jahre
Westberlin, frühe 1980er-Jahre
– Die 14-jährige Julika ist in ihren Nachbarn verknallt. Sie und ihre Freundinnen verzieren Mauern und Buspolster mit geheimen Zeichen. Und Julika will auswandern, am liebsten in ihr Sehnsuchtsland Patagonien. Mit dieser Protagonistin hätte man einen ganz normalen, handelsüblichen Coming-of-age-Roman gestalten können, circa 250 Seiten lang. Die Berliner Schriftstellerin Tanja Dückers aber hatte mit ihrer Erzählerin Julika Zürn (der Name erinnert gewiss nicht zufällig an die Künstlerin Unica Zürn) anderes vor: Nichts weniger als ein 500 Seiten dickes Denkmal Westberlins der frühen 1980er-Jahre ist „Hausers Zimmer“ geworden. Von Christina Mohr
Über zehn Jahre arbeitete Dückers an diesem Buch, das vielleicht eine Autobiografie ihrer Teenagerzeit ist, vielleicht aber auch nicht. Wie sehr die Autorin Dückers in das Leben von Julika Zürn und das Leben in Westberlin/Wilmersdorf verstrickt ist, sei dahingestellt, aber sie kennt sich in beiden gut aus. Mit beeindruckender Akribie beschreibt Dückers die Jahre 1982/83, öffnet ein Panoptikum aus Markennamen, Dingen und Orten: Chipsletten und Ahoj Brause, Neue Deutsche Welle und Neonohrringe, Bleibtreustraße und Kurfürstendamm, Witboy und Grips-Theater, Anti-Atomkraft-Sticker und Eddingstifte illustrieren die Szenerie.
Genauso wichtig: Politik. Julikas kunstbegeisterte Eltern verfolgen gebannt Radio- und TV-Nachrichten, diskutieren über den Nato-Doppelbeschluss, sauren Regen und den Kalten Krieg. Und Westberlin? Ist eine Insel im unbekannten Osten, die ihre Bewohner zu etwas Besonderem macht. „Restdeutschland“ nennt Julikas Vater seine alte Heimat despektierlich und Julikas Freundin Isa vergießt dicke Tränen, als sie mit ihrer Mutter in „den Westen“ umziehen muss. Westberlin ist die eigentliche Protagonistin in „Hausers Zimmer“, man fährt mit dem Bus durch Wilmersdorf und Charlottenburg, ätzt mit Julika über die „Ku’dammladies“ mit ihren festgesprayten Haartürmen, bestaunt den Rumpf der Gedächtniskirche und stromert mit der Erzählerin über Hinterhofmüllhalden und durch die riesige, labyrinthische Altbauwohnung, in der Julika mit ihren Eltern und ihrem Bruder Falk lebt.
Obwohl sich Dückers’ Beschreibungen von Orten, Tätigkeiten und Personen oft wiederholen und gleichen, langweilt man sich paradoxerweise nie. Man verschlingt „Hausers Zimmer“ trotz seiner Mängel wahrscheinlich deshalb, weil man sich an das eigene Leben als Schülerin erinnert und weiß, dass Gleichförmigkeit die Tage bestimmte.
Großer Roman mit Schwächen
Dennoch: Vieles in „Hausers Zimmer“ wirkt konstruiert, als hätten verschiedene Details unbedingt untergebracht werden müssen, weil der Autorin sonst entscheidende Teile zum 80er-Jahre-Puzzle gefehlt hätten. Die ständig durch den Hinterhof dröhnende „Polonäse Blankenese“ zum Beispiel oder die allgegenwärtigen Ratten, die Julikas Berlin schier aufzufressen drohen. Oder die konkurrierenden Hinterhofkünstler Herr Olk und Herr Kanz, die ihre dilettantischen Werke im Hof ausstellen. Und dann die vielen Toten, die es zweifelsohne gab, hintereinander notiert, wirkt es grotesk, wenn „The Wiebkes and the Klauses“ (Julikas und Falks Spitzname für die Eltern) in schier endloser Agonie die verstorbenen Breschnew, Peter Weiss, Rainer Werner Fassbinder etc.pp. betrauern und darüber die Bedürfnisse ihrer Kinder vergessen.
Häufig verfällt Dückers in klischeehafte Beschreibungen, obwohl sie eine äußerst genaue Beobachterin und Chronistin ist: Röcke „wallen“ oder „rascheln“ grundsätzlich, der alte Scirocco „klappert“ bei höherer Geschwindigkeit, die Eltern wollen sich mit Vornamen anreden lassen, zum braunen Emaille-Teeservice gehören selbstverständlich Räucherstäbchen. Das mag im Einzelfall stimmig sein, in der Ballung ist es manchmal zu viel des Guten und Bekannten. Julika selbst ist ein wenig seltsam (sie züchtet Kakteen, lernt Flussnamen auswendig, hört Simon & Garfunkel und ist an Mode nicht interessiert), aber nicht einsam. Sie hat Freundinnen, siehe oben, und einen Verehrer aus ihrer Klasse – mit dem sie eine missglückte Liebesnacht verbringt. Der anschließende Beziehungs- bzw. Schlussmachdialog zweier 14-Jähriger gehört zum Unglaubwürdigsten, was die Rezensentin je gelesen hat, aber vielleicht kannte sie in ihrer Jugend einfach nur ganz andere Leute. Auch Julikas Faszination für „den Hauser“ ist nicht ganz nachvollziehbar. Der Kontrast Intellektuellenkind/Prolet ist zwar ersichtlich, aber Julikas Liebe zum langhaarigen Rocker bleibt ein Konstrukt.
Kurzum: Trotz oder gerade wegen seiner Schwächen ist „Hausers Zimmer“ ein großer Roman, der die Geschichte Berlins in den 80er-Jahren nachzeichnet, ohne sich dabei zu verheben.
Christina Mohr
Tanja Dückers: Hausers Zimmer. Frankfurt a. M.: Schöffling Verlag 2011. 496 Seiten. 24,95 Euro. Zur Homepage der Autorin geht es hier, eine Leseprobe finden Sie hier.











