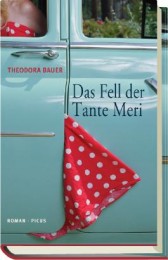 Vorschusslorbeeren
Vorschusslorbeeren
– Eine Studentin legt im Alter von 23 Jahren ihr Debut vor, das in Österreichs Medien hymnisch gefeiert wird. Damit tut man ihr nichts Gutes. Von Andreas Pittler
Theodora Bauer erzählt in ihrem Romanerstling „Das Fell der Tante Meri“ von drei Personen, die in unterschiedlichen Epochen leben. Während Ferdl 1986 angesiedelt ist, agieren Anni 1943 und „Karl“ unmittelbar nach Kriegsende. Ziel der Autorin war es offensichtlich, eine Art Familiensaga zu entwerfen, denn es stellt sich im Verlauf der Handlung natürlich heraus, dass die Schicksale der drei Menschen miteinander verwoben sind. An sich also eine gute Grundidee für einen Roman.
Doch nicht alles, was eine Idee ist, wird auch Literatur. Mit erschreckender Unbefangenheit – man kann es auch Unbedarftheit nennen – geht die junge Autorin an ihr Thema heran. Beim Ferdl beispielsweise werden am Wirtshaustisch die Gegner Kurt Waldheims (des umstrittenen Präsidentschaftskandidaten) „Vaterlandsverräter“ genannt, die titelgebende „Tante Meri“ fordert im selben Jahr 1986 gar die restlose Ausrottung der „vermaledeiten Judengfraster“. Die Anni wiederum ist froh, einen Galan zu haben, der hochrangiger SS-Offizier ist, während „Karl“ schlicht „deutsche Würde“ ausstrahlt.
All das könnte ja eine kathartische Wirkung beabsichtigen: indem die Figuren sich durch ihre Äußerungen selbst entlarven, erzielte der Roman eine pädagogische Wirkung. Die Frage aber ist: kann er das, wenn solche Aussagen eingebettet werden in Sätze wie „Allesamt waren sie dunkel im Gesicht und hatten diesen stechenden Blick in den Augen, der sagte, dass sie nichts mehr zu verlieren hatten. Nicht einmal ihr Leben bedeutete diesen Individuen noch sonderlich viel“ oder die Charakterisierung von Tante Meri als „im Grunde genommen liebe Person“. Auch Annis Anbandeln an den SS-ler wird neutral rapportiert, und zum Häuptling des Nazivereins heißt es: „Er war ein herber Charakter, aber von aufrechter Gesinnung.“ Die Antwort auf obige Frage fällt da nicht automatisch positiv aus.
Man erwartet sich bei einem Roman sicherlich keinen erhobenen Zeigefinger, aber Charaktere wie die in diesem Buch geschilderten sollten doch ein wenig deutlicher hinterfragt werden, da sonst jeder noch so gut gemeinte Impetus leicht in sein Gegenteil verkehrt werden kann. So ist zum Beispiel Karls vergebliche Suche nach anderen Nazis in Südamerika völlig unglaubwürdig. Er eilt von einer deutschen Kolonie zur nächsten und erntet überall nur strikten Antifaschismus. Träfe dies zu, müsste eine Menge Geschichtsbücher neu geschrieben werden.
Aber Sattelfestigkeit in Sachen Geschichte ist ohnehin nicht die Stärke dieses Buches. An einer Stelle erinnern den Ferdl (1986, wohlgemerkt) die schwarzen Haare seiner Gesprächspartnerin an „eine Bosnierin“ – unwahrscheinlich, dass jemand 1986 zwischen den verschiedenen Nationalitäten Jugoslawiens unterschieden hätte. Noch schlimmer wird es freilich, wenn im Zusammenhang mit dem Parteileben der NSDAP plötzlich von „Seminaren der Partei“ die Rede ist, welche Karl besucht habe, was schlicht historische Unwissenheit offenbart.
Dazu kommen dann auch noch massive Unsicherheiten in der Sprache. Dreimal „jetzt“ in einem deskriptiven Absatz dient wohl keiner Demonstration außer jener, dass das Buch einen Lektor gebraucht hätte. Gleichfalls nicht sonderlich elegant: „Nach einem freundlichen Wortwechsel ließ er einige Andeutungen fallen, die vielleicht deutlicher gewesen waren, als sie unter anderen Umständen gewesen wären.“ Oder um ein anderes Beispiel zu bemühen: „Karl machte einige Schritte in Richtung eines großen Zimmers, das sich vom Treppenabsatz öffnete. Er glaubte, es als Esszimmer zu identifizieren. Von drinnen hörte er Besteckklappern.“ Was hier als niveauvoll durchdacht daherkommen will, erweist sich doch nur als prätentiös.
Und dass Personen, deren Gemüter gelinde gesagt als simpel charakterisiert werden, Begriffe wie „pittoresk“ oder „Hybrid“ in ihrem Gedankenrepertoire haben, scheint auch wenig glaubwürdig. Zu bemüht wirkt zudem der Versuch, Ferdl und Anni als „schlichte Menschen“ in der Vergangenheitsform (er hat gedacht, er ist dann gegangen), „Karl“ aber im Imperfekt (er dachte, er ging) zu beschreiben. Das mag auf den ersten Blick witzig, ja vielleicht sogar innovativ erscheinen, aber für einen Roman von 200 Seiten verfängt diese Strategie nicht. Vielmehr verraten Sätze wie „Mit dem Schlafzimmer hat es so etwas auf sich gehabt. Der Ferdl hat dort eigentlich nicht hineindürfen“ primär Wolf Haassches Epigonentum.
Mit all dem soll freilich nicht gesagt werden, Theodora Bauer möge vom Schreiben die Finger lassen. Nein, die Probleme liegen ganz entschieden außerhalb der Einflussmöglichkeiten Bauers und haben mit mehr als fragwürdigen Entwicklungen im Literaturbetrieb zu tun. Zum ersten ist in den letzten Jahren ein merkwürdiger Jugendkult entstanden, wonach jeder Jungautor (wohl eher jede Jungautorin) umso mehr Starpotential hat, je jünger er/sie ist. Schon vor gut zehn Jahren versuchte Zsolnay mit Rosemarie Poiarkov diesen „Zeitgeist“ in der Literatur in klingende Münze umzuwandeln und scheiterte daran. Theodora Bauer wird es nicht anders ergehen. Und zwar aufgrund der zweiten negativen Entwicklung im Literaturbetrieb: dem allgemeinen Einsparen.
Anstatt sich – und der Autorenschaft – Zeit einzuräumen, aus einer guten Idee, einem vielversprechenden Exposé ein gutes Stück Literatur zu erarbeiten, wird im Husch-Pfusch-Verfahren aus einer Word-Datei ein Buch geschnitzt und auf den Markt geworfen. Lektor? Korrektor? Überarbeitung der Charakterzeichnung und der Entwicklungslinien der Geschichte? Wozu, kostet zu viel Zeit und vor allem zu viel Geld, das besser in die Werbung eingesetzt wird, damit das Publikum auch unfertige Bücher bereitwillig kauft.
Eine kurzsichtige Strategie, denn sie hilft niemandem – die Leserschaft ist (wie der Schreiber dieser Zeilen) enttäuscht, die Autorin über den ausbleibenden Erfolg erstaunt und der Verlag beim nächsten Mal hoffentlich klüger.
Im konkreten Fall hätte man Bauers Manuskript zum Ausgangspunkt für eine umfassende Reflexion nehmen können. Die Geschichte ist ja nicht unspannend – aber erzählt sie sie mit den richtigen Mitteln? Mit der richtigen Sprache? Mit dem nötigen Hintergrundwissen? An all diesen Punkten krankt es bei „Das Fell der Tante Meri“. Und zwar unnötiger Weise. Eine revidierte Ausgabe hätte vielleicht jenes Lob wirklich verdient, das in Österreich über das Buch – voreilig, will mir scheinen – hereingebrochen ist.
Bleibt zu hoffen, dass Theodora Bauer das Schicksal von Rosemarie Poiarkov, die 2001 regelrecht verheizt worden war, erspart bleibt und sie ihre literarischen Ideen künftig in einer Art umsetzen kann, die Vorschusslorbeeren durch echten Lorbeer ersetzen lässt.
Andreas Pittler
Theodora Bauer: Das Fell der Tante Meri. Picus-Verlag, Wien 2014. 200 Seiten. 19,90 Euro.











