Ein Buch, zwei Lesekonsequenzen: Während Karsten Herrmann den Roman als „furioses Literaturspektakel“ euphorisch begrüßt, hat Gisela Trahms die Lektüre entnervt abgebrochen.
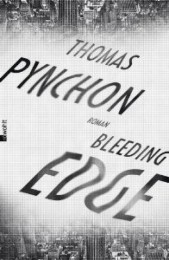 Unfassbar cool
Unfassbar cool
Thomas Pynchon, die Galionsfigur des postmodernen Romans, ist einer der bedeutendsten und zugleich unsichtbarsten Vertreter der Gegenwartsliteratur. Seit Jahrzehnten gibt es von dem studierten Physiker keine öffentlichen Auftritte und noch nicht einmal Fotos. Zahlreiche Gerüchte und Geheimnisse ranken sich um den offenbar wie ein Geist durch seine Heimatstadt New York streifenden 77-Jährigen, der jetzt mit wieder einem großen Roman über die Wochen nach dem Platzen der Dotcom-Blase und den Anschlägen von 9/11 ans Licht der Öffentlichkeit tritt.
Nehmen wir es vorweg: „Bleeding Edge“ ist ein furioses Literaturspektakel, eine brillant geschriebene, berauschende Symbiose aus Postmoderne, Pop und Trash. Enzyklopädisch surft Pynchon mit virtuoser Wortgewalt und sprühendem Witz durch die Gischtkronen der Gegenwart und ihrer Diskurse, springt leichter Hand von der sinnlichen New Yorker Straßencollage über weitreichende popkulturelle Bezugssysteme zur abstrakten Psychoanalyse des Otto Kugelblitz.
Nach diesem ist die Schule der beiden Kinder von Maxine Tarnow benannt, die im Zentrum dieses Romankosmos steht und eine Betrugsermittlungsagentur auf der Upper Westside innehat. Sie ist ein weibliches Pendant von Chandlers Hard-Boiled-Ermittlern und umgeben von einer „Aura verblasster Moral“ und einer „erwiesene(n) Bereitschaft, vom Gesetz gezogene Grenzen zu überschreiten“.
Maxine Tarnow kommt den zwielichtigen Geschäften und Finanztransaktionen der milliardenschweren und vom Platzen der Dotcom-Blase unberührten Sicherheitsfirma hashslingrz und ihrem Chef Gabriel Ice auf die Spur. Durch ihre vielfältigen Kontakte zu zwielichtigen Dokumentarfilmern, Programmierern, Hackern und Mafiosi scheint sie in das Herz einer Verschwörung vorzustoßen. Hier tummeln sich arabische Terroristengruppen, geheime Regierungsprojekte, CIA und FBI sowie deren beliehene Subunternehmer. Unter dem drohenden Schatten der kommenden Ereignisse des 9/11 wird immer deutlicher: „Wir haben es hier mit einem neuen namenlosen Feind zu tun.“
Ironisch spielt Thomas Pynchon in „Bleeding Edge“ auf der Klaviatur der unzähligen sich um 9/11 rankenden Verschwörungstheorien, und so konstatiert auch seine Heldin: „Paranoia ist doch der Knoblauch in der Küche des Lebens, du kannst nie genug davon haben.“ Er führt uns in eine Zeit zurück, in der das Internet mitsamt seinem Deepweb die Freiheit verlor und zum Werkzeug der Geschäftemacher und Mächtigen wurde. Von der anarchischen Experimentierphase der Scriptkiddies, Nerds, Hacker und Geeks war es nur ein kurzer Schritt zum Cyberkrieg und zur Orwell’schen allgegenwärtigen Überwachung, die wir heute in allen Konsequenzen tagtäglich erleben.
Wie gewohnt fährt Thomas Pynchon in „Bleeding Edge“ ein unübersichtliches Personentableau voller schräger und eigenwilliger Typen auf. Neben der begeisternden Maxine spielt aber die pulsierende Metropole New York mit ihren Allüren und Extravaganzen die stärkste Rolle in diesem einen Thriller und eine Screwball-Komödie vereinenden Doppelhelix-Roman.
Bei aller bis zur Perfektion kultivierten postmodernen Ironie lässt Thomas Pynchon aber auch eine deutliche Gesellschaftskritik durchscheinen, die sich auf die Ära Bush und einen enthemmten Turbokapitalismus bezieht: „Wir leben von gestundeter Zeit … unsere Schuldenlast steigt und steigt.“ Auch die Postmoderne hat somit ihre spielerische Unschuld verloren und kann sich den Realitäten nicht mehr ganz entziehen.
„Bleeding Edge“ ist ein höchst unterhaltsamer und für einen 77-Jährigen unfassbar cooler und auf der Höhe der Zeit und ihrer Slangs geschriebener Roman – fast könnte man glauben, dass der Geist Thomas Pynchon schon längst eine Horde junger Ghostwriter beerbt hat.
Karsten Herrmann
Can’t and Won’t
Einmal, in einem glühenden August auf Lanzarote, grenzte das Bett an ein Bücherregal, wo die zusammengesackte deutsche Erstausgabe von Pynchons „V“ seit 1968 auf mich gewartet hatte. Immer schon hatte ich dieses Buch lesen wollen, jetzt war es zu mir gekommen, und so lag ich jeden Tag zur Siestastunde auf dem Bett und lernte ein neues Vergnügen kennen: in einem Roman unterwegs zu sein, dessen einzelne Wörter keine Rätsel aufgaben, während das Ganze ein Kompletträtsel blieb. Spannend war es trotzdem, ein täglicher, betäubender Mittagsrausch, und Hitze, Pynchon und Schlaf verschmolzen zu einem wohligen Akkord.
Wieder zuhause im rheinischen Regen, versuchte ich mich an der „Versteigerung von No. 49“ und lernte ein anderes Pynchon – Vergnügen kennen. Mit der sympathischen Heldin Oedipa Maas reiste ich durch ein kinomäßig bekanntes Amerika voller Motels, Bars und dunkler Geschäfte und amüsierte mich über ausschweifende Sätze, in denen Europas Kultur in Zitaten und Anspielungen nach L.A. transportiert wurde. Sympathisch war auch des Buches Umfang: Nach 149 Seiten befand sich Oedipa im dicksten Schlamassel und die Geschichte am Ende.
In den nächsten Jahren mied der Meister die knappe Form. Wer Pynchon wollte, musste Text schlucken und Lebenszeit investieren. Dazu fehlte mir irgendwie die Lust, und ich sträubte mich lange, aber als „Bleeding Edge“ erschien, mit 605 Seiten ein beinahe sparsames Format und überall begeistert besprochen, war ich bereit und willens und öffnete das Buch mit den besten Absichten.
Klar, dass jetzt die Schilderung der Enttäuschung folgen muss.
Ebenso klar, dass es nicht an Pynchon liegt.
Um es gleich deutlich zu sagen: Der Umfang geht schon in Ordnung. Es handelt sich ja um eine hochkomplexe Story, um die sogenannte Realität, das Netz und das mögliche Netz hinter dem Netz, um Geheimdienste und Verrat und um Nine / Eleven, da kann ein Buch gar nicht dick genug sein, um das auch nur annähernd in den Griff zu kriegen, ganz abgesehen von den Konflikten und Privatkatastrophen der Figuren und Nebenfiguren. Die Heldin heißt Maxine Tarnow, sie betreibt eine Art Agentur zur Aufklärung von Betrügereien und der Leser schließt sie sofort ins Herz, weil sie so nett und tüchtig und tapfer und mütterlich ist. Und nicht auf den Kopf gefallen, weiß Gott. Maxine lebt in Manhattan, und sich kurz zu fassen über Manhattan ist sowieso unmöglich, dafür sind die Wolkenkratzer einfach zu hoch. Tempo, Tempo ist die Devise, und immer so viele Infos in einen Satz gepackt, wie es nur möglich ist:
„In den Nachwehen der Trennung von ihrem damaligen Mann Horst Loeffler, in jener Zeit, die noch immer nicht ganz Vergangenheit ist, hatte Maxine sich – nachdem sie zu viele Stunden hinter heruntergelassenen Jalousien damit verbracht hatte, Steve Nicks „Landslide“ in endloser Wiederholung von einer Kompilationskassette zu hören, deren Rest sie ignorierte, grässliche, mit Crown Royal gemixte Shirley Temples zu trinken, die sie in Schlucken aus der Grenadineflasche hinunterspülte, und einen Scheffel Kleenex am Tag zu verbrauchen – von ihrer Freundin Heidi einreden lassen, eine Kreuzfahrt durch die Karibik würde die Prognose hinsichtlich ihrer seelischen Gesundheit irgendwie verbessern. Eines Tages war sie schniefend und schnüffelnd zu In ‚n’ Out gegangen, wo sie staubige Oberflächen, verkratztes Mobiliar und das beschädigte Modell eines Ozeandampfers vorfand, der einige Gemeinsamkeiten mit der RMS Titanic aufwies.“ Usw. usw.
Ich hab nix gegen lange Sätze, überhaupt nicht. Was mich nervt, ist a) dieser polierte Alleswisser-Ton und b) die ölige Welle amerikanischer Alltagskultur, die mir aus jeder Seite entgegen schwappt. „Ich komme mir vor wie Erin Brockovich!“, sagt Maxine (für diese Rolle gewann Julia Roberts mal den Oscar, remember?, aber muss ich diesen Film deshalb kennen?), zehn Zeilen später: „Das war bei den Fraudbusters, aber das haben sie absetzen müssen, weil es zu viele Leute auf Ideen gebracht hat. Rachel Weisz war allerdings nicht schlecht.“ Mag sein, mag sein, es ist mir egal und ich will es nicht wissen. Wem es schmeichelt, wenn er diese Dauerzitationen locker entschlüsselt und alles TV-mäßig aufbereitet vor sich sieht, weil er die USA kennt wie seine berühmte Westentasche, möge diese und sich selbst genießen. Ich bin eher froh, dass ein Ozean mich davon trennt. Ich hätte auch keine Lust auf einen deutschen Roman, in dem jene Talkshows, Til-Schweiger-Filme und Nele Neumann – Bücher, die ich glücklicherweise meiden kann, mir als postmodernes Gehäcksel in endloser Folge serviert werden. Amerika ist wahrscheinlich toll, aber ich habe keine Lust, mich in seinen Schrottbergen zu suhlen. Vor allem aber habe ich nicht das Gefühl (das ich z. B. bei „Infinite Jest“ hatte), dass es in diesem Buch um etwas geht. Also klappe ich es einfach zu und schenke es dem, der es lesen mag.
Gisela Trahms
Thomas Pynchon: Bleeding Edge. Aus dem Englischen von Dirk van Gunsteren. Rowohlt 2014. 606 Seiten. 29,95 Euro











