Damit sich dies ändere, bemühte sich die Buchmesse schon, nicht mehr »Buch-«, sondern »Weltmesse der Kommunikation« zu heißen. Ihre Veranstalter sprachen gern von »elektronischen Zukunftslösungen« auf der »literarischen Schiene«, den »kreativen Einsatzmöglichkeiten von Hard- und Software«, dem »aktuellen Trendbarometer«. Noch stärker aber aphrodisiert mich bei der neuen »Positionierung« des Buches ein Satz, den ich einmal einen Bertelsmann-Manager sagen hörte: »Das Buch wird vom Lesen auch nicht besser.«
Und hat er nicht Recht? Denis Scheck fährt für die Literatur glaubwürdig Kettenkarussell, Wolfgang Herles taucht ins Mittelmeer und befragt Juli Zeh durch die Taucherbrille, Edo Reents würde Autoren gerne mal Denken, Schreiben und eigentlich ihre Existenz im Medium des Buches absprechen, aber was sind dies anderes als Versuche, brummkreiselnd, absaufend oder hasspredigend um die selbstlose Kunst des Lesens herumzukommen, also Bücher in das Spektakel einer Inszenierung zu promovieren, von der aus sie nicht sichtbar, noch weniger lesbar sind.
Ich sitze am Tisch zwischen Menschen, die alle gute Gründe gefunden haben, ihr Leben Büchern zu widmen. Mein Glück liegt gerade darin zuzusehen, wie die Bücher aus ihnen heraus scheinen, die schon geschriebenen und die noch nicht entfalteten. Judith Hermann spricht unangestrengt, doch bewusst, das heißt voller Skrupel. Auf die Weise, wie ihr Gedanken und Worte kommen, verrät sich selbst im Sprechen das jahrelange Arbeiten an haltbaren Sätzen. Sie muss eine ethische Provokation gewesen sein vor allem für Männer mit einem ordinären Verhältnis zu Sätzen.
Marion Brasch sitzt da im roten Holzfällerhemd, wie immer Wärme abgebend. Ihre Bescheidenheit ist auch ein literarisches Medium, und man ahnt, welche Bücher noch aus diesem Medium heraustreten können, lauter Individuen. Zwei Stühle weiter Peter Stamm, den eine Art Hintersinn nie verlässt, der das Geheimleben nicht abschüttelt, das er mit seinen Ideen führt, und später erzählt Josef Haslinger, der eben aus Kirgisien zurückgekehrt ist, wie dort achtzig Prozent aller jungen Frauen auf dem Lande durch Kidnapping zur Heirat gezwungen werden – und wie er das erfährt, und wie es ihn erfasst und schüttelt. Man sieht ihm die Fremde an, aus der er in diese andere Fremde der Buchmesse gekommen ist.
Und ich denke, selbst wenn diese Menschen und ihresgleichen scheiterten, unverstanden blieben, dann wären da eine Integrität und auch Zartheit, die sich im Binnenverhältnis zwischen diesen Schreibenden und ihren Stoffen, Themen und Büchern zeigen. Diese teilen sich mit, sie gehen hinaus und haben so gar nichts zu tun mit der Zudringlichkeit und der Brutalität der Kommentierung. Ihre Formen, die Welt zu lesen, verschränkten und beantworteten sich, unabhängig von der Schaumschlägerei des »Betriebs« auch auf der »Weltmesse der Kommunikation«. Es ging nicht um das, was diese Schreibenden können, sondern um das, was sie sind.
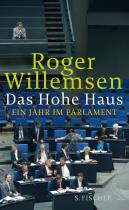
Ein Jahr lang sitzt Roger Willemsen im Deutschen Bundestag – nicht als Abgeordneter, sondern als ganz normaler Zuhörer auf der Besuchertribüne im Berliner Reichstag. Es ist ein Versuch, wie er noch nicht unternommen wurde: Das gesamte Jahr 2013 verfolgt er in jeder einzelnen Sitzungswoche, kein Thema ist ihm zu abgelegen, keine Stunde zu spät. Er spricht nicht mit Politikern oder Journalisten, sondern macht sich sein Bild aus eigener Anschauung und 50000 Seiten Parlamentsprotokoll. Als leidenschaftlicher Zeitgenosse und »mündiger Bürger« mit offenem Blick erlebt er nicht nur die großen Debatten, sondern auch Situationen, die nicht von Kameras erfasst wurden und jedem Klischee widersprechen: effektive Arbeit, geheime Tränen und echte Dramen. Der Bundestag, das Herz unserer Demokratie, funktioniert – aber anders als gedacht.






 © S. Fischer Verlag GmbH /
© S. Fischer Verlag GmbH /