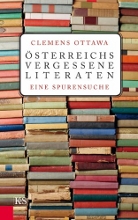Eine Spurensuche.
Wien: Kremayr & Scheriau 2013.
223 S.; geb.; 22,- Euro.
ISBN: 978-3-218-00882-2.
Die Intention ist durchaus ehrenwert: 60 "vergessene Literaten" werden alphabetisch gereiht mit Kurzbiografie und einem (sehr kurzen) Textausschnitt präsentiert. Irritierend ist vielleicht der Begriff "Literaten" - und das meint nicht das verweigerte Gendern. Jesse Thor oder Paula Ludwig würde man mit diesem Begriff spontan einfach nicht in Verbindung bringen. Die Auswahl derartiger Sammlungen ist selbstverständlich immer subjektiv und zwangsweise unvollständig, auch wenn der Titel Österreichs vergessene Literaten etwas Ultimatives vermuten lässt.
Auch "vergessen" ist ein vielschichtiger Begriff. Vielleicht weniger gelesene oder dem Autor bislang nicht bekannte, aber im Kanon eindeutig verankerte AutorInnen wie Albert Ehrenstein, Gerhard Fritsch, Gina Kaus, Hertha Kräftner, Theodor Kramer oder Reinhard Priessnitz werden hier genauso dazugezählt wie AutorInnen, die gerade in den letzten Jahren eine Wiederentdeckung erleben durften wie etwa Hannelore Valencak.
Bei ihr liegt der Autor in seinem Kurzporträt besonders falsch. Dass Die Höhlen Noahs kein Kinderbuch ist, sondern ein apokalyptischer Roman, nicht nach einer "zweiten (biblischen) Sintflut", sondern nach einem Feuerinferno, erschienen nicht 1976, sondern 1961, wäre seit der Neuauflage im Residenz Verlag 2012 leicht festzustellen gewesen. Und der 2006 unter dem Titel Das Fenster zum Sommer neu aufgelegte Roman hieß zwar tatsächlich ursprünglich Zuflucht hinter die Zeit, aber der "neue" Titel ist nicht "neu", sondern übernimmt den der Neuauflage von 1977, den die Autorin damals selbst gewählt hat.
Von Mela Hartwig liegen in der Tat noch unveröffentlichte Romanmanuskripte im Nachlass, allerdings nicht jenes von Bin ich ein überflüssiger Mensch?. Dieser Roman wurde 2001 im Droschl Verlag neu aufgelegt. Wieder aufgelegt wurde auch Peter von Tramins 1963 erschienener Roman Die Herren Söhne, und das gleich zwei Mal: 1985 und 2011. Und dass es zu Martina Wied "abgesehen von einer 1966 veröffentlichten Dissertation [...] und einer Arbeit von Hans Friedrich Prokopp aus dem Jahre 1972 leider wenig Material" gibt, hat sich mit der umfangreichen Dissertation von Bozena Stepien-Janssen Martina Wied. Ein monographischer Versuch aus dem Jahr 2007 dankenswerterweise geändert.
Dass man Alma Holgersens Bücher, deren NS-Verstrickung eher dezent dargestellt wird, "in Buchhandlungen oder Bibliotheken" nicht findet, stimmt natürlich - wie bei allen anderen wirklich Vergessenen - nur für den ersten Teil der Behauptung. Und Anna Maria Jokls Perlmuttfarbe ist kein Kinderbuch, sondern ein veritabler Roman über Schuldverstrickung und Ausgrenzung, dem Jokl selbst den Untertitel Ein Kinderroman für fast alle Leute beigab; dass die Illustrationen Herbert Reschke "besorgte", steht zwar in allen bibliografischen Angaben, aber da es sich eben nicht um ein Kinder- oder gar Bilderbuch handelt, ist das keine so zentrale Information. Alma Johann Koenig wurde nicht "vermutlich im Vernichtungslager Maly Trostinec" ermordert und nicht "vermutlich 1942", sondern sicher, und zwar am 1. Juni 1942. Die letzte Neuauflage eines Buches von Joe Lederer liegt keineswegs "schon beinahe drei Jahrzehnte zurück", ihr erfolgreicher Debütroman Das Mädchen George ist seit 2008 wieder erhältlich, und ihre Bücher pauschal als "unkomplizierte Unterhaltungsliteratur" zu bezeichnen, ist in dieser Kürze ein problematisches, zumindest aber wenig hilfreiches Urteil.
Georg Fröschel ist zweifellos ein noch immer vergessener Autor, aber dass Der Richter ohne Gnade - erschienen 1929, nicht 1930 - sein erster Roman war, unterschlägt die annähernd zehn Romane, die Fröschel bis dahin bereits publiziert hatte; einer davon wird auch erwähnt, oder beinahe, er heißt Der Schlüssel zur Macht (nicht Der Schlüssel der Macht), und genannt wird er als Drehbuch zu einem Film - was insofern einen wahren Kern hat, als Fröschel seinen Roman für den Film selbst bearbeitete.
Da sich der Autor selbst als Schriftsteller definiert, wirken auch sprachliche Hoppalas besonders irritierend. "Die kleine Enrica las viel und war bald von barocker Lyrik, die zu dieser Zeit wieder für das Schulwesen entdeckt wurde, geprägt - erzogen wurde sie streng durch die Ordensschwestern im Kloster St. Pölten." So heißt es über Enrica von Handel-Mazzetti, die heute zu den Vergessenen zähle, "obwohl die Förderer der jungen Schriftstellerin große Namen wie Marie von Ebner-Eschenbach, Carl Muth oder Eduard Konradi trugen." Später wurde sie "als Schriftstellerin auch von der Kritik wahrgenommen, was ihr ein Vorankommen im Literaturbetrieb erleichterte. 1905 verließ sie Wien, da sie sukzessive das Bedürfnis nach einer kleineren Stadt hatte."
Paula Ludwig schuf "jahrzehntelang unbemerkt [...] einige der schönsten und formvollendesten Gedichte der österreichisch-lyrischen Geschichte des 20. Jahrhunderts", während Betty Paoli "mit zunehmendem Alter" begann, talentierte junge Lyriker und Literaten zu protegieren und die letzten Lebensjahre mit ihrer Freundin Ida von Fleischl zusammenlebte, "beide Genussraucherinnen, in einer vornehmen Wohnung, die auch für Salongesellschaften diente".
"Emotionalität, Aggression, unterdrückte Wut waren seine Merkmale, mit denen er der Gesellschaft einen Spiegel vorhielt. Jung und in seinem Schaffen noch formbar, schöpfte er neue Kreativität aus dem Aufenthalt in Paris", steht über Walter Buchebner zu lesen, während Felix Dörmann "von der menschlichen Sexualität, von der Darstellung des Eros und der Inszenierung sowohl literarisch als auch in seinem filmischen Schaffen fasziniert" war. Bei Jakob Julius David wiederum wirkten diverse "Leiden [...] auf die Schwermut vieler seiner Werke ein. Seine Schreibimpulse waren sowohl die Kultur seiner mährischen Heimat als auch das Wiener Großstadtproletariat und dessen Eigenheiten und Liebenswürdigkeiten." In Wien "lebte der ambitionierte junge Mann im studentischen Leben auf".
Vielleicht sollte man solche Formulierungen nicht so tragisch nehmen, in derartige Unsicherheiten der Sprache und der Sprachbilder trainieren die Schriftergüsse in den sozialen Netzwerken allmählich auch ein. Fehlinformationen freilich oder unbelegt und leichtfertig gefällte Urteile in eineinhalb bis zwei Seiten langen AutorInnenporträts sind gerade im Kontext Wiederentdeckung problematisch. Für ein Fachpublikum ist es ärgerlich, für eine breitere Leserschaft zumindest irreführend - schon einen falsch geschriebenen Buchtitel wird man schwer in einem Onlineantiquariat finden. Von fragwürdigem Nutzen ist auch die Auswahl der Textstellen. Halbseitige Auszüge aus Romanen oder Erzählungen können selbst dann, wenn man das gesamte Werk eines Autors, einer Autorin wirklich gut kennt, in den allerseltensten Fällen so gelingen, dass LeserInnen Lust auf die Lektüre des Buches bekommen oder neugierig werden auf den Autor, die Autorin.
red
November 2013
Originalbeitrag
FĂĽr die Rezensionen sind die jeweiligen Verfasser verantwortlich. Sie geben nicht notwendig die Meinung der Redaktion wieder.