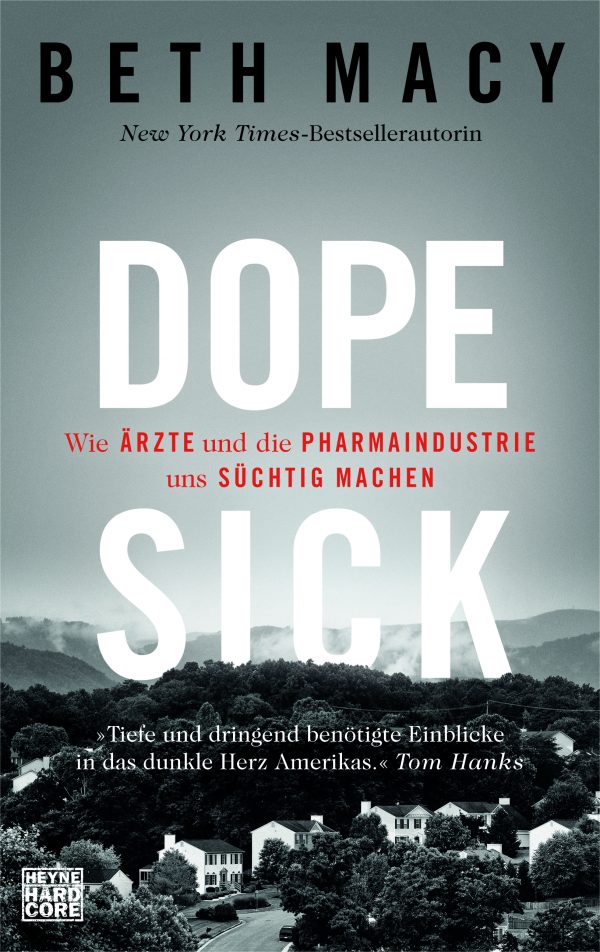
Die Vereinigten Staaten von Amnesia
Textauszug aus Beth Macy großer Reportage „Dopesick“
Mehr Tote als durch jeden Krieg verlieren die USA in ihrer selbstgemachten, von der Gier der Pharmaindustrie gepuschten Opioid-Krise. Von 1977 bis 2017 sind nach Schätzungen des US Centers for Disease Control and Prevention mehr als 702.000 Menschen an einer Überdosis gestorben, 70.000 alleine im Jahr 2017, 130 Menschen täglich. Bei 68 Prozent davon handelte es sich um verschriebene Medikamente oder um ein illegales Opioid. Mittlerweile greift die juristische Aufarbeitung – auch wenn man immer noch sich völlig ahnungslose gebende Rechtsanwälte und Pharmabarone vor den Kameras und Mikrofonen sehen kann. Fest steht: Die Opioid-Krise bleibt ein andauerndes Desaster in den USA. Durch aggressive Werbung hat Perdue Pharma das Blockbuster-Schmerzmittel Oxycontin durch Ärzte und Apotheken massiv in den Markt gebracht und ohne Skrupel verschrieben, andere Unternehmen haben es ihnen nachgemacht. Vertreter und Ärzte wurden durch große Boni und Geschenke geködert. Trump rief 2017 den nationalen Notstand aus, aber wirklich geschehen ist bis heute nichts. Die Todesrate und die Folgen der Anhängigkeit sind immer noch verheerend.
Beth Macy hat über sieben Jahre zu dem Thema recherchiert. In ihrem Buch „Dopesick“ beschreibt sie das suchtkranke Amerika und wie es dazu kam. Sie hat Gerichtsurteile eingesehen, Betroffene, Angehörige, Verantwortliche und Ärzte getroffen. Ihr Buch ist ein großes Zeitdokument. – Hier ein Textauszug:

„Dopesick“
Auch wenn die Opioidepidemie keine Gegend der USA verschont hat – nirgendwo wütet sie so heftig und fordert einen so hohen Tribut wie in den wirtschaftlich am Boden liegenden ehemaligen Kohleabbaugebieten im Zentrum der Appalachen, wo die Verzweifelten und Arbeitslosen Kupferdraht aus verfallenden Fabrikgebäuden reißen, um ihn auf dem Schwarzmarkt zu verkaufen, und durch die Lücke im Zaun eines Walmarts Großbildschirmfernseher klauen, um sich Stoff besorgen zu können.
In einer Gegend, in der nur wenige Firmen es wagen, Geschäfte zu eröffnen, weil es schwierig ist, Mitarbeiter zu finden, die einen Drogentest bestehen, kommt es auch vor, dass erst junge Eltern an einer Überdosis Heroin sterben und drei Tage später ihre sich selbst überlassenen Babys an Dehydrierung und Unterernährung. (12)
Die Appalachen gehören zu den Regionen der USA, in denen die Probleme mit opioidhaltigen Tabletten Mitte der 1990er-Jahre als Erstes zutage traten, als ihnen Kohlearbeiter, Holzfäller, Tischler und ihre Kinder verfielen. Zwei Jahrzehnte nach Ausbruch der Epidemie waren die Wirtschaftswissenschaftler Anne Case und Angus Deaton an der Universität Princeton die ersten Forscher, die Alarm schlugen. Ihre im Dezember 2015 veröffentlichte hochbrisante Analyse belegte, dass die Sterblichkeit unter weißen Amerikanern zwischen 1999 und 2013 jährlich unbemerkt um ein halbes Prozent angestiegen war, während in anderen wohlhabenden Ländern die Sterblichkeit im mittleren Alter kontinuierlich zurückging. »Eine halbe Million Menschen sind tot, die es eigentlich nicht sein sollten«, konstatierte Deaton gegenüber der Washington Post (13) und machte dafür einen Anstieg bei Suiziden, alkoholbedingten Le- bererkrankungen und Medikamentenvergiftungen (in erster Linie durch Opioide) verantwortlich, die Ökonomen später unter dem Begriff »Verzweiflungskrankheiten« (diseases of despair) (14) zusammenfassten. Auch wenn die Daten, auf die Case und Deaton sich beziehen, nicht auf tödliche Drogenüberdosen beschränkt sind, weist ihr zentrales Forschungsergebnis – »ein deutlicher allgemeiner Anstieg der Sterblichkeit bei nicht-hispanischen weißen Frauen und Männern mittleren Alters« – darauf hin, dass die Opioidepidemie einer ganzen Reihe solcher Verzweiflungskrankheiten zuzurechnen ist, die sich in den Statistiken so signifikant auswirken, »dass sie Jahrzehnte des Rückgangs der Sterblichkeit« zunichte- machen.
Etwa zu der Zeit, als die Studie von Case und Deaton veröffentlich wurde, zeigte auch eine Umfrage der Kaiser Family Foundation, dass 56 Prozent der Amerikaner inzwischen jemanden kannten, der Opioide missbräuchlich einnahm, von ihnen abhängig oder an einer Überdosis verstorben war.(15) Landesweit hatte sich die Schere in der Lebenserwartung zwischen dem ärmsten und dem reichsten Fünftel der Amerikaner in den Jahren 1980 bis 2010 auf dreizehn Jahre geöffnet. Lange Zeit ging man davon aus, dass ein Hauptfaktor für diese große Differenz der Zugang zu Gesundheitsversorgung oder anderen gesundheitsförderlichen Vorzügen relativen Wohlstands sei. Doch in der Appalachen-Region war diese Kluft mit einer um 65 Prozent erhöhten Rate von Überdosis-Toten noch größer als in den restlichen USA.(16) Ganz eindeutig lag das nicht daran, dass einige Leute früher, sondern dass weiße Amerikaner in der Blüte ihrer Jahre starben.
Die Geschichte der Opioidepidemie und ihrer Ursachen beginnt Mitte der 1990er-Jahre in der westlichsten Ecke Virginias, in einem zwischen Tennessee und Kentucky eingeklemmten Bezirk. Lee County ist geformt wie ein Tortenstück und den Hauptstädten von acht anderen Bundesstaaten näher als der eigenen, nämlich Richmond. Würde man von Jonesville, dem Sitz der Bezirksverwaltung, dem Flug der Krähen schnurstracks nach Norden folgen, käme man westlich von Detroit raus.
Lee County war geopolitisch betrachtet das Hinterland schlecht- hin: mit dem Auto schwer zu erreichen, durchzogen von kurvigen zweispurigen Landstraßen, übersät mit rostenden Kohlekippstellen, also eine der Gegenden der USA, wo die allerwenigsten Politiker Wahlkampf machen oder wenigstens vorgeben, sich um das Schicksal der Bevölkerung auch nur einen Deut zu scheren. Bis die unkontrollierte Epidemie irgendwann auch auf ihren Sofas landete.
Etwa um die gleiche Zeit, ungefähr 600 Kilometer entfernt, am nördlichen Ausgang des Shenandoah Valley, bekam Kristi Fernandez von einer gestressten Vorschullehrerin erklärt, dass ihr vierjähriger Sohn Jesse so wild war, dass es ihm schon nicht mehr guttäte. Da Jesse regelmäßig die gesamte Klasse aufmischte, ging Kristi mit ihm zum Kinderarzt. Dieser drängte auf die Einnahme von Ritalin, und zwei Jahre später stimmte Kristi zähneknirschend zu. Tatsächlich schien das Medikament seine Nervosität und seine Ängste zu lindern, worauf die Klagen der Lehrerin verstummten.
Doch nach wie vor sprühte Jesse vor Energie. Selbst die Art, wie er seinen Namen schrieb, war überdreht: fröhliche, planlose, sperrige Buchstaben, und unter das E krakelte er immer eine Sonne mit lachendem Gesicht. Die Sonnenstrahlen setzte er wie die widerspenstigen Strähnen eines kleinen Wildfangs kreuz und quer in alle Richtungen, als würden sie zugleich rennen und einem zu- zwinkern.
Lieutenant Richard Stallard war auf seiner üblichen Runde unterwegs. Er patroullierte durch den Bullitt Park in Big Stone Gap, Wise County, an der Bezirksgrenze zu Lee County. Es handelte sich um genau die Kleinstadt, der Adriana Trigiani in ihrem Roman und Film Big Stone Gap ein verklärendes Denkmal gesetzt hatte. Die Geschichte basierte auf Trigianis idyllischer Kindheit und Jugend in den 1970ern, als eine selbst ernannte alte Jungfer mit dem adretten Aussehen von Ashley Judd tagein, tagaus durch die Hügel und Täler des westlichen Virginias spazieren und gefahrlos die Medikamente der familieneigenen Apotheke ausliefern konnte.
Im Jahr 1997, einem Schlüsselmoment in der Geschichte der Opioidepidemie, sah Stallard sich zumindest zu einem Warnruf genötigt. Noch sperrten die Leute in den Kohlerevieren der zentralen Appalachen ihre Geräteschuppen und Scheunen nicht ab, um sie vor den OxyContin-Abhängigen zu schützen, die alles stahlen, was sie kriegen konnten, um die nächste Dosis bezahlen zu können.(17)
Noch immer bezeichnete man die Gegend als Kohlerevier, obwohl die Arbeitsplätze in dieser Industriebranche bereits stark rückläufig waren. Drei Jahrzehnte früher hatte Präsident Lyndon B. Johnson auf der Veranda eines baufälligen Hauses ein paar Bezirke weiter westlich gehockt, hatte mit einem arbeitslosen Sägewerker geplaudert und sich von ihm zu seinem War on Poverty, dem Krieg
gegen die Armut, inspirieren lassen, der in grundlegenden Sozialprogrammen wie Essensmarken, Medicaid, Medicare und dem Bildungsprogramm Head Start münden sollte. Doch trotz dieser Bemühungen herrschte auch an jenem Tag, als Stallard zum ersten Mal mit einem neuen und starken Schmerzmittel in Berührung kam, Armut im Kohlerevier. Während 1964 die halbe Region arm war und Hunger litt, war sie nun landesweiter Rekordhalter in den Kategorien Übergewicht, Erwerbsunfähigkeit und Zweckentfremdung von Arzneimitteln, also Verwendung und/oder Verkauf verschreibungspflichtiger Medikamente zu nicht medizinischen Zwecken. Wenn fett das neue mager war, dann waren Pillen drauf und dran, die neue Kohle zu werden.
Stallard saß gegen Mittag in seinem Streifenwagen, als ein ver- trautes Gesicht auftauchte.(18) Ein Informant, mit dem er seit Jahren zusammenarbeitete, hatte Neuigkeiten für ihn. Zu der Zeit waren Lortab und Percocet die meistgedealten Opioide, eine Tablette kostete auf der Straße zehn Dollar. Das teuerste Schmerzmittel dieser Wirkstoffgruppe war bis dahin Dilaudid gewesen, der Markenname für Hydromorphon, ein Morphinderivat, das auf dem Schwarzmarkt für vierzig Dollar gehandelt wurde.
Der Informant beugte sich runter und schaute durch das Fenster von Stallards Streifenwagen. »Der Typ da hat so’n neues Zeug zu verkaufen, heißt Oxy, er sagt, das is’ Wahnsinn.«
»Wie soll das heißen?«, fragte Stallard. »Oxy compton oder so ähnlich.« Tablettenkonsumenten nutzten es bereits, um ihr High zu intensivieren, oder sie verkauften es auf dem Schwarzmarkt, berichtete Stallards Informant. Dieses Oxy war in viel höheren Dosen als normale Schmerzmittel verfügbar. Eine 80-Milligramm-Tablette wurde für achtzig Dollar gehandelt, was sie für den Schwarz- markt deutlich attraktiver machte als Dilaudid oder Lortab. Ihre stärkere Potenz machte sie auch für den Hersteller zu einem Goldesel.
Der Informant konnte mit weiteren Details aufwarten: Die Konsumenten hätten bereits eine Methode gefunden, den Retard- Mechanismus der Tabletten, einen Überzug, in den »OC« und die Dosierung in Milligramm geprägt war, zu umgehen. Sie nahmen die Tablette einfach für ein oder zwei Minuten in den Mund, bis die Gummierung sich auflöste, und rieben den Überzug dann an ihren Shirts ab. Tabletten mit 40 Milligramm Wirkstoff hinterließen orangefarbene Flecken, die mit 80 Milligramm grünliche. Übrig blieb ein Kügelchen reines Oxycodon, das man entweder zerstoßen und schnupfen oder in Wasser auflösen und spritzen konnte. Die euphorisierende Wirkung setzte unmittelbar ein, so intensiv und ungetrübt wie sonst nur bei Heroin.
Stallard fragte sich, was wohl als Nächstes kommen würde. Bereits in den frühen Neunzigern hatten kolumbianische Kartelle die Wirksamkeit des Heroins gesteigert, das sie auf den urbanen Märkten verkauften, um ihren Marktanteil zu vergrößern. Ihre Zielgruppe waren Konsumenten mit Nadelphobie, die das Schnupfen dem Spritzen vorzogen. Doch sobald sich bei den Schnupfern eine Toleranz gegenüber dem stärkeren Heroin entwickelt hatte, überwanden sie ihre Aversion gegen das Spritzen und konsumierten das Heroin ebenfalls intravenös.(19)
Als Stallard zurück auf der Wache war, griff er sofort zum Telefon. Am anderen Ende der Leitung wollte der Apotheker der Stadt seinen Ohren kaum trauen: »Mannomann, das haben wir doch erst vor ein oder zwei Monaten reinbekommen. Und Sie sagen, das gibt’s schon auf der Straße?«
Der Apotheker hatte den von der FDA (Food and Drug Administration) abgesegneten Beipackzettel von OxyContin gelesen. Die Wirkung der meisten Schmerzmittel hielt über höchstens vier Stunden an, dagegen sollte OxyContin dreimal länger wirken und Patienten mit sehr starken Schmerzen die Wohltat des Durchschlafens bescheren. Die Hersteller hatten das Suchtpotenzial des Medikaments frühzeitig eingeräumt, zugleich aber darauf hingewiesen, dass die retardierende Wirkung Abhängige auf der Jagd nach dem schnellen High frustrieren würde.
»Die verzögerte Absorption von OxyContin schränkt die Eignung der Tablette zur missbräuchlichen Anwendung ein«(20) – an dieser Behauptung der Pharmafirma begann der Apotheker an- gesichts der von Stallard überbrachten Neuigkeiten zu zweifeln. Wenn er wenige Monate nach Zulassung des Medikaments den erfahrensten Drogenfahnder der Stadt deswegen an der Strippe hatte und seine Nachbarn mit orangefarbenen und grünen Flecken auf den T-Shirts rumliefen, dann wurde das Zeug definitiv bereits missbräuchlich angewandt.
Das von der FDA Ende 1995 zugelassene OxyContin war das Produkt des bis dahin wenig bekannten familiengeführten Pharmaunternehmens Purdue Frederick mit Sitz in Stamford (Connecticut). Die Firma war noch kaum in Erscheinung getreten, als drei Brüder – die in der Forschung tätigen Psychiater Mortimer, Raymond und Arthur Sackler – sie 1952 den ursprünglichen, in Manhattan beheimateten Eigentümern abkauften.(21) Zu jener Zeit hatte sie nur eine Handvoll Angestellte und einen jährlichen Umsatz von 20 000 Dollar. Die neuen Eigentümer gründeten ihren Reichtum anfangs auf rezeptfreien Produkten wie Abführmitteln, Ohrreinigern und dem Desinfektionsmittel Betadine, mit dem die Apollo 11 abgespritzt wurde, nachdem sie von ihrer historischen Mondmission zurück- gekehrt war. Mit dem Aufkauf britischer und schottischer Pharmafirmen expandierten die Sacklers in den 1970er-Jahren international. 1984 stiegen sie in das Geschäft mit Schmerzmitteln ein, indem sie MS Contin (»Contin« war eine Abkürzung für »kontinuierlich«) entwickelten, ein Morphin enthaltendes Schmerzmittel für die letzte Lebensphase. Mit Jahresumsätzen von 170 Millionen Dollar befand es sich Mitte der 1990er-Jahre unzweifelhaft auf Profitkurs.
Kurz vor Erlöschen des Patents führte das Unternehmen Oxy-Contin ein, um die Lücke zu füllen.(22) Das neue Medikament, eine Weiterentwicklung des Schmerzmittels Oxycodon, sollte auch über den Einsatz in der Palliativmedizin hinaus zu vermarkten sein. Es handelte sich um die Optimierung einer erstmals 1917 entwickelten Rezeptur, eine aus Thebain (einem Bestandteil des Arznei- Mohns) synthetisierte Form von Oxycodon.
Die bekanntermaßen sehr zurückgezogen lebenden Brüder waren weniger als erfolgreiche Entwickler von Medikamenten berühmt denn als Philanthropen. Zu ihren Freunden zählten Mitglieder des britischen Königshauses, Nobelpreisgewinner und die Kuratoren diverser Kunstmuseen wie des Smithsonian oder des Metropolitan Museum of Art, in denen ganze Flügel nach den Sacklers benannt waren.
Werbung und Verkauf wickelte man über das Unternehmen Purdue Pharma ab. Es war im Bundesstaat Delaware angesiedelt, der US-weit bekannten Steueroase für Konzerne.(23) Die Handelsvertreter von Purdue Pharma priesen landauf, landab die Sicherheit ihres neuen Opioids: »Wenn das Medikament so genommen wird wie verschrieben, liegt das Risiko einer Opioidabhängigkeit bei nur einem halben Prozent«, erklärte Dr. J. David Haddox, Schmerzspezialist und von der Firma ausgesandter Wegbereiter für das neue Mittel.(24) Iatrogene (d. h. durch ärztliche Einwirkung verursachte) Abhängigkeit, so lautete das Wording einer 1996 veranstalteten Ärzteschulung des Unternehmens, wäre in dem Fall nicht nur ungewöhnlich, sondern »außerordentlich selten«.(25)

In der Geschichte der Vereinigten Staaten von Amnesia, wie Gore Vidal die USA einmal bezeichnete, hatte es durchaus Persönlichkeiten gegeben, die Haddox’ vollmundiger Behauptung eine gehörige Portion Skepsis entgegengebracht hätten – wenn sich denn irgendwer die Mühe gemacht hätte, sich genauer mit diesen Zweiflern zu beschäftigen. Bereits seit dem Neolithikum war den Menschen bekannt, dass der Milchsaft des Schlafmohns getrocknet und geraucht werden konnte, um einen Zustand des Wohlbefindens
oder auch der Euphorie (je nach Standpunkt) zu erreichen – und seither war Opium Gegenstand regen Handels, aber auch heftiger Konflikte. Im 19. Jahrhundert führten die Briten und Chinesen um Opium sogar zwei Kriege. Außerdem war der Stoff Hauptbestandteil von Laudanum, einer alkoholhaltigen Opiumtinktur, die eingesetzt wurde, um vom Gelbfieber über Cholera bis hin zu Kopfweh und allgemeinen Schmerzzuständen so ziemlich alles zu kurieren. 1804 verabreichten die Ärzte Alexander Hamilton, einem der Gründerväter der Vereinigten Staaten, nach seinem verhängnisvollen Duell Laudanum. Es sollte die unerträglichen Schmerzen lindern, nachdem eine Kugel seine Leber durchbohrt hatte und in einem Wirbel stecken geblieben war.(26)
In den 1820er-Jahren ersann ein führender Bostoner Kaufmann einen genialen Plan, um von der südchinesischen Küste aus Opium zu schmuggeln, womit er Mitgliedern der Bostoner Oberschicht mit Namen wie Cabot, Delano (wie in Franklin Delano Roosevelt) und Forbes, Millionengeschäfte ermöglichte.27 Mit diesem Geld wurden später einige der ersten Eisenbahnstrecken, Minen und Fabriken des Landes gebaut.
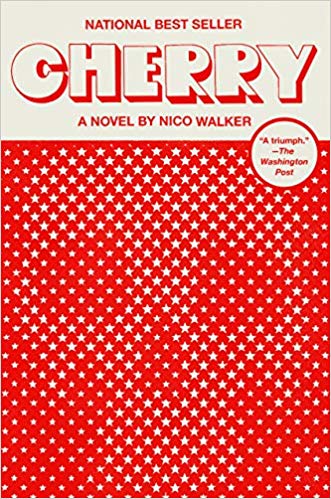
Etwa zur gleichen Zeit veröffentlichte ein einundzwanzigjähriger deutscher Apotheker seine ersten bahnbrechenden Erkenntnisse über Opium und mahnte zur Vorsicht. Friedrich Sertürner hatte den Wirkstoff in der Mohnpflanze isoliert und nannte das Alkaloid Morphium, nach Morpheus, dem griechischen Gott der Träume. Sertürner begriff schnell, dass Morphin um ein Vielfaches stärker war als verarbeitetes Opium, und stellte zugleich fest, dass die Wirkung sehr häufig von Euphorie in Depressivität und Übelkeit umschlug. Was das Mittel mit seinen Hunden anrichtete, gefiel ihm gar nicht: Sie sabberten, verloren das Bewusstsein, und als sie wieder zu sich kamen, waren sie nervös und aggressiv und litten an Fieber und Durchfall – was genau den Entzugserscheinungen entspricht, die Opiumabhängige in China lange Zeit als »yen« bezeichneten.(28) (William S. Burroughs nannte es unter anderem yenning,(29) heute sprechen Abhängige von dopesick oder fiending, deutsch »auf Turkey sein«). »Ich halte es für meine Pflicht, auf die schreckliche Wirkung dieser neuen Substanz hinzuweisen, damit drohendes Unheil abgewendet werden kann«,(30) lautete Sertürners prophetische Warnung bereits 1810.
Mit freundlicher Genehmigung des Verlags aus:
- Beth Macy: Dopesick. Wie Ärzte und die Pharmaindustrie uns süchtig machen (Dopesick – Dealers, Doctors, and the Drug Company that Addicted America, 2018). Aus dem Amerikanischen von Andrea Kunstmann. Heyne Hardcore, München 2019. Hardcover, 464 Seiten, 36 s/w Abbildungen, 22 Euro. Verlagsinformationen.
Website von Beth Macy hier.
Zur Opioid-Krise siehe auch das CrimeMag-Interview von Alf Mayer mit Nico Walker zu „Cherry“.
Anmerkungen
15 Bianca DiJulio/Jamie Firth/Liz Hamel/Mollyann Brodie, »Kaiser Health Tracking Poll: November 2015«, http://kff.org/health-reform/poll-finding/kaiser-health-tracking-poll-november-2015/. Zu Unterschieden in der Lebenserwartung in den USA: Steven Rattner, »2016 in Charts. (And Can Trump Deliver in 2017?)«, New York Times, 3.1.2017.
16 Zur um 65 Prozent erhöhten Rate von Überdosis-Toten vgl. Michael Meit et al., »Appalachian Diseases of Despair«, eine vom Walsh Center for Rural Health Analysis im August 2017 erstellte Studie für die Appalachian Regional Commission.
17 In der Frühphase der heutigen Epidemie gab es die meisten Überdosis-Toten in den Appalachen, im Südwesten und in Neuengland, vgl. Lauren M. Rossen et al., »Drug Poisoning Mortality: United States, 2002–2014«, National Center for Health Statistics, Centers for Disease Control and Prevention, 25.8.2016.
18 Gespräch mit Lieutenant Richard Stallard von der Polizei in Big Stone Gap (inzwischen im Ruhestand) am 29.4.2016.
19 Paul Tough, »The Alchemy of OxyContin«, New York Times Magazine, 29.7.2001.
20 Anhang B zur Verständigung im Strafverfahren, United States v. The Purdue Frederick Company, Inc., und Michael Fried- man, Howard R. Udell und Paul D. Goldenheim, eingereicht im U.S. District Court for the Western District of Virginia, Abingdon Division, und aus dem »Agreed Statement of Facts« des Verfahrens, das die ursprünglichen Behauptungen der Firma enthält, 6; zuletzt geändert am 8.5.2007.
21 Michael Moore, »Lodi Plant Owners Known for Wealth, Phi- lanthrophy«, Hackensack Record (NJ), 27.4.1995.
22 Stacy Wong, »Thrust Under Microscope, Stamford Drug Company’s Low Profile Shattered by Controversy Over Abuse of Painkiller OxyContin«, Hartford Courant, 2.9.2001.
23 Leslie Wayne, »How Delaware Thrives as a Corporate Tax Haven«, New York Times, 30.6.2012. Weil Unternehmen ihre Steuerlast dadurch senken können, dass sie Lizenzgebühren und andere Einkünfte auf Holdings in Delaware verlagern, wo diese nicht besteuert werden, ist der Staat besonders für Mantelgesellschaften attraktiv. Barry Meier, Pain Killer: A »Wonder« Drug’s Trail of Addiction and Death (New York: Rodale Press, 2003), 43.
Ebd., 190. John C. Miller, Alexander Hamilton and the Growth of the New Nation (New Brunswick, NJ: Transaction Publishers, 2004, Erstveröffentlichung 1959), 574. Während einer Gelbfieberepidemie 1793 genas Hamilton, nachdem er Laudanum genommen hatte; vgl. 380. Das Geld, das Thomas S. Perkins mit Opium verdiente, beförderte die industrielle Revolution, vgl. Martha Bebinger, »How Profits from Opium Shaped Nineteenth-Century Boston«, WBUR, 31.7.2017. Thomas Nordegren, The A–Z Encyclopedia of Alcohol and Drug Abuse (Parkland, FL: Brown Walker, 2002), 691. »Yen« kann sowohl den unruhigen Schlaf während des Entzugs als auch das Verlangen nach Drogen bezeichnen. William S. Burroughs, Junkie (New York: Ace Books, 1953), 155. Martin Booth, Opium: A History (New York: St. Martin’s, 1996), 69. Die so genannte Soldatenkrankheit wird beschrieben in: Gerald Starkey, »The Use and Abuse of Opiates and Amphetamines«, in Patrick Healy/James Manak, eds., Drug Dependence and Abuse Resource Book (Chicago: National District Attorneys Association, 1971), 482–84. Dillon J. Carroll, »Civil War Veterans and Opiate Addiction in the Gilded Age«, Journal of the Civil War Era, 22.11.2016. »Opium and Its Consumers«, New York Tribune, 10.7.1877. Brief von Dr. W.G. Rogers im Daily Dispatch (Richmond, VA), 25.1.1884.











