Bloody Chops –

heute von Kerstin Klamroth (KKla), Klaus Kamberger (KK) und Kirsten Reimers (KR).
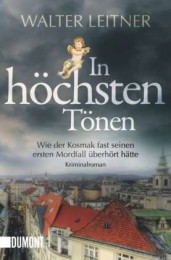 Goschn halten
Goschn halten
(KKla) Na, also hörst, so muss ein Krimi net anfangen. Mit einem nackten Mann unter der Dusche, das edelste Teil mit Preisebeermarmelade verziert, damit hätte uns der Haas nie sekkiert und mit dem will man doch den Leitner vergleichen, weil er halt auch ein Österreicher ist und das Granteln halbwegs drauf hat. Ausgerechnet mit dem Haas.
Der Erzähler beim Leitner red schon so wie der Haas, weil er vom Pauli so spricht wie der Haas vom Brenner. Und der Pauli ist ja auch wie der Brenner Ex-Polizist.
Aber wenn einer einem dann gleich noch immer verzählen will, wie man einen Krimi schreibt, das nervt. Da kann er sich noch so zerspargeln, wenn er den Pauli, seinen Helden also, immer wieder unterbricht – das kann ja nix werden, da kommt der Leser nicht in den Erzählfluss hinein und eigentlich will der Leitner ja das auch nicht, denn das hält er für Ironie. Der Pauli also ist sowieso immer viel zu viel nackt in der Geschichte und sein Marmeladen-Bubi regt sich und regt sich, weil er so gamsig ist, obwohl er doch den Fall lösen soll im Spitzenorchester, wo einer tot im Cellokasten gefunden wurde, erdrosselt mit einer Saite.
Aber der Leser kann´s ja eh nicht spannend finden, denn er muss lernen, da kennt der Leitner keine Gnade, wie er einen Krimi schreibt, Reimen macht den Krimi schlank, und dann gibt´s ja noch den Erzähler und den Autor, der eine kümmert sich um den Pauli und der andere muss mit Lektorinnen schlafen und Verträge unterschreiben, damit der Krimi gedruckt wird. So ist das also. Der Pauli schleicht sich ins Notenarchiv und sein Erzähler, grad wie in der Romantik, redet mit dem Leser über ihn, nicht nur Gutes übrigens. Fehlt nur noch, dass der sich selbst in die Geschichte hineinkatapultiert, aber das traut er sich dann doch nicht. Der Pauli muss den Fall selber lösen und lernt bis dahin so einiges über Auf- und Abstriche bei den Geigern, den Marmeladengeschmack seiner Liebsten und die Arbeit eines Notenwartes, nämlich radieren, radieren, radieren.
Im Krimi tut der Kommissar das, was der Erzähler ihm sagt, und nicht umgekehrt. Aber ich wünsch mir, dass der Pauli dem doch mal sagt, dass er die Goschn halten soll, dem Geschaftlhuber, dem elendigen. Damit ich mir mal in Ruh überlegen kann, warum jetzt ausgerechnet der der Täter ist, von dem ich´s gar nicht geglaubt hätt und dem ichs auch gar nicht zugetraut hätt, so wie er angelegt ist.
Walter Leitner: In höchsten Tönen. Wie der Kosmak fast seinen ersten Mordfall überhört hätte. Roman. Köln: Dumont 2011. 252 Seiten. 9,99 Euro. Verlagsinformationen zum Buch.

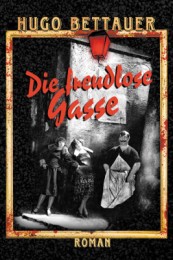 Kolportage? Kolportage
Kolportage? Kolportage
(KK) Man nehme ein Schäuferl Sozialkritik (wir sind in Wien, daher das „Schäuferl“), ein halbes Kilo Sozialschnulze, gebe je zehn Deka (wie gesagt: Wien) Liebelei, Sex, Niedertracht und schließlich noch eine Prise Edelmut hinzu, rühre je einen Scheffel an Machenschaften/Hinterhältigkeiten der feinen Gesellschaft und an Elend/Niedertracht/Opferrolle der Proletarier hinein, und heraus kommt ein Fortsetzungsroman, der es in sich hat(te) – vor allem das Zeug zum Bestseller im Wien der 20er Jahre.
Hugo Bettauer war seinerzeit ein mit allen einschlägigen Wassern gewaschener Wiener Journalist und Spezialist für das skizzierte Genre. Abgesehen davon, dass ihn, den getauften Juden, das am Ende doch das Leben gekostet hat (ein Wiener Nazi hat ihn 1925 mit fünf Revolverschüssen niedergeknallt), ist sein Œuvre denn doch eine Wiederentdeckung wert. Und überhaupt: Immerhin hat keine Geringere als Greta Garbo in der Rolle einer verfolgten Unschuld namens Grete damals den ersten Schritt zum Weltruhm getan …
Bettauers in jeder, also auch in bester Hinsicht als „Kolportage“ zu goutierender Roman, ist ein köstlicher Zwitter geworden. Zum einen die Chronik eines Kriminalfalls aus der feinen Wiener Gesellschaft der habsburglos abdriftenden Kaiserstadt und der sie alimentierenden armen Leute weiter unten, zum anderen eine Liebesgeschichte, nein, zwei Liebesgeschichten mit jeweils rührendem Happyend.
Der Chronik fehlt es dabei keineswegs an Empathie, aber auch nicht an Ironie und Distanz. Nur wenn es um die „wahre“ Liebe geht, dann ist der Kitsch nicht weit. Und der edle Mensch, der natürlich auch vorkommt, ist natürlich Journalist, heißt Demel und wendet mit Grete alles am Ende zum Guten. (Na ja, Old Shatterhand war ja auch das Alter Ego von wem doch gleich? Richtig, dem Autor.)
Aber eine Erkenntnis nehmen wir auf alle Fälle mit nach Hause: Die, die sich eigentlich ein Gewissen leisten können, lassen das lieber und werden dafür um so reicher, und die, die es auf die andere Seite verschlagen hat, müssen sich halt verkaufen, und das geht nur mit Gewissen inklusive.
Kurzum, bei Milena sind sie auf eine kleine Trouvaille gestoßen, haben sie hübsch aufbereitet und außerdem noch mit einem informativen Nachwort versehen. Chapeau!
Hugo Bettauer: Die freudlose Gasse. (1924) Roman. Mit einem Nachwort von Murray G. Hall. Wien: Milena 2011. 199 Seiten. 22,50 Euro. Verlagsinformationen zum Buch.

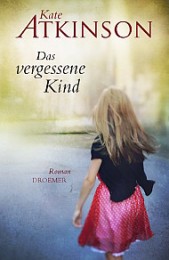 Die „Hoffnung“ ist ein Federding …
Die „Hoffnung“ ist ein Federding …
(KR) Die pensionierte Kriminalpolizistin Tracy Waterhouse kauft in einem unbedachten Moment einem unkontrollierbaren Impuls folgend einer Prostituierten ein Kleinkind ab – und sieht sich plötzlich von unterschiedlichsten Parteien verfolgt. Dazu kommt ein alter Fall, der wieder aufgerollt wird: ein Mord von vor mehr als dreißig Jahren, als Tracy noch eine junge, unerfahrene Streifenpolizistin war. Auch damals spielte ein Kleinkind eine gewichtige Rolle. Parallel dazu sucht Expolizist und Exprivatdetektiv Jackson Brodie im Auftrag einer Klientin nach deren leiblichen Eltern – und findet unter anderem einen Hund.
Kate Atkinson spielt mit den unterschiedlichsten Aspekten der Liebe zu Kindern (Wunsch, Hoffnung, Fluch), die sie in die verschiedenen Erzählstränge einbindet. Diese Stränge berühren einander, verknoten, trennen sich wieder, existieren nebeneinander her – und am Ende krachen sie ganz furios und absolut unaufhaltsam aufeinander.

Kate Atkinson
Um einen Krimi handelt es sich dabei eher am Rande, auch wenn Atkinson mit Brodie einen immer wiederkehrenden Ermittler hat, der diesmal sogar annähernd im Zentrum der Geschichte steht. Vielmehr verflechten sich bei ihr Handlungen und Ereignisse auf höchst eigene Art, sodass ein dichtes Gewebe entsteht, in dem halt auch Platz für Krimielemente ist.
Geschehnisse sind bei Atkinson nie isoliert oder zufällig, sondern ergeben sich aus früheren Ereignissen, Entscheidungen oder Unterlassungen. Deshalb wirken ihre Romane zugleich unwahrscheinlich und höchst glaubwürdig, was zusammen mit dem entspannten schwarzen Humor eine sehr angenehme und seltsame Mischung ergibt.
Kate Atkinson: Das vergessene Kind (Started Early, Took My Dog, 2010) Roman. Deutsch von Anette Grube. München: Droemer 2011. 457 Seiten, 19,99 Euro. Verlagsinformationen zum Buch. Homepage der Autorin.














