
Kurzbesprechungen von Hanspeter Eggenberger (hpe), Joachim Feldmann (JF), Alf Mayer (AM), Frank Rumpel (rum), Frank Schorneck (FS), Thomas Wörtche (TW).
Aravind Adiga: Amnestie
Sebastian Barry: Tausend Monde
Jaime Begazo: Die Zeugen
Gion Mathias Cavelty: Innozenz
Uta-Maria Heim: Toskanisches Erbe
Mick Herron: Real Tigers
Mike Knowles: Tin Men
Nick Kolakowski: Love & Bullets
Paolo Maurensig: Der Teufel in der Schublade
Prosper Mérimée: Tamango
Richard Middleton: Das Geisterschiff
Denise Mina: Götter und Tiere
Andreas Niedermann: Blumberg (1 + 2)
John Niven: Die F*uck-it-Liste
Sascha Reh: Großes Kino

Zweifel und Schulden
(rum) Für Denise Mina ist das Schreiben von Kriminalromanen, wie sie mal in einem Interview sagte, ein großartiger Weg, auch über Politik zu reden. Denn Städte wie Glasgow, Manchester und Liverpool hätten ein massives Problem mit organisierter Kriminalität und die hat eben immer auch mit politischen Strukturen zu tun. Und genau davon erzählt die schottische Autorin in ihrem großartigen Roman „Götter und Tiere“, dem dritten Teil ihrer Serie über Detective Sergeant Alex Morrow. Ihr Halbbruder ist ein Strippenzieher auf der anderen Seite des Gesetzes, steckt tief im Gangmilieu Glasgows. „Die meisten Leute in Glasgow kannten jemanden, wohnten neben jemandem, hatten einen Verwandten oder eine Tochter mit einem zweifelhaften Freund“, weiß Morrow. Sie selbst hat gelernt, offen mit der Situation umzugehen und ist sich bei ihrem Halbbruder doch nie sicher, in was er verstrickt ist. Sie selbst hat Karriere bei der Polizei gemacht und muss sich in den männlich dominierten Strukturen behaupten.
In diesem im Original vor acht Jahren erschienenen Roman erzählt Mina von den schleppenden Ermittlungen zu einem Überfall auf eine Postfiliale. Ein älterer Kunde schien den maskierten Räuber zu kennen, half ihm sogar, das Geld zu verstauen und wurde doch anschließend von ihm erschossen. Die Polizei hat indes noch ganz andere Probleme. Eine junge Polizistin und ihr Kollege nehmen bei einer Autokontrolle (Sproß eines stadtbekannten Ganovenclans in einem typischen Gangster-Protzfahrzeug) eine Tüte voll Bargeld an sich. Die Polizistin hat Zweifel, ihr Kollege Schulden. Sie behalten das Geld, bis ein Foto von ihnen kursiert. Parallel dazu erzählt Mina von den Schwierigkeiten eines jungen Mannes, der sich in Glasgow vor seiner Familie versteckt, eigentlich Gutes tun will, sich dabei aber permanent verdächtig macht. Und dann ist da noch der Spitzenkandidat der Labour-Party, der über eine Affäre zu einer 17-Jährigen ins Straucheln gerät und verzweifelt versucht, seine Haut und sein politisches Ansehen zu retten.
Wie das alles zusammenhängt, lässt die 1966 geborene Denise Mina lange im Dunkeln, rückt ihre zunächst parallel laufenden Erzählstränge erst allmählich aneinander und legt so aus ganz verschiedenen Perspektiven die Strukturen und gesellschaftlichen Bedingungen offen, auf und mit denen organisierte Kriminalität Fuß fasst und gedeiht, Abhängigkeiten schafft und Widerstand provoziert. Minas Morrow-Romane (dies ist der dritte Band, 2018 erschien im Argument-Verlag mit „Blut Salz Wasser“ der fünfte und bisher letzte Roman der Reihe, die restlichen kamen vor Jahren bei Heyne heraus und sind nur noch antiquarisch erhältlich) sind handfest, mit Alltag und an der Realität gestähltem Humor gesättigt, wunderbar wild und scharfkantig. Sie arbeitet mit einem stattlichen, lebensnah gezeichneten Figurenensemble, das aus unterschiedlichen Milieus kommt und mit ganz eigenen Erwartungen, Ängsten und Zwängen zu kämpfen hat. Wie Mina damit ihre fein verästelten Geschichten erzählt, ist eine Klasse für sich.
Denise Mina: Götter und Tiere (Gods and Beasts, London, 2012). Argument-Verlag, Hamburg 2020. 349 Seiten, 21 Euro; das elektronische Buch bei Culturbooks.
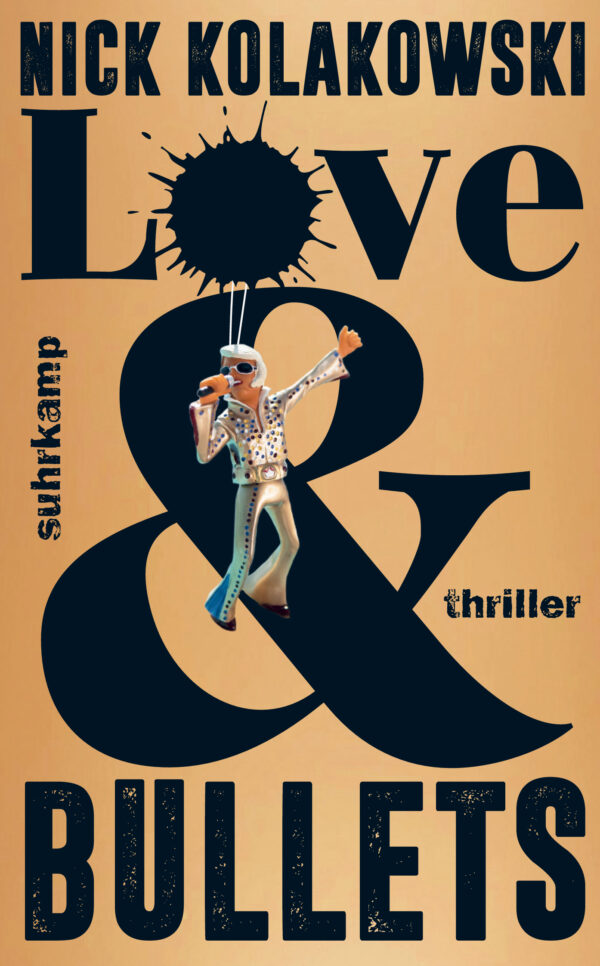
Beinhart, blutig, brutal – und lustig
(hpe) Love & Bullets von Nick Kolakowski ist ein schneller, dreckiger, witziger Thriller, der alles hat, was man sich von einem guten Krimi wünscht: Spannung, schräge Ideen, rabenschwarzer Humor, Action, Gewalt und Leidenschaft. Die verrückte Gangsterballade ist im Original in drei Bänden erschienen, auf Deutsch kommt die ganze Trilogie auf 427 Taschenbuchseiten.
Die Hauptfiguren sind Bill und Fiona. Er ist ein Charmeur und Spezialist für das Ausnehmen weniger cleverer Mitmenschen. Sie ist fürs Grobe zuständig. »Hör auf so zu tun, als wärst du ein Kämpfer«, herrscht sie ihn einmal an. Das Paar hat für den Rockaway Mob in New York gearbeitet. »Schutzgelderpressung, Auftragsmorde, Brandstiftung und auch sonst alles, was Bargeld brachte und in Blutvergiessen endete«, wird der Geschäftsbereich der Mobster umschrieben. »Sie hatten einen Blick in den Abgrund geworfen und die Aussicht prima gefunden.« Doch dann vergreift sich Bill – »einmal Abzocker, immer Abzocker« – am Vermögen seiner Arbeitgeber, um in südlichen Gefilden dem Dolcefarniente zu huldigen. Ohne seine Freundin Fiona, die schon bald zu den Killern gehört, welche die New Yorker Mobster dem dreisten Bill hinterherschicken. Doch nach einem kleinen Geplänkel tut sich das Paar gegen die anderen Verfolger und die Gangster in New York wieder zu einem fast unschlagbaren Team zusammen.
Was folgt ist eine wilde Höllenfahrt, die vom Süden der USA in die Karibik und nach Mittelamerika und zurück nach New York führt. Und überall endet das Aufeinandertreffen von Gangstern – neben den Verfolgten und ihren Verfolgern mischen sich schon mal andere geldgierige Kriminelle ein – mit mehr oder weniger wüsten Gemetzeln.
Das ist beinhart, brutal, blutig. Und gleichzeitig lustig. Denn es sind Ganoven unter sich, die sich gegenseitig die Köpfe einschlagen. Während die Geschichte ziemlich überdreht ist, bleibt Kolakowskis Erzählstil wunderbar trocken. Ein Extravergnügen bieten verschiedenste populärkulturelle Anspielungen. Neben einem Killer, der in einem Elvis-Kostüm zu einer Schlacht antritt, gibt es dezentere Verweise, so etwa auf den legendären Actionfilmregisseur Sam Peckinpah oder auf Düstersänger Tom Waits. Und Bill jammert einmal: »Reisst mir die Fingernägel raus, schneidet mir die Nüsse ab, aber bitte nicht Coldplay.« Zu den hochkomischen Momenten gehört eine Szene mit einem Tesla, der im Selbstfahrmodus in Manhattan weiter einen Parkplatz sucht, nachdem der Mann auf dem Fahrersitz– buchstäblich – seinen Kopf verloren hat.
»Love & Bullets« wird zwar kaum auf einer Literaturpreis-Shortlist auftauchen, ist deswegen aber keineswegs nur leichte Unterhaltung. Kolakowski wirft beiläufig kritische Blicke auf die heutige Welt und ihre Werte. Und befasst sich im Grunde immer mit der Bestie, die im Menschen lebt.
Nick Kolakowski: Love & Bullets (Original: drei Bände unter dem Obertitel The Love & Bullets Hookup: A Brutal Bunch of Heartbroken Saps, 2017; Slaughterhouse Blues, 2018; Main Bad Guy, 2019). Aus dem Englischen von Stefan Lux. Suhrkamp, Berlin 2020. 427 Seiten, 11 Euro.
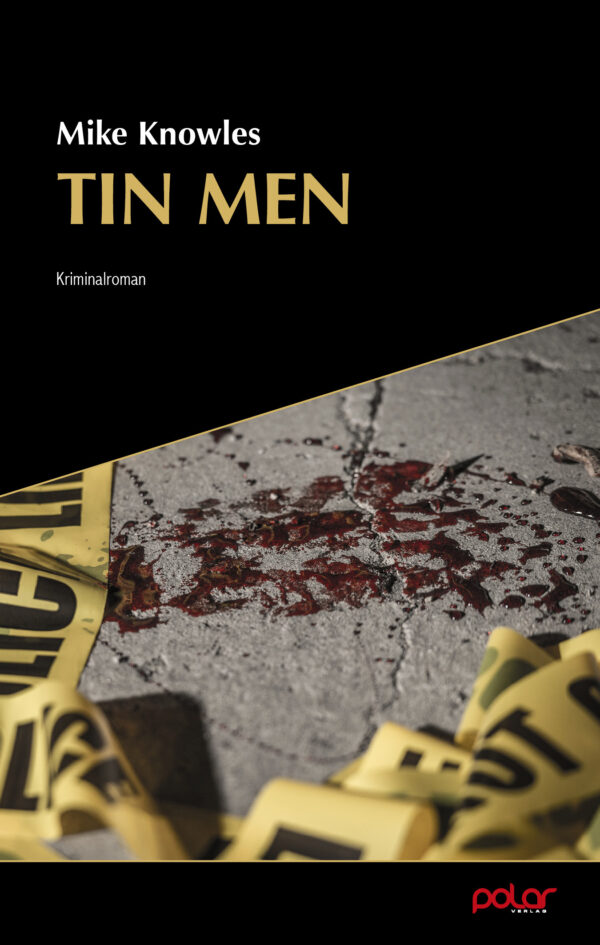
Wuchtige Tragödie
(JF) Der eine nimmt Drogen, dem anderen ist jeder Anlass recht, um jemanden zu verprügeln. Und der Dritte ist ein regelmäßiger Kunde von Prostituierten. Drei Polizisten, drei kaputte Typen. Zuständig für das Verbrechen in der kanadischen Stadt Hamilton, allerdings nicht selten mehr damit beschäftigt, die eigene Haut zu retten. Als eine Kollegin auf grausame Weise ermordet wird, ist des dennoch Ehrensache, den Fall möglichst rasch aufzuklären. Dass Os, der den Adrenalinkick von Schlägereien ebenso dringend braucht wie sein Kollege Woody Heroin, noch ein anderes Motiv antreibt, darf niemand wissen. Denn sonst gehörte er selbst schnell zum Kreis der Verdächtigen.
Mike Knowles‘ finsterer Polizeiroman „Tin Men” spielt innerhalb weniger Tage, nachdem das Verbrechen geschehen ist. Der Tatort wird gesichert, Nachbarn verhört und das Privatleben des Opfers seziert. Aber es wird nicht nur aufgeklärt, sondern auch vertuscht, denn keiner der drei Ermittler kann es sich leisten, als schmutziger Cop entlarvt zu werden. Das geht, wie sich denken lässt, ziemlich schief. Während Woody tapfer falsche Spuren verfolgt, wird Os vom Dienst suspendiert und gerät völlig außer Kontrolle. Gelöst wird der Fall letztendlich durch Dennis‘ beharrliche, von den beiden anderen belächelte, Detektivarbeit. Ausgerechnet hier kommt Knowles‘ gemeiner Plot der Mördersuche des traditionellen Kriminalromans am nächsten und wirkt entsprechend konstruiert. Aber das spielt angesichts der Wucht der kalten Tragödie, in die er seine Protagonisten verstrickt, kaum eine Rolle.
Mike Knowles: Tin Men. Kriminalroman. Aus dem kanadischen Englisch von Karen Witthuhn. 338 Seiten. Stuttgart: Polar Verlag 2020. € 14,00.

Ein Rächer zieht durchs Amerika der Trumps
(hpe) Um einen großen Beschiss um einen Superstar im Music Business ging es im letzten Roman »Kill ’em All« des Briten John Niven. Der Star, der gerne Buben um sich hat, erinnerte stark an Michael Jackson – mit der witzigen Umkehrung, dass hier ein weißer Popstar lieber schwarz sein wollte. Die bitterböse Satire auf das Musikgeschäft zielte nebenbei auch auf das Amerika von Trump. Ganz darauf konzentriert sich nun Nivens neuer Thriller Die F*ck-it-Liste.
Der Roman spielt im Jahr 2026. Die USA sind zu einem Polizeistaat geworden. Trump hat in seiner zweiten Amtszeit seinen Vize Pence gefeuert und Tochter Ivanka zur Vizepräsidentin gemacht, um dann zurückzutreten, damit sie zur nächsten Wahl schon als Präsidentin antreten konnte. Die Wahl hat sie dann auch gewonnen. »Eine ihrer ersten Amtshandlungen war eine Amnestie für ihren wegen zahlreichen Vergehen angeklagten Vater.« Ihr dannzumal ehemaliger Mann sitzt im Gefängnis, weil er »für den gewaltigen Haufen Mist, den sein Schwiegervater verbockt hatte, den Kopf hinhalten musste«.
Hauptfigur ist jedoch Frank, der Chefredakteur einer Zeitung im US-Hinterland war, bis diese eingestellt wurde. Jetzt hat der Arzt bei ihm Krebs diagnostiziert, er hat vielleicht noch ein paar Monate zu leben. Die will er nun nutzen, um seine Fuck-it-Liste abzuarbeiten. Er denkt, dass die Welt ein bisschen besser wird, wenn er ein paar üble Figuren endgültig aus dem Verkehr zieht. »Fünf Namen. Die Auswahl war teils persönlich, teils politisch motiviert, obwohl das Politische noch ziemlich persönlich war.« Frank hat ein paar schwere Schicksalsschläge erlitten. Die Tochter aus zweiter Ehe starb nach einer – mittlerweile in den USA illegalen – Abtreibung. Die dritte Ehefrau und der kleine Sohn kamen bei einem Amoklauf ums Leben. Die Ziele seines Rachefeldzugs hat er längst ausgekundschaftet. Auf seiner Abschussliste stehen nicht nur Kotzbrocken, die Menschen, die ihm nahestanden, in den Tod getrieben haben, sondern auch die politisch Verantwortlichen für die neuen Abtreibungs- und Waffengesetze. Der Rachefeldzug geht ganz gut los, doch bald ist ein Polizist, der mit einem von Franks Opfern befreundet war, dem Rächer auf den Fersen.
»Die F*ck-it-Liste« ist ein flott und mit Witz geschriebener Mix aus Rachethriller, Politsatire, Gesellschaftsanalyse, Roadmovie und Situationskomikslapstick. Doch bei den politischen Themen, darunter etwa riesige Lager mit Internierten an der Grenze zu Mexiko, zeigt Niven nicht die Brillanz, mit der er in seinem letzten Roman das Musikbusiness vorführte. Seine politische Kritik bleibt oberflächlich und wirkt dadurch ein bisschen billig.
John Niven: Die F*uck-it-Liste (The F*ck-it List, 2020). Aus dem Englischen von Stephan Glietsch. Heyne Hardcore, München 2020. 317 Seiten, 22 Euro
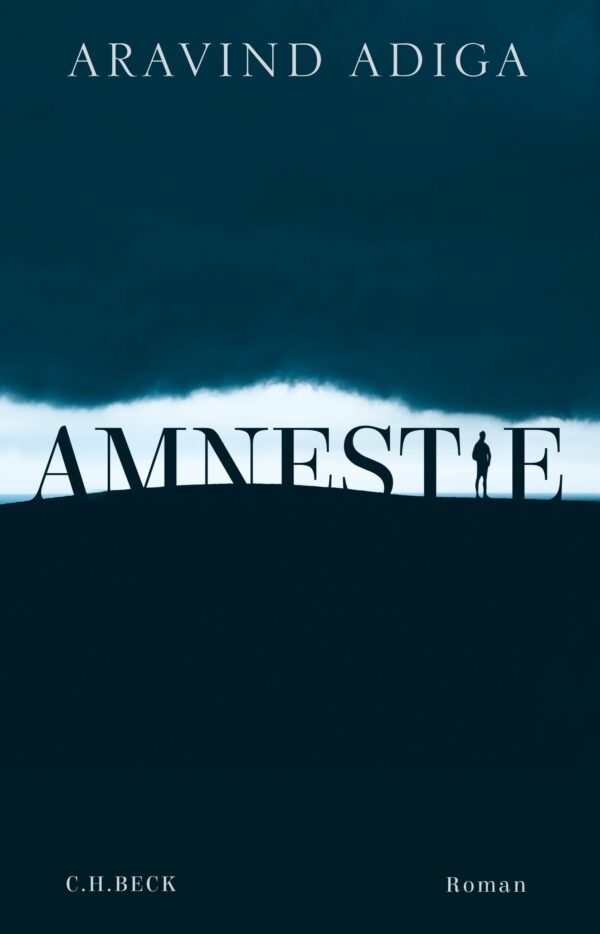
Moral? Moral!
(TW) Ein existentielles Dilemma treibt Danny um, die Hauptfigur von Aravind Adigas neuem Roman „Amnestie“. Danny ist ein Tamile aus Sri Lanka, der illegal in Sydney lebt und sich als Putzmann durchs Leben schlägt. Als eine ehemalige Kundin von ihm ermordet wird, ahnt er, wer der Täter sein muss und zudem wird ihm klar, dass dieser Täter einen zweiten Mord begehen wird. Wenn Danny sich an die Polizei wendet, fliegt er als Illegaler auf, wenn er schweigt, kommt ein Mörder ungeschoren davon. Der streng strukturierte Roman, er spielt an einem Tag von 8:46 h bis 19:03 h, erzählt aus der Perspektive eines Außenseiters, der zudem als sri-lankesischer Tamile, gleich doppelt mit seinem Minoritätenstatus leben muss. Ein Roman über die Kontextabhängigkeit von Moral, und letztendlich über den freien Willen. Sehr spannend.
Aravind Adiga: Amnestie. Dt. von Ulrike Wasel und Klaus Timmermann. Ch. Beck. 286 Seiten, Hardcover, 24 Euro.
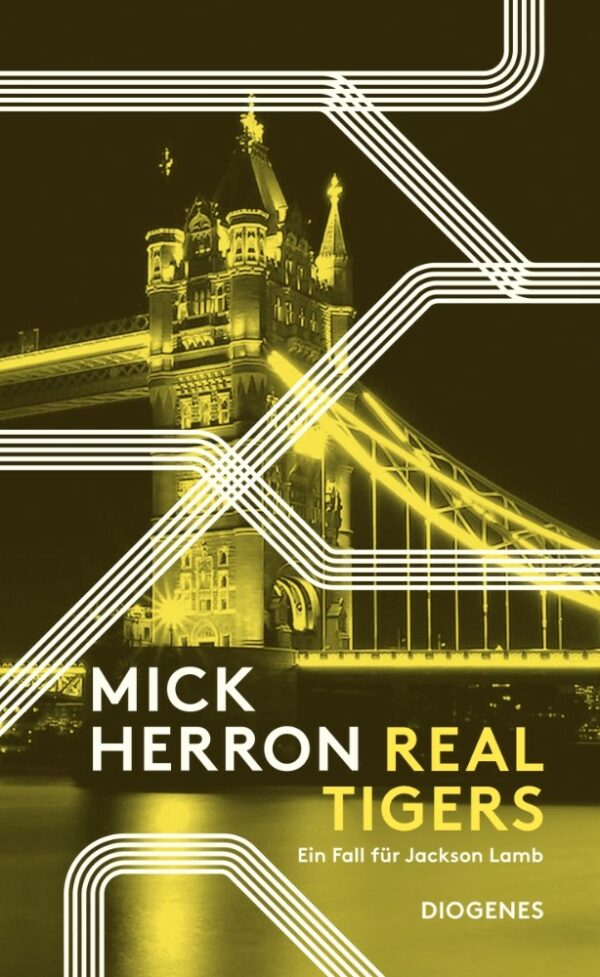
Überall Intrigen
(rum) Abgeschlossene Fälle und sinnlose Recherchen – das sind die Aufgabenfelder der Slow Horses, einer Truppe ausgemusterter Spione, die Mist gebaut haben oder jemandem auf die Füße getreten sind. Slough House heißt ihre Zentrale, ein heruntergekommenes Bürogebäude in London, das man nach einem Arbeitstag verlässt, „als wäre das eigene Gehirn durch einen Entsafter gepresst worden“, sagt eine der Slow Horses. Die hoffen allesamt auf die eine Chance, beweisen zu können, dass sie auf dem Abstellgleis nichts zu suchen haben.
Deshalb lassen sie sich auf aussichtslose Einsätze ein, bei denen man nur verlieren kann und die es offiziell nie gegeben haben wird. In diesem Fall gilt es, Unterlagen aus dem Geheimdienstarchiv zu klauen und sie an Leute zu übergeben, die zuvor eine Agentin der Slow Horses entführt haben. Sie forderten zunächst die Personalakte des neuen Innenministers, einem skrupellosen Machtmenschen mit den unverkennbaren Zügen Boris Johnsons, der nur ein Ziel hat: in Downing Street 10 einzuziehen (das Original erschien 2017). Der Einsatz misslingt und stellt sich zunächst als eine etwas simple Aktion heraus, mit der anscheinend die Funktionsfähigkeit des Dienstes (mit einem so genannten Tigerteam) getestet werden sollte. Doch das Ganze läuft völlig aus dem Ruder, zumal einige Akteure eine eigene Agenda haben und hinter den Kulissen munter intrigiert wird. Der neue Innenminister will sich profilieren und auch innerhalb des Geheimdienstes fordern Machtkämpfe verschlungene Taktiken.
Mick Herrons Geschichten um die Slow Horses (dies ist der dritte Band, „Slow Horses“ und „Dead Lions“ hießen die Vorgänger) sind herrlich absurde Spionageromane, wild und abgedreht, aber in sich stimmig, dazu getränkt mit Sarkasmus und tiefschwarzem Humor. Dabei geht es jeweils auch um größere Themen, hier etwa um die Unmengen von Daten, die so ein Geheimdienst sammelt, diese irgendwie ordnen und vor allem sichern muss. Letzteres geht ziemlich schief. Zudem ergründet der Autor von Buch zu Buch immer mehr die Untiefen seiner Figuren. Die Entführte etwa, die hier mit im Fokus steht, ist trockene Alkoholikerin und hat gerade in dieser Situation hart zu kämpfen. Einer ihrer Kollegen lässt keine Gelegenheit aus, mit seinen Erfahrungen bei einem Sondereinsatzkommando zu prahlen, um dann, als es ernst wird – man sieht es kommen – als erster überrollt zu werden. Souverän führt Herron seine Erzählfäden, wechselt permanent die Perspektive und lotet so seine Geschichte um Rache und politische Winkelzüge jeweils neu aus. Herron lässt auch im dritten Band nicht nach. Es lohnt sich, dran zu bleiben.
Mick Herron: Real Tigers. Ein Fall für Jackson Lamb. (Real Tigers. London, 2017). Aus dem Englischen von Stefanie Schäfer. Diogenes, Zürich 2020. 474 Seiten, 18 Euro.

Nachtstücke
(AM) „Nocturnes“ nennt der Steidl Verlag seine neue kleine feine, von Andreas Nohl herausgegebene Reihe. Den ersten Band, Robert Musils „Der Fall Mossbrugger“, habe ich im Juli bei uns besprochen, jetzt sind zwei weitere Bände erschienen. Tamango von Prosper Mérimée versammelt drei Novellen sowie den Text „Über Vampirismus“ von 1827, der, obwohl satirisch gemeint, und pure Fiktion, unser Bild von den nächtlichen Blutsaugern entscheidend mitgeprägt hat. Mérimée kann das Patent auf den Vampirzahn beanspruchen.
Auch die drei in dem schmalen Band enthaltenen Novellen sind Nachtstücke. „Tamango“ (30 Seiten lang) und „Mateo Falcone“ (18 Seiten), beide 1829 in der „Revue de Paris“ veröffentlicht, machten den Autor auf einen Schlag berühmt – sie waren die ersten von insgesamt sechzehn Novellen, die er im Lauf seines Lebens schrieb, allesamt Meisterwerke dieser Prosaform. „Mateo Falcone“ spielt in der Banditenwelt von Korsika und gilt als „das schärfste Porträt patriarchalischer Unbarmherzigkeit, das es in der Literatur gibt“, so Herausgeber Andreas Nohl. Rosa Luxemburg übrigens war 1914 die (nicht genannte) Autorin einer Übersetzung. „Venus von Ille“, die dritte Novelle des Bandes, beginnt wie eine Komödie um Archäologie und eine ländliche Hochzeit, die tödlich endet. Die Horrorelemente sind meisterlich gesetzt. „Tamango“ nimmt den Sklavenhandel Anfang des 19. Jahrhunderts, als er bereits geächtet, aber immer noch illegal betrieben wurde, auf ungewöhnliche Weise ins Visier, erzählt zu Beginn aus der Perspektive des französischen Kapitäns Ledoux, der sich im Gewand eines Humanisten auf erbarmungslose Gewinnmaximierung versteht und dann seinen Meister findet. In der Verfilmung „Die schwarze Sklavin“ von John Berry (1957) wurde er als Herrenmensch übrigens von Curd Jürgens verkörpert. Ein Klassikerentdeckung, fein ausgestattet.
Prosper Mérimée: Tamango. Steidl Nocturnes. Übersetzt durch Arthur Schurig und Adolf von Bystram, herausgegeben von Andreas Nohl. Steidl Verlag, Göttingen 2020. Fester Leineneinband, 128 Seiten, 18 Euro.
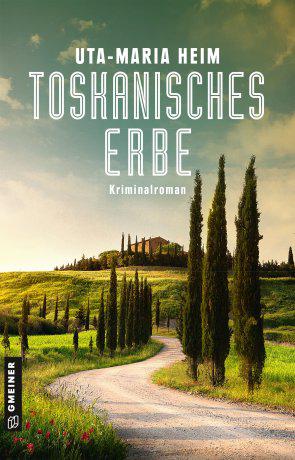
Die Kirche, das Leben
(rum) Uta-Maria Heim räumt auf. Im vierten Teil ihrer Toskana-Reihe führt sie ihre zuvor wild zwischen Florenz und Konstanz mäandernden Erzählfäden zusammen. Bis dahin war ein totgeglaubter Mafioso wieder aufgetaucht und wurde dann abermals erschossen, gab ein katholischer Geistlicher für eine dem Pietismus und dem IS entronnenen Frau Zölibat und Pfarrstelle auf, mischte ein vatikanischer Geheimdienst, ein dubioser Geheimbund, eine toskanische, schwer katholische Mafia samt einer bestens vernetzten und gut bewaffneten ehemaligen Verfassungsschützerin munter mit.
Die Lage also war eher unübersichtlich und so ganz offen liegt freilich auch diesmal nicht alles da. Protagonistin Giula Franca hat mit alten Geschichten zu kämpfen. Ehemalige Weggefährten entpuppen sich als Mafiosi mit unklaren Interessen, sie selbst wird bedroht und in Florenz angeschossen, flieht nach Konstanz, wo es auch keine Sicherheit gibt. Der dortige Pfarrer ist zwar wieder im Amt, hat aber neben den Ostervorbereitungen mit dem Verschwinden eines mehrfach behinderten Kindes zu tun. Außerdem sitzt sein Vater offensichtlich simulierend im Pflegeheim. Dazu sorgt etwas Paranoia bei allen Beteiligten nicht ganz zu Unrecht für Unruhe.
Gut, so richtig geordnet klingt auch das nicht und doch lichtet Heim hier mit ein paar herzhaften Hieben das Chaos und bringt alles zusammen, was sie in den vorangegangenen Romanen angezettelt hat. Bis auf den etwas überstürzten Schluss ist ihr damit wieder ein abgedrehter und unausrechenbarer Roman gelungen, eine mit rasiermesserscharfem Witz überspitzte Erzählung aus dem Hier und Heute. Die Romane sind eine stete, so intellektuelle, wie unterhaltsmae Auseinandersetzung mit katholischer Kirche und regionaler Verfasstheit, so irrwitzig, dass da eine kleine Splattereinlage ebenso Platz findet wie ruppig philosophische Volten. „Das Internet frisst die letzten Brosamen Verstand“, heißt es da, aber: „Es war schon schlimmer. Wir machen uns nur wichtig, wenn wir vom zeitgeistigen Weltuntergang reden.“ Die Geschichte ist gnadenlos überdreht, im einen Moment schrill, spröde, hanebüchen, im nächsten ganz ruhig, klar und analytisch. Keine holzt mit so viel Verve und Esprit durch die Regionalkrimiabteilung.
Uta-Maria Heim: Toskanisches Erbe. Roman, Messkirch, 2020. Gmeiner-Verlag, 311 Seiten, 15 Euro.
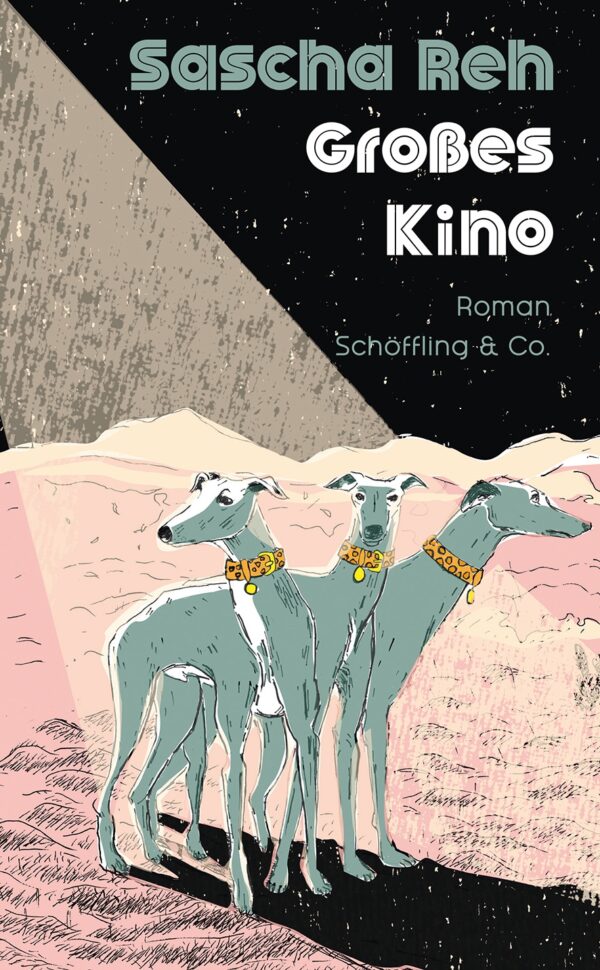
Zurück nach Westerland
(FS) Alles nimmt seinen Anfang, als Carsten Wuppke, ehemaliger Neuköllner Sozialarbeiter und derzeit selbst mit einer Bewährungsstrafe belegt, bei einem späten Einkauf im Supermarkt das Wort für eine bedrängte Kassiererin und gegen einen recht forsch auftretenden Polizisten ergreift. Weil er sich auf Aufforderung nicht ausweisen kann, ergreift er die Flucht. Dass ihm hierbei im Stolpern ein Joghurt aus der Hand fliegt, der wiederum einen arabisch fluchenden Vespafahrer zu Fall bringt, ist nur ein winziges Dominosteinchen in einer Kettenreaktion, die in rasantem Verlauf arabische Clans, die italienische Mafia und korrupte Politiker mit sich reißt und in deren Folge so mancher nicht mehr wieder aufsteht. Wuppke wird – als Wiedergutmachung für den Joghurtanschlag und das Ausleihen eben jener Vespa – von einem Clanchef nach Sylt entsandt, um dort einen Grundstücksdeal in die Wege zu leiten, dem lediglich ein kleines Hindernis im Weg steht: Es handelt sich um ein Naturschutzgebiet und auf der Insel herrscht Kommunalwahlkampf.
Wuppke, dessen einzige Waffen sein loses Mundwerk und ein schier unauslöschlicher Optimismus sind, stolpert mehr oder weniger planlos durch die Sylter Politik- und Unterwelt und schafft es dennoch, eine Spirale der Gewalt immer weiter zu drehen und dennoch nahezu unbeschadet aus der Sache herauszukommen. Wie eine Figur aus einem Film der Coen-Brüder, aber ohne deren emotional-melancholische Tiefe, kommt Wuppke daher. Was diesen Roman zu etwas besonderem macht, ist die Erzählstimme, die das gesamte Geschehen wie einen Filmplot darstellt und gleichzeitig kommentiert. Der Erzähler wird zum Regisseur eines geschriebenen Films,arbeitet auf verschiedenen Zeitebenen, mit Schnitten und Gegenschnitten, inszeniert die Kulissen und die Beleuchtung, zitiert Szenen aus Filmen und Fernsehsereien. Im selben Atemzug macht er sich über diese Erzählweise, über unglaubwürdige Zufälle und sogar über offensichtliche logische Brüche lustig und tritt immer wieder aus seiner Rolle heraus („Schön ist das, wenn der Autor so mitdenkt“). Zuweilen überschreitet Reh in seinem Spiel aus Film- und Syltklischees die Grenzen zur Albernheit doch arg und man wünscht sich, er hätte hin und wieder einen Gang zurückgeschaltet. Unterm Strich aber ist ihm eine extrem rasante Krimikomödie voller Wortwitz und Situationskomik gelungen, im wahrsten Sinne „Großes Kino“.
Sascha Reh: Großes Kino. Schöffling & Co, Frankfurt 2020. 320 Seiten, 18 Euro.

Höllisch vertrackt
(JF) Dass unbegründeter literarischer Ehrgeiz sich ganz wunderbar gewinnbringend verwerten lässt, ist seit langer Zeit bekannt. Ein ganzer Geschäftszweig beruht darauf, ambitionierten Lyrikerinnen, Romanciers und Dramatikern, deren Talent sich den Lektoraten dieser Welt partout nicht erschließen will, zur Veröffentlichung zu verhelfen. Hierzulande nennt man die entsprechenden Unternehmen schnöde „Selbstkostenverlage“, in Britannien tragen sie den passenderen Namen „Vanity Publishers“. Denn tatsächlich geht es um die eitle Freude, den eigenen Namen auf einem Buchumschlag lesen zu können, auch wenn sich sonst niemand für das Werk interessieren sollte, schon gar nicht die vom gleichen Schicksal Betroffenen. Nun stelle man sich ein ganzes Dorf vor, dessen Bevölkerung kollektiv dem Wahn verfallen ist, über eine besondere Begabung zum kreativen Schreiben zu verfügen. Ein Dorf, dessen Postamt vor allem Manuskripte hinaus in die Welt expediert und die entsprechenden Retouren entgegennimmt. Solch ein Ort ist der fiktive Flecken Dichtersruh irgendwo in der Schweiz. Einst soll Goethe hier übernachtet haben, vielleicht rührt der unselige schriftstellerische Trieb seiner Einwohner von daher, wer weiß. Für einen Teufel jedenfalls, der sich zum Ziel gesetzt hat, möglichst viel Unheil über die Menschen zu bringen, gibt es kaum ein idealeres Terrain. In Falle Dichtersruh tritt er als Verleger auf, initiiert einen Literaturwettbewerb und kann abwarten, bis Neid und Missgunst ihr zerstörerisches Werk getan haben. Einen kämpferischen Pfarrer, dem ein geladener Revolver zugespielt wird, hatte er allerdings nicht einkalkuliert …
So zumindest liest sich der autobiographische Bericht, welcher einem jungen Verlagsangestellten vom Verfasser persönlich vorgetragen wird, woraufhin dieser, ebenfalls von schriftstellerischen Ambitionen heimgesucht, nichts Besseres zu tun hat, als ihn zum Mittelstück einer Erzählung zu machen, die wiederum auf dem Schreibtisch eines dritten Ich-Erzählers landet. Dieser ist tatsächlich ein Romanautor und wird, seit ihn ein kleiner Bucherfolg bekannt gemacht hat, von angehenden Schriftstellern mit Manuskripten bombardiert, die er gefälligst lesen, begutachten und in einem Verlag unterbringen soll. Und das scheint in diesem Fall auch zu gelingen.
Es ist ein höllisch vertrackter Plot, den sich der italienische Autor Paolo Maurensig für seinen Roman „Der Teufel in der Schublade“ ausgedacht hat. Und der sorgt für ein teuflisches Lesevergnügen. Versprochen!
Paolo Maurensig: Der Teufel in der Schublade. Aus dem Italienischen von Rita Seuß. 128 Seiten. Nagel & Kimche. München 2020. € 18,00.

Rum zum Frühstück, Rum zu Mittag
(AM) Es gibt sie noch, die verblüffenden literarischen Ausgrabungen. Der Erzählband Das Geisterschiff mit 13 Geschichten von Richard Middleton, jetzt in der Reihe „Steidl Nocturnes“ in schöner Ausstattung erschienen, ist so eine. In Großbritannien gilt Middleton als ein Fixstern, bei uns ist er ein Unbekannter. Wie G.K. Chesterton und Arthur Machen war er Mitglied der Londoner Dichtergruppe „New Bohemians“, er beeindruckte den jungen Raymond Chandler und brachte ihn auf Dichterkurs. Er selbst wurde keine dreißig, setzte seinem vorbildlich bohèmehaften Leben 1911 in Brüssel mit Chloroform ein Ende. Seine einzige, bisher auf Deutsch publizierte Geistergeschichte „Auf der Landstraße von Brighton“ erschien 1978 in der Anthologie „Gespenster“ bei Diogenes. Der Freiheit des Landstreichens kann darin sogar manches Gespenst kaum widerstehen. In der Titelgeschichte „Das Geisterschiff“ ankert nach einem Wirbelsturm ein Piratenschiff mitten auf einem Rübenacker nahe des Örtchens Fairfield, die Besatzung schenkt an die lebenden und toten Dorfbewohner freizügig Rum aus, das jahrhundertealte Gleichgewicht zwischen Geistern und Menschen gerät ins Wanken und bald heißt es:
„In Fairfield wird so viel gesoffen,
da braucht man gar kein Butterbrot,
Rum zum Frühstück, Rum zu Mittag,
Rum zum Tee und Abendrot!“
Arthur Machen meinte: „I declare I would not exchange this short, crazy, enchanting fantasy for a whole wilderness of seemly novels.“ In „Die Seele eines Polizisten“ trifft ein allzu menschlicher und deswegen schlechter Polizist einen schlechten Mörder. „Ich hasse Sie und Ihresgleichen!“, ruft er kraftlos. „Sie rechtfertigen die Existenz der Polizei. Sie zwingen mich dazu, mich selbst zu verachten, weil ich einsehe, dass Ihre Verbrechen ebenso die meinen wie die Ihren sind.“ Das nimmt, um 1910 geschrieben, Simenons Haltung und das vieler zeitgenössischer Krimiautoren vorweg, die im Verbrecher den Bruder und im Verbrechen einen gesellschaftlichen Spiegel sehen.
Richard Middleton: Das Geisterschiff (The Ghost Ship: And Other Stories, 1912). Herausgegeben und aus dem Englischen übersetzt von Andreas Nohl. Steidl Nocturnes. Steidl Verlag, Göttingen 2020. Fester Leineneinband, 128 Seiten, 18 Euro.
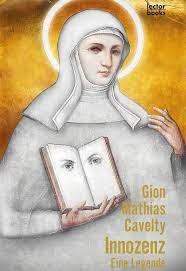
Ein unbeschriebenes Buch
(FS) Seine Quifezit-Trilogie und der Ratgeber-Roman „Endlich Nichtleser“ liegen mittlerweile rund 20 Jahre zurück. Schon damals hat der Schweizer Autor Gion Mathias Cavelty dem Buch als solchem zu Eigenleben verholfen, hat gar vor den Gefahren des Lesens gewarnt. In seinem allerneuesten Streich macht Cavelty ein Buch zum Erzähler: „Ich bin das Buch, das Dich liest. In mir steht kein einziges Wort. Meine Seiten sind weiß wie das weißeste Weiß.“ beginnt das Buch seine Erzählung. Und ebenso ungewöhnlich wie diese Erzählperspektive ist auch die Geschichte, die nun folgt: Erzählt wird von der Reise des Heiligen Innozenz de Innozentis, der vom Papst entsandt wird nach Schwamendingen, wo ketzerische Dinge geschehen. Als Käfersammler getarnt, mit allerlei Foltergerät im Köfferchen, gerät der Inquisitor alsbald an Dämonen und Schwarzmagier, die nicht weniger als das Ende der Welt herbei sehnen.
Die „Legende“, die Cavelty hier auftischt, ist ein vorzüglicher, postmoderner Spaß voller Absurditäten und Anspielungen. Hier steht in der unheiligen Bibliothek neben dem „Necronomicon“ auch „Die Andouillette“ (ein Roman Caveltys) oder „Dark Doorway of Rumburak“, eine Verbeugung vor der tschechoslowakischen Kinderfilmproduktion der 1980er Jahre. Der hochtrabend biblisch anmutende, von Pathos triefende Erzählstil des weißen Buches, die genüsslichen, an de Sade angelehnten Beschreibungen eines wahrhaft satanischen Gelages mündet darin, dass ein anderes Buch, jenes mit sieben Siegeln, geöffnet wird und das Böse seinen Lauf nimmt.
Caveltys Roman ist schwer einzuordnen. Es handelt sich keineswegs um einen Krimi, das sei warnend erwähnt – dennoch entbehrt die Einordnung unter den „Bloody Chops“ nicht einer gewissen Berechtigung, denn Körperflüssigkeiten jedweder Art fließen reichlich. Wer das Spiel mit literarischen Versatzstücken mag, wer zu schätzen weiß, wenn Erzählstrukturen aufgebrochen und ad absurdum geführt werden, sollte Spaß an diesem außergewöhnlichen Werk haben. Und sei es nur, um sich hinterher zu fragen: „Was zur Hölle habe ich da gerade gelesen?“
Gion Mathias Cavelty: Innozenz. 176 Seiten, lectorbooks, 18 Euro.

Isa Blumberg, eine Noir-Heldin aus Wien
(hpe) Es ist neblig in den Schweizer Alpen, alles grau, und es schneit. Nebulös ist der Fall, der Isa Blumberg aus Wien in die Berge führte. Ein Auftraggeber, der in einem »Wohnzimmer mit den Ausmaßen eines Tennisplatzes, das nach Einsamkeit und exquisiten Putzmitteln roch«, in Wien sitzt, hat sie beauftragt, die Hintergründe eines mysteriösen Unfalls seines Onkel Robert Selby in der Schweiz zu recherchieren. Was war da wirklich passiert? Und was wollte Selby, ein Scriptdoctor aus den USA, überhaupt in der Schweiz?

In einem heißen Sommer in Wien ließ der aus der Schweiz stammende Autor Andreas Niedermann vor zwei Jahren Isa Blumberg im Roman »Blumberg« zum ersten Mal auftreten Jetzt schickt er die 53-jährige »Meisterin des Ungefähren«, die offenbar zu einer Serienheldin wird, in Blumberg 2 – Die Wachswalze mitten im kalten Winter in die Schweizer Alpen. Im namenlosen Ort, in dem sie landet, stochert sie sowohl buchstäblich wie metaphorisch im Nebel. Es geht um eine reichlich verworrene Familiengeschichte. Ausgangspunkt ist ein Doppelmord vor vielen Jahrzehnten in einer Wetterstation auf einem Berggipfel, der Generationen später noch nachwirkt, sowohl in den Familien der Opfer wie in der des Täters. Daneben spielen weitere Beziehungs- und Familienangelegenheiten in die Geschichte hinein. Die Beziehungen Blumbergs zu ihrem Sohn, der Priester ist, nun aber auf Sinnsuche durch die Welt zieht, zu einer Ex-Partnerin und zu Düzen, einer türkischen Taxifahrerin aus Wien, die sie in die Schweiz gefahren hat. Und dann ist da Düzens Konflikt mit dem Vater ihres Babys, der ihr für ihr Verschwinden ernsthaft tödliche Rache androht.
Noir-Krimis sind Neuland für den seit 1989 in Wien lebenden Niedermann. Er debütierte vor über dreißig Jahren mit «Sauser», einem Roman, der mir in guter Erinnerung geblieben ist. Sein literarischer Kompass ist geeicht durch die Autoren der Beat Generation und deren Nachfolger wie Charles Bukowski oder Jörg Fauser. Der Name seiner Protagonistin könnte durchaus eine Reverenz an Fauser sein, dessen »Schneemann« Blum hieß.
Die eigentlichen Krimi-Plots sind für Niedermann nicht zentral, sondern geben ihm den Rahmen für Abschweifungen und Betrachtungen zum modernen Leben und ätzenden Kommentaren dazu. Seine beiden letzten Bücher zeichnen sich aus durch eine direkte und kraftvolle Sprache, durch illusionslose, aber nicht hoffnungslose Blicke auf die Welt, in der wir leben, und durch eine Prise Existenzialismus. Im lakonischen Reim «Fauser, Glauser, Sauser» hatte Niedermann in seinem Erstling seine literarischen Koordinaten zusammengefasst. Jörg Fauser, der deutsche Kultautor der 1970er und 1980er. Friedrich Glauser, der Schweizer Außenseiter und geniale Pionier der deutschsprachigen Kriminalliteratur. Und Sauser? Ist der bürgerliche Name des französischsprachigen Schweizer Autors und Abenteuers Blaise Cendrars. Niedermann lässt sich diesen Helden zwar nicht reimend anfügen, aber literarisch bis zu einem gewissen Grad durchaus.
Andreas Niedermann: Blumberg 2 – Die Wachswalze. Edition Baes, Wien 2020. 287 Seiten, 20 Euro. – Andreas Niedermann: Blumberg. Songdog Verlag, Wien 2018. 314 Seiten, 20 Euro. – Beide Bände zusammen 33 Euro über: office@edition-baes.com

Jenseits von Pocahontas
(FS) Mit „Tage ohne Ende“ legte der Irische Autor Sebastian Barry 2018 einen faszinierenden Western aus der Zeit des amerikanischen Bürgerkrieges vor. Wie sich die Siebzehnjährigen John Cole und Thomas McNulty zunächst wegen ihrer androgynen Erscheinung inmitten rauer Männlichkeit als Tanzmädchen in einem Saloon für Bergarbeiter verdingen, wie sie später zur Armee gehen und zwischen Befehl und Gehorsam inmitten von blutigen Gräueltaten ihre Menschlichkeit nicht verlieren, ist mit sprachlicher Virtuosität in Szene gesetzt. Nun folgt mit „Tausend Monde“ eine Fortsetzung, die jedoch nur bedingt diese Bezeichnung verdient. War es in „Tage ohne Ende“ Thomas, der lakonisch-distanziert von seinen Erlebnissen berichtete, wechselt nun die Erzählperspektive hin zu Winona, jenem Lakota-Mädchen, das die beiden Männer in ihre Obhut genommen haben (nachdem ihr gesamter Stamm vernichtet worden war). Das könnte schiefgehen, eine „Wilde“ zur Erzählerin zu machen. Wie gut, dass Winona bereits als junges Mädchen in Gefangenschaft Unterricht im Lesen und Schreiben der englischen Sprache erhalten hat. So erklärt sich, dass Winonas Stil letztlich sogar elaborierter sein kann als der von Thomas im ersten Buch.
Auch wenn man „Tausend Monde“ zweifellos für sich lesen kann, hilft es doch sehr, den Vorgängerroman zu kennen, um sich bei den Figuren zurechtzufinden und Anspielungen auf die Vergangenheit zu verstehen. So gewinnt auch die Tatsache eine tiefere Tragik, dass Winona keine wirkliche Ahnung hat, welche Rolle ihre beiden liebevollen Ziehväter damals bei der Auslöschung ihrer Familie gespielt haben. Winona ist zu einer jungen Frau herangewachsen, ihr Talent für Zahlen und Sprache haben ihr eine Anstellung in der Buchhaltung eines liberalen Anwalts verschafft. Der etwas einfach gestrickte Jas Jonski macht ihr, dem Lakota-Mädchen, den Hof. Winona erwidert zögerlich seine Gefühle, doch ihr Leben zerbricht, als sie überfallen und vergewaltigt wird. Ohne detaillierte Erinnerung an die Tat kann sie nicht ausschließen, dass ihr Verlobter womöglich beteiligt war, sie hat aber eine dunkle Ahnung und wendet sich von ihm ab. Lange bleibt im Unklaren, was tatsächlich in jener Nacht geschehen ist. Als Jas Jonski ermordet wird, fällt der Verdacht sofort auf Winona.
Barry führt tief hinein in die Zeit unmittelbar nach dem Amerikanischen Bürgerkrieg, als die Verhältnisse noch sehr instabil sind und die Rebellen ihre Chancen wittern. Schwarze und Lakota verfügen über keinerlei Rechte und auf wessen Seite der Sheriff steht, ist nie gewiss. „Tausend Monde“ erzählt die Geschichte einer Rache – es ist aber auch ein Sittengemälde der Nachbürgerkriegszeit in den USA. Zugleich ist es eine Mischung aus Coming of Age- und Coming Out-Roman, denn Winona, die selbstverständlich mit zwei Vätern aufgewachsen ist, deren einer bisweilen in Frauenkleider schlüpft, fühlt sich in Männerkleidung stark und geht eine Beziehung mit einem anderen Mädchen ein. Die Frage nach der Identität zwischen Geschlechterrollen, Hautfarbe und gesellschaftlichem Stand steht im Mittelpunkt einer tragischen Handlung.
Sebastian Barry: Tausend Monde (Thousand Moons, 2020). Aus dem Englischen von Hans-Christian Oeser. Steidl Verlag, Göttingen 2020. 256 Seiten, 24 Euro.
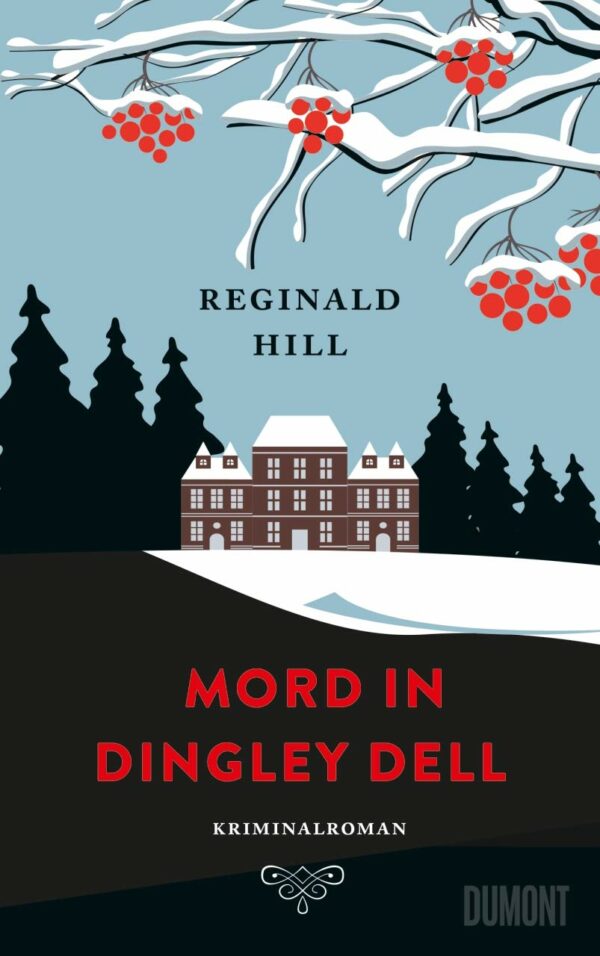
Albern
(TW) Unter dem Pseudonym Patrick Ruell schrieb Reginald Hill 1972 den Roman „Red Christmas“, der jetzt als Mord in Dingley Hill unter seinem Klarnamen zum ersten Mal auf Deutsch erschienen ist. Das hört sich nach einem gepflegten Landhauskrimi an, denn auf dem namensgebenden Anwesen findet, logischerweise, eine Charles-Dickens-Reenact-Weihnachtsfeier statt, ganz so, wie in den „Pickwickier“ vorgegeben. Es tummeln sich exzentrische Figuren in viktorianischen Kostümen, bis das Morden beginnt. Weil Hill den Roman als Ruell verfasst hat – dieses Pseudonym hatte er für seine Polit-Thriller benutzt – verwundert es nicht, dass allmählich eine Spionagegeschichte, wie sie nur im Kalten Krieg funktioniert hat, die Dominanz über den Roman übernimmt. War das Buch bis dahin entzückend altmodisch wird es mit dem Auftritt der Spione und Killer genauso entzückend albern. Oder rührend naiv, wenn sich die Geheimdienstchefs des Westens von den Sowjets beim Diner fangen lassen. Genauso rührend steinzeitlich sind die Genderverhältnisse, wenn die Topagentin sich nackt räkelt, um die Bösen zu locken. Ach ja, those were the days …, aber selbst gemessen an den zeitgenössischen Standards von le Carré, Deighton, Freemantle et al. doch eher ein überflüssiges, aber brillant geschriebenes Werklein. Und nein, als Parodie oder Satire kann es auch nicht durchgehen, dazu ist es dann doch zu un-komisch.
Reginald Hill: Mord in Dingley Hall. Deutsch von Karl-Heinz Ebnet. Dumont. 264 Seiten.
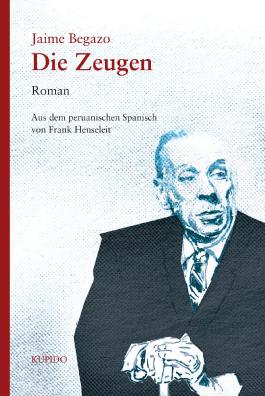
„Emma Zunz“ – revisited
(TW) Ziemlich raffiniert tickt „Die Zeugen“, ein eher schmaler Kurzroman des peruanischen Borges-Spezialisten Jaime Begazo. Ein echter, aber fiktiver Begazo trifft den echten, aber fiktiven Jorge Luis Borges 1986 (also kurz vor dessen Tod) in Genf, um mit ihm über „Emma Zunz“ zu reden, eine der finstersten Geschichten aus Borges´ Zyklus „Das Aleph“. In dieser Story fällt einmal, anscheinend an marginaler Stelle, der Name Milton Sills. Eigentlich ein „unnützes Detail“ im Sinne von Roland Barthes, durch das der „rätselhafte Charakter jeder Beschreibung“ hervortritt. Die Emma Zunz in Borges Geschichte rächte sich grausam an dem Mann, der ihren Vater in den Tod getrieben hatte, jetzt holt Begazo eine ganz neue Geschichte über Emma und ihren Verehrer Milton Sills aus dem vorgeblich zögerlichen Borges heraus, nur um festzustellen, dass die Verhältnisse von Realität und Fiktion noch komplizierter sind als sie bei Borges´ Texten eh schon thematisiert werden. Und so ist „Die Zeugen“ eine Art Kriminalgeschichte zweiter Ordnung. Großartig.
Jaime Begazo: Die Zeugen. Dt. von Frank Henseleit. Kupido, 121 Seiten.











