
Bücher kurz serviert
Kurzbesprechungen von fiction – Unsere Rubrik „non fiction, kurz“ fällt diesmal aus. Hier Hanspeter Eggenberger (hpe), Joachim Feldmann (JF), Günther Grosser (GG), Kasten Herrmann (KH), Frank Rumpel (rum) über:
Ron Corbett: Preisgegeben
Mark Fahnert: Lied des Zorns
Katherine Faw: Young God
Frank Göhre: Verfluchte Liebe Amsterdam
Tommie Goerz: Meier
Young-ha Kim: Aufzeichnungen eines Serienmörders
Carlo Lucarelli: Hundechristus
Liz Moore: Long Brigth River
Isa Theobald & David Gray: Requiem für Miss Artemisia Jones
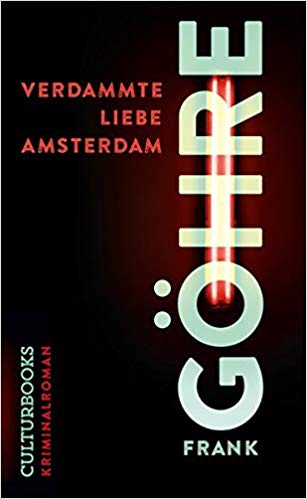
Knapp & komplex
(JF) Zwei Brüder, eine Frau. Doch das ist lange her. Als Schorsch Köster Jutta wiedersieht, stellt er lediglich fest, „dass ihr Hintern doch etwas breiter geworden ist“. Er hat bei ihr geklingelt, weil sein Bruder tot ist, erschlagen auf einem Autobahnrastplatz. Doch Jutta weiß nichts. Und schon ist Schorsch wieder unterwegs. Ein Notizheft im Bankschließfach des Bruders führt ihn erst nach Recklinghausen, dann nach Amsterdam. Als Privatdetektiv soll er gearbeitet haben und offenbar hat sein letzter Auftrag etwas mit seinem gewaltsamen Ende zu tun.
Schorsch Köster ist die Hauptfigur in Frank Göhres neuem Kriminalroman „Verdammte Liebe Amsterdam“, ein Mann rascher Aktion. Mit einem Freund, auf den er sich verlassen kann. So kommt er auch in halbwegs heilem Zustand zurück aus Amsterdam, wo er zu Ende führt, was sein Bruder begonnen hat. Was nicht heißt, dass nun alle Probleme gelöst wären, vor allem nicht diejenigen, deren Ursprung Jahrzehnte zurückliegt. Also kommt es wiederholt zum Einsatz von Gewalt, und das geschieht ebenso plötzlich wie beiläufig. „Aus, Ende, abgekackt das Schwein“, lautet der Kommentar in einem dieser Fälle.
Nein, friedlich geht es nicht zu in der fiktiven, der Realität allerdings manchmal täuschend ähnlichen, Welt des Frank Göhre, der für seinen verwickelten Plot dank einer knappen und prägnanten Erzählweise gerade mal 150 Seiten braucht. Rückblenden werden durch Jahreszahlen kenntlich gemacht, trotzdem muss man bei der Lektüre höllisch aufpassen, um nicht den Faden zu verlieren. „Verfluchte Liebe Amsterdam“ ist kein Roman zum Ausruhen, aber einer der Aufmerksamkeit belohnt. Und das kommt in der aktuellen Kriminalliteratur nicht allzu oft vor.
- Frank Göhre: Verfluchte Liebe Amsterdam. Kriminalroman. 157 Seiten. Hamburg: Culturbooks 2020. € 15,00.
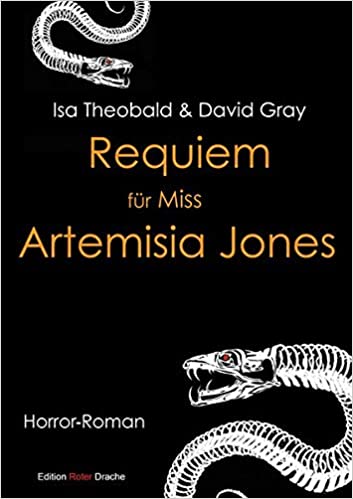
Horrrrrror-Roman!
(JF) Britannien im Jahre 1892: ein Zentrum wirtschaftlicher und politischer Macht regiert von einer elitären Oberschicht. Doch manchen ist das nicht genug. Sie schließen sich in Geheimbünden zusammen, um ihren Einfluss zu mehren. Einer davon ist die First Lodge of Rightful Gentlemen, deren Mitglieder seit Jahrhunderten dem Fürsten der Finsternis huldigen. Doch allen Jungfrauenopfern zum Trotz bleibt das Bemühen des Satanistenvereins fruchtlos: Der Teufel hat sich bislang nicht sehen lassen, ja, er weiß nicht einmal von der Existenz seines Fanclubs. Und als ihm ein Hölleninsasse, während seines Erdenlebens ein überzeugter Satanist, von einem hochriskanten Unterfangen der Bruderschaft berichtet, ist er alles andere als begeistert. Aus Gründen, die zu kompliziert sind, um hier referiert zu werden, könnte die Opferung der Bibliothekarin Artemisia Jones auf dem Anwesen des Clubmitglieds Sir Reginald Bullington fatale Konsequenzen haben. Also muss Satan, obwohl ein notorischer Faulpelz, höchstselbst eingreifen und zwar in seiner Lieblingsgestalt: „der eines mittelalten, leicht übergewichtigen Kleinbürgers mit Glatze“.
„Requiem für Miss Artemisia Jones“ nennt sich „Horror-Roman“, ist aber, allem vergossenen Blut zum Trotz, weniger gruselig als lustig. Isa Theobald und David Gray bedienen sich großzügig im Fundus viktorianischer Klischees, um ihren eskapistischen Spaß auszustatten, verzichten aber manchmal darauf, die verwendeten Requisiten ordentlich abzustauben. Ganz Zeitgenosse hingegen ist der munter umgangssprachlich parlierende Teufel. Das ist hübsch gemacht, rechtschaffen sinnfrei und ziemlich unterhaltsam.
- Isa Theobald & David Gray: Requiem für Miss Artemisia Jones. Horror-Roman. Edition Roter Drache, Rudolstadt 2020. 280 Seiten, 15 Euro.
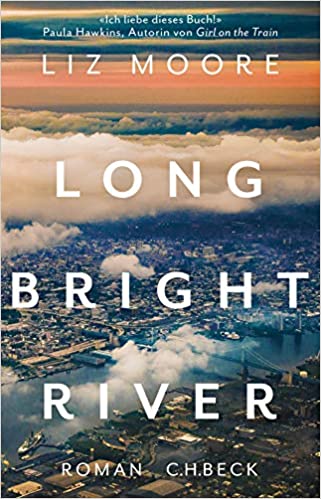
Genresprengender Roman
(KH) Liz Moore verbindet in „Long Bright River“ auf der Folie eines verfallenden Stadtteils von Philadelphia die Genres des Gesellschafts-, Familien und Kriminalroman. Sie überbrückt dabei mit zunehmender Sogkraft auch den immer wieder diskutierten „Gap“ zwischen E- und U-Literatur.
Die Hauptprotagonistin Mickey ist alleinerziehende Mutter, sorgende Schwester und Streifenpolizistin im berüchtigten Philadelphia-Stadtteil Kensington. Kensington gilt als ein Viertel mit der höchsten Dichte an Drogen und Drogenabhängigen in den Vereinigten Staaten. In den von Liz Moore eindringlich geschilderten verfallenden Hausruinen und aufgegeben Geschäften tummeln sich hier die Junkies, sind auf der Jagd nach dem nächsten Schuss, besorgen sich Geld durch Dealen, Klauen und Prostitution.
Zu dieser Szene gehört auch Kacey, die drogenabhängige Schwester von Mickey. Schon früh hatte Mickey nach dem Tod der alleinerziehenden Mutter die Verantwortung für ihre jüngere Schwester übernommen und sie dann doch an die Drogen verloren.
Zeitgleich mit dem Begin einer Mordserie an jungen Prostituierten in Kensington verschwindet Kacey nun und Mickey, die die erste Tote findet, beginnt sowohl nach dem Mörder wie ihrer Schwester zu suchen. Sie bittet dabei ihren langjährigen und im Dienst schwer verletzten Ex-Partner zur Hilfe und trifft auf ihren Ex-Mann Simon, der inzwischen Detective ist und eine undurchsichtige Rolle spielt. Zunehmend bekommt Mickey einen fürchterlichen Verdacht „und zum ersten Mal in meiner Laufbahn als Polizistin befällt mich das Gefühl, dass ich auf der falschen Seite von etwas Wichtigem bin.“
Liz Moore entwickelt ihre verschiedenen Erzählstränge bedächtig und nimmt sich viel Zeit, um die Vergangenheit von Mickey und Kacey zu beleuchten. Während Kacey schon immer das lebenslustigere und beliebtere Mädchen war, war Mickey ein ernsthaftes und verantwortungsbewusstes Mauerblümchen, das sich dann auf einen viel älteren Polizisten einließ. Im Verlaufe des Romans offenbart sich schließlich auch ein lange zurück gehaltenes Geheimnis im Leben der beiden Schwestern, das ein zweifelhaftes Licht auf die eigentlich immer verantwortungsvolle und ihr Kind Thomas liebende Mickey wirft.
Während die Erzählstränge und damit auch die verschiedenen Genres des Gesellschafts-, Familien- und Kriminalroman sich anfangs nicht so recht ineinander fügen wollen und nebeneinander herlaufen, gelingt das mit zunehmender Dauer immer besser. Liz Moore zieht den Leser in den eher sublimen als spektakulären Sog ihres komplexen Erzählkosmos. Psychologisch dicht entwickelt sie eine Heldin, die sich zwischen ihrer Rolle als alleinerziehender Mutter, verantwortungsbewusster Schwester und – neben ihrem regulären Streifendienst – privat ermittelnder Polizistin aufreibt und schließlich vom Dienst suspendiert wird.
In einem letztlich doch fast schon wieder klassischem Showdown stellt Mickey schließlich den Serienmörder und auch das Verschwinden ihrer Schwester löst sich in einer überraschenden Wendung auf.und es kommt zu einem kleinen Happy End.
- Liz Moore: Long Brigth River. Aus dem Englischen von Ulrike Wasel und Klaus Timmermann. C.H. Beck, 416 S.

Fachwissentlich verholzt
(JF) Islamistischer Terror, sehr geheime Geheimdienstler, rechtsradikale Aufrührer, dazu mindestens drei Rachegeschichten und jede Menge internationaler Schauplätze: Mark Fahnerts Roman „Lied des Zorns“ hat alles, was ein zünftiger zeitgenössischer Thriller braucht. Auch die Präsentation des Plots in vielen kurzen Kapiteln inclusive veritabler Cliffhanger hat etwas für sich. Doch leider bietet das Debüt des schreibenden Polizisten – laut Verlag „mit den Mechanismen der deutschen Sicherheitsbehörden bestens vertraut“ – noch viel mehr, nämlich hölzerne Dialoge und seitenlange Erklärungen, in denen der Autor sein unbestrittenes Fachwissen ausbreitet. Um neben den exzellenten Handwerkern des Genres, Christian Ditfurth zum Beispiel, bestehen zu können, braucht es wohl doch noch ein bisschen Übung.
- Mark Fahnert: Lied des Zorns. Thriller. 430 Seiten. München. Piper 2020. € 12,99.

Düster, knapp, hart, schnell
(hpe) »You Do What You Want: / You Burn Out Your Heart / You Burn Out My Heart / Then You Eat My Heart / You Cut Out Your Heart / Then You Eat Your Heart«, singt Michael Gira in Young God (1984). Der Song der New Yorker Kultband Swans gab dem Debüt von Katherine Faw den Titel. Nicht weil sie den Song besonders möge, sondern weil sie denke, dass Nikki darauf abfahre, liess die amerikanischen Autorin die Kritikerin Kirsten Reimers wissen, die zur deutschen Ausgabe ein informatives Nachwort beigetragen hat. Der Rocksong gibt Stimmung und Takt für den Roman vor: düster, knapp, hart, schnell. Nikki ist die Protagonistin dieses schmalen Romans. Sie ist 13. Nach dem Tod ihrer Mutter – man weiss nicht, ob es ein Unfall oder ein Suizid war – klaut sie deren Freund das Auto und fährt hinauf in die Berge irgendwo in North Carolina zu ihrem Vater. Der ist unlängst aus dem Knast gekommen und haust dort in einem Trailer mit einem Mädchen, das kaum älter als Nikki ist. Er schickt das Mädchen auf den Strich und handelt mit Drogen.
Die heute in New York lebend Katherine Faw stammt aus der Gegend, die sie eindrücklich beschreibt. »Den ganzen Weg entlang gibt es beinahe nur Kirchen. Die alten sind Ziegelbauten. Diejenigen, die sich von ihnen verarscht fühlten und abgespalten haben, sind in Ladengeschäfte gezogen. Und die, die sich davon verarscht fühlten und abgespaltet haben, in verlassene Tankstellen.« Es ist der radikal reduzierte Erzählstil, der diesen Roman spektakulär macht. Fünf Jahre habe Faw daran gearbeitet und ihn am Ende von 100.000 auf 22.000 Wörter gekürzt, berichtet Reimers. So stehen auf manchen Seiten nur noch zwei Zeilen, wie zum Beispiel: »Sie hört etwas. Ein Rumpeln. Sie rennt in die Küche und greift ein Messer, aber es war nichts.« Oder gar nur zwei Wörter: »Nikki schreit.«
Nikki will nicht zurück in die Schule. Sie will ins Geschäft einsteigen. Sie lernt schnell. Etwa, dass ein Mädchen je jünger es ist umso mehr einbringt. Schon bald macht sie ihrem Vater vor, wie man einträglicher mit Drogen handelt. Doch sie verfällt selbst ihrer Handelsware. »Heroin ist das größte Geheimnis von allen. Nadeln sind der geheimste Teil davon, und schon seit sie ein kleines Mädchen war, hat sie Geheimnisse geliebt.«
Von Drogen, Prostitution, Pädophilie, Gewalt, prekären Eltern-Kind-Beziehungen handelt diese Geschichte von ganz unten in der ruralen Gesellschaft in den heutigen USA. Mit der Zeit werden die Grenzen zwischen Realität, Alpträumen und Drogenrausch immer unschärfer. Dabei hat man nie Grund zu zweifeln, dass das alles böse enden wird. Faw erzählt ohne explizite Psychologisierungen und Erklärungen. Sehr filmisch. Streckenweise atemberaubend. Country Noir der gnadenlosen Art. Es tut manchmal fest weh beim Lesen.
PS. Der Song »Young God« hat übrigens nicht nur diesem Roman den Namen gegeben, sondern bereits 1985 auch der dann international bekannt gewordenen Schweizer Band The Young Gods.
- Katherine Faw: Young God (Young God, 2014). Aus dem Englischen von Alf Mayer. Mit einem Nachwort von Kirsten Reimers. Polar Verlag, Stuttgart 2020. 228 Seiten, 12 Euro.

„Nature Noir“
(JF) Dass Lucy Whiteduck und Guillaume Roy einander fanden, war ein Glücksfall. Doch die gute Geschichte ist schon zu Ende, als „Preisgegeben“, der großartige Debütroman des kanadischen Journalisten und Autors Ron Corbett, beginnt. Man findet ihre Leichen und die ihrer kleinen Tochter in einer Hütte, die die beiden in einem entlegenen Waldgebiet errichtet hatten. Früher einmal wurden dort Bäume für die Produktion von Zeitungspapier geschlagen. Jetzt sind die Sägewerke und Papiermühlen geschlossen. In die nächste Siedlung Ragged Lake verirren sich höchstens mal ein paar Angler und andere Naturfreunde. Genau der richtige Ort für eine reformierte Alkoholikerin, und einen schwer traumatisierten Kriegsveteranen, um zu sich selbst zu finden. Und nun sind sie tot.
Die Ermittler müssen aus der 600 Kilometer entfernten Großstadt Springfield anreisen. Zwei junge Polizisten und der erfahrene Cop Frank Yakabuski treffen auf eine sehr überschaubare Anzahl Verdächtiger. Als dreifachen Mörder mag sich Yakabuski niemand von ihnen vorstellen. Doch für penible Nachforschungen im Stil klassischer Detektivromane bleibt auch keine Zeit. Die verlassene Gegend entpuppt sich als Schauplatz krimineller Machenschaften im großen Stil. Yakabuski, der einst als Undercover-Ermittler mithalf, einer Biker-Gang das Handwerk zu legen, sieht sich mit bekannten Gesichtern konfrontiert, und schon bald geht es um Leben und Tod. Als es endlich zur Aufklärung der Morde kommt, gibt es bereits 20 Leichen.
Ron Corbetts sachlicher Erzählton, von Sven Koch hervorragend ins Deutsche gebracht, ist von einer unterkühlten Poesie und passt damit perfekt zu seiner Hauptfigur. Frank Yakabuski ist nämlich nicht nur ein klug kalkulierender Ermittler, sondern er besitzt auch ein großes Einfühlungsvermögen. Dass ihm die Aufzeichnungen Lucy Whitebucks helfen, ihrem Mörder auf die Spur zu kommen, zeugt davon. Ein besserer Ort wird die Welt durch den Umstand, dass am Ende 21 Tote gezählt werden, aber nicht. „Nature Noir“ nennt Ulrich Noller diesen Roman in seinem klugen Nachwort, fokussiert auf den „Überlebenskampf einer Kreatur, die glaubt, etwas Besonderes zu sein“. Uns dieser Illusion zumindest für die Dauer der Lektüre zu berauben, gelingt Corbett auf sehr unterhaltsame Weise.
- Ron Corbett: Preisgegeben. (Ragged Lake. 2017). Kriminalroman. Aus dem Amerikanischen von Sven Koch. 399 Seiten. Stuttgart: Polar Verlag 2020. € 14,00.
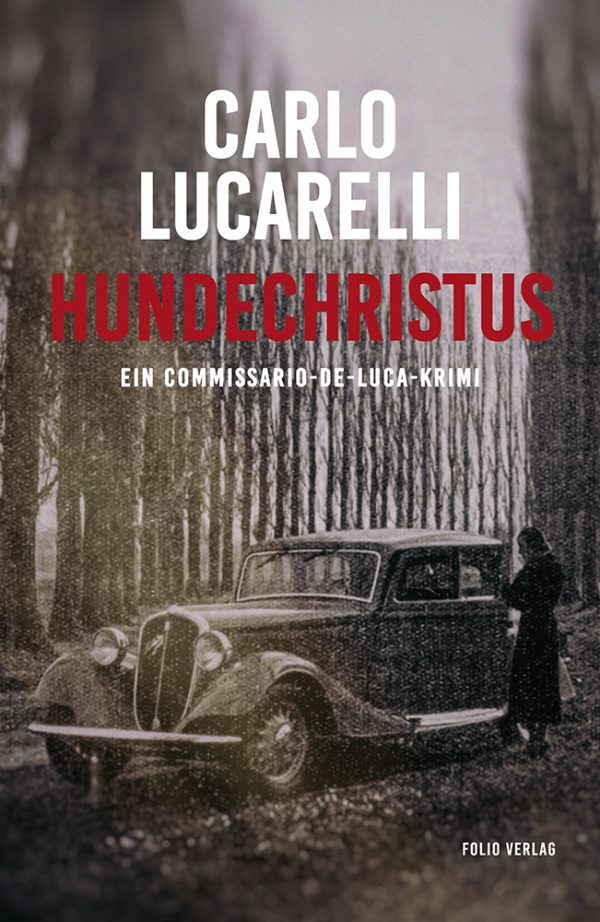
Sich ständig verschiebende Verhältnisse
(rum) Die Ereignisse überschlugen sich im Jahr 1943 in Italien. Am 10 Juli landeten die Alliierten auf Sizilien, am 25. Juli wurde Mussolini von oppositionellen Faschisten und Monarchisten abgesetzt und inhaftiert. Sie wollten den Kommunisten zuvor kommen und zudem das Achsen-Bündnis mit Deutschland lösen. Die Alliierten rückten von Sizilien nach Norden vor, die italienische Übergangsregierung handelte einen Waffenstillstand aus. Diese Zeit nutzten viele Schwarzhemden, um zu fliehen. Doch mit Inkrafttreten des Waffenstillstands fühlten sich die Nationalsozialisten nicht mehr an das Bündnis mit Italien gebunden. Sie marschierten in Nord- und Mittel-Italien ein, nahmen italienische Soldaten gefangen, befreiten Mussolini. Am 13. Oktober erklärte die italienische Regierung Deutschland auf Druck der Alliierten den Krieg.
In dieser schwierigen Gemengelage lässt Carlo Lucarelli seinen Commissario de Luca in Bologna im Fall eines Doppelmordes ermitteln. In einem Lager von Schwarzhändlern wird eine Leiche ohne Kopf gefunden. Zwar stößt De Luca später auf einen abgetrennten Kopf, doch gehört der zu einem anderen Toten. Und schon bald merkt de Luca, dass er sich auf dünnem Eis bewegt, weil die Verdächtigen einflussreiche Männer, hohe Beamte und alter Adel sind. Doch nach der Inhaftierung Mussolinis, eröffnen sich plötzlich neue Möglichkeiten, während sich andere verschließen.
De Luca hat unter Mussolini das schwarze Hemd der Faschisten samt Parteiabzeichen getragen, war aber nie ein glühender Anhänger. Nachdem die Deutschen einmarschiert sind, wird er vom Dienst suspendiert und schließt sich, damit er weiterermitteln kann, einer von den Besatzern neu gegründeten Geheimpolizei an, um weiter arbeiten zu können.
Diesen Eiertanz – wer hat das Sagen, vor wem muss man sich in Acht nehmen, wie verlaufen die Hierarchien und welche Kompromisse geht man ein, bis hin zu Fragen, wie man wen grüßt und was man anzieht – fängt Lucarelli ebenso wie die schwierigen Lebensumstände, die permanente Unsicherheit und die sich ständig verschiebenden Machtverhältnisse schön beiläufig ein. Da ist es schade, dass etliche seiner Figuren auf dem Sprung, wenig einprägsam, oft nur über ein paar simple, häufig wiederholte Merkmale gezeichnet sind.
Der 1960 geborene Lucarelli hatte in den 1990er Jahren drei de Luca-Romane veröffentlicht, die allesamt im Bologna der unmittelbaren Nachkriegszeit spielen. Die Rolle de Lucas während des Faschismus blieb dabei aber im Dunklen. Erst 2017 nahm er in seinem Roman „Italienische Intrige“ den Erzählfaden wieder auf, blieb aber im Jahr 1953. Nun schiebt er eine Art Prequel nach und erzählt, wie sich dieser de Luca als junger Commissario denn nun während des Krieges verhalten hat. Er habe selbst verstehen wollen, schreibt Lucarelli, warum sich sein Commissario in den vier vorangegangenen Romanen denn so gequält habe. Das wird hier deutlich, denn dieser de Luca ist ein Ignorant und Opportunist, einer, der sich einfügt, so lange es seiner Arbeit dient, die in diesen Zeiten freilich fast schon zur Farce gerät. Selbst als seine jüdische Freundin mit ihrer Familie aus der von den Deutschen besetzten Stadt flieht, bleibt er, wohl wissend, in wessen Dienst er da gerade steht.
- Carlo Lucarelli: Hundechristus. Roman. (Original: Peccato Mortale, Turin, 2018). Aus dem Italienischen von Karin Fleischanderl. Folio-Verlag, Wien, Bozen. 271 Seiten, 18 Euro.

Mord ist wie Prosa
(hpe) Ist in einer Buchankündigung von einem Serienkiller die Rede ist, lese ich heute oft gar nicht mehr weiter. Diese Geschichten wollen mit immer noch abstruseren Plots und noch abseitigeren Mordmethoden schockieren, doch meistens langweilen sie nur. Umso mehr macht das wunderbare Büchlein Aufzeichnungen eines Serienmörders des koreanischen Autors Young-ha Kim Freude. Hier erzählt der 70-jährige Byongsu Kim, pensionierter Tierarzt und langjähriger Serienmörder, inzwischen an Alzheimer erkrankt, aus seinem Leben.
Byongsu ist kein wildgewordener Schlächter. Der koreanische Serienmörder tut sich nicht mit blutrünstigen Schilderungen seiner Taten hervor, sondern mit ziemlich lakonisch erzählten Erinnerungen und Betrachtungen, die oft herrlich komisch sind. Wobei der Humor meist staubtrocken ist. »Ich habe mehr Menschen am Leben gelassen, als ich umgebracht habe. ›Man kann nicht alles haben‹, pflegte mein Vater zu sagen.« Zu den Erinnerungen des Mörders gehört ein Lyrikkurs, den er vor Jahren besucht hatte. Den Dozenten habe er am Leben gelassen, weil er seine Gedichte gelobt habe. In seinem ersten Gedicht »Messer und Knochen« beschrieb Byongsu seine Morde, und dem Dozenten gefielen die Metaphern. Als ihm der Dozent erklärte, das Metaphern bildliche Vergleiche seien, musste Byongsu schmunzeln: »Tut mir leid, mein Lieber. Aber das waren keine Metaphern.« Die Lyrik gefiel ihm, doch Morden sei eher wie Prosa, findet Byongsu: »Jeder, der es einmal probiert hat, weiß das. Jemanden zu ermorden, ist viel mühseliger und schmutziger, als man denkt.«
Seine Morde liegen inzwischen mehr als ein Vierteljahrhundert zurück. Doch jetzt müsse er nochmals ran, um seine Tochter zu schützen, meint er. Denn ein Nachfolger macht die Gegend unsicher. Byongsu ist sicher, ihn bei einer zufälligen Begegnung erkannt zu haben, man erkenne Seinesgleichen am Blick. Und genau diesen Mann stellt ihm die Tochter als ihren neuen Freund vor. Den Mann umzubringen, stellt er sich als letzte Lebensaufgabe, »bevor ich vergesse, wer er ist«. Denn die Demenz schreitet voran, und je länger dieser kurze Roman dauert, umso verschwommener und unklarer wird alles. Hat Byongsu überhaupt eine Tochter? Und warum ist deren Freund, der vermeintliche Serienmörder, plötzlich ein Polizist?
Ganz am Rand lässt Young-ha Kim die Zeit der brutalen Diktatur in Korea anklingen, die noch nicht überwunden war, als Byongsu mordete. Vor allem aber versteht er es, die zunehmende Demenz des Icherzählers im Lauf der Erzählung immer mehr spürbar zu machen. Der wird sich seiner schleichenden Verwirrung in lichten Momenten selbst bewusst. Er spürt dann, dass er seinen psychischen Zerfall nicht mehr aufhalten kann. Und er muss feststellen: »Beängstigend ist nicht das Böse, sondern die Zeit. Denn gegen die sind wir machtlos.«
- Young-ha Kim: Aufzeichnungen eines Serienmörders (Salinja-ui gieok-beob, 2013). Aus dem Koreanischen von Inwon Park. Cass Verlag, Bad Berka 2020. 152 Seiten, 20 Euro

Lakonie mit Schuss
(GG) Lakonien ist die Gegend um Sparta. Bei einer Belagerung erhielten die Spartaner die Botschaft: “Wenn wir die Stadt einnehmen, geht´s euch allen an den Kragen!“ Die Antwort der Spartaner lautete: „Wenn!“ Das ist Lakonie. Lakonisches Roman-Schreiben ist eine Kunst für sich. Der Franke Tommie Goerz erzählt in „Meier“ mit sehr lakonischen Mitteln die Rachegeschichte von Meier: zehn Jahre Knast wegen Mordes, aber unschuldig, jetzt legt er die Schuldigen rein.
Viele Dialoge gehen so: „Bier? … Bier. … Mach ich dir.“ Die Rache ist komplizierter. Meier hat viel gelernt im Knast, Tommie Goerz viel recherchiert, und wir lernen jetzt viel, etwa wie man einen abgesunken Schuppen wieder hochbockt, oder wie man Keyless Go-Systeme neuer Autos beim Klauen nutzt, lauter so nützliches Zeug. Auch wie neugierige Nachbarn so sein können, aber das wussten wir schon. Und auch wenn die Geschichte mal einzuschlummern droht, wissen wir, da kommt noch was, noch was Großes, der Goerz kann den Meier so nicht hängen lassen da am Bahndamm, mit diesen Nachbarn. Und das kommt dann auch, natürlich, der Meier zieht das durch. Goerz hat schon eine ganze Reihe von Regionalkrimis um den Nürnberger Kommissar Behütuns geschrieben, „Meier“ ist sein Meisterstück. 150 Seiten Lakonie mit Schuss. Cool.
- Tommie Goerz: Meier. Kriminalroman; ars vivendi, Cadolzburg 2020. 170 Seiten, 18 Euro.











