
Bücher kurz serviert
Kurzbesprechungen von fiction und non fiction. Katja Bohnet (KB), Joachim Feldmann (JF), Alf Mayer (AM), Frank Rumpel (rum) und Thomas Wörtche (TW) über:
James Anderson: Desert Moon
Jack Heath: Blake
Un-Su Kim: Die Plotter
Michael Lewis: Erhöhtes Risiko
Daniel Loick (Hg.): Kritik der Polizei
Ian Manook: Der Mongole
Sultan bin Muhammad al–Qasimi: Der Mythos arabischer Piraterie im Golf
Martha Nussbaum: Königreich der Angst
Max de Radiguès: Bastard
Philipp Reinartz: Fremdland
Matthew Richardson: Niemand kennt deinen Namen
Tito Topin: Tanzt! Singt! Morgen wird es schlechter
Antti Tuomainen: Palm Beach, Finland
Gary Victor: Dreizehn Voodoo-Erzählungen
Nur Narren glauben nicht daran

(KB) Die Geschichte Haitis ist eine Geschichte der Ausbeutung, der Katastrophen im Paradies. Aber das Paradies schlägt zurück. Es bestraft die Ausbeuter und Abzocker, die Zweifler und Ungläubigen, die Naiven gleichermaßen. Interessanterweise beschreibt hier ein hochdekorierter Autor ein Sujet, das traditionell eher Frauen zugeordnet wird: Aberglaube und Zauberkunst. David Copperfield und die Ehrlich-Brothers mal ausgenommen. Wo in Europa viel verdient wird, mischen natürlich die Männer wieder mit. Gary Victor gibt der Sache in seinen Dreizehn Voodoo-Erzählungennoch einen Dreh: In Haiti ist Voodoo hauptsächlich Männersache, der Zauber zutiefst real, ein Teil Haitianischen Lebens. Wer nicht daran glaubt, ist ein Narr.
Victors Kurzgeschichten sind unheimlich, der Autor erzählt sie mit Leichtigkeit und Ironie. Inszeniert wird jedes Stück als Horror-Filme im Miniformat. Wunderbar, was die Kurzform alles kann. Victor schreibt auf eine unprätentiöse, klare, leicht zugängliche Art. Wenn man das schmale Büchlein aus dem Litradukt-Verlag gelesen hat, folgt die Erleichterung, dass mann es endlich wieder schließen kann. Nicht, weil die Leseerfahrung kein Genuss gewesen wäre, sondern weil man das beklemmende Gefühl aus seinem Leben wieder bannen kann. Zurück bleibt die Überzeugung, dass zwischen Kulturen Welten liegen können, die nur die Literatur zeitweise zu überbrücken mag.
Gary Victor: Dreizehn Voodoo-Erzählungen. Aus dem Französischen übersetzt von Ingeborg Schmutte und Cornelius Wüllenkemper. Litradukt, Trier 2018. ###Seiten, ### Euro.
Die Wüste lebt

(TW) Irgendwo in der Wüste Utahs, die State Road 117 auf und ab, fährt Ben Jones mit seinem unterfinanzierten Truck Pakete und Gebrauchsgüter für Menschen aus, die weitab vom Schuss leben wollen und oft, milde gesagt, kauzig sind. Ein Fixpunkt in der Ödnis ist der „Well Known Desert Diner“, ein Relikt aus dem Jahr 1929 und bis 1987 oft Drehort von B-Movies, unter anderen solchen mit Lee Marvin, mit dem der Besitzer, der alte Walt Butterfield, gut befreundet war. Nachdem dessen Gattin vergewaltigt und Jahre später anscheinend katatonisch gestorben war, ist der Diner nur noch selten geöffnet. Dahinter, weiter in der Wüste, steht eine Art Geisterstadt, die nie bewohnt gewesen war. Und dort sieht Ben Jones durch ein Fenster eine nackte Frau Cello spielen, wobei das Instrument keine Saiten hat. Das ist sehr rätselhaft und auch ziemlich poetisch. Wie überhaupt der Roman Desert Moon von James Andersonein Debüt, genau diese beiden Komponenten Rätsel und Poesie beeindruckend kombiniert.
Desert Moon ist kein Country Noir von der Stange, auch kein Outback-Drama mit kettensägenden Irren, sondern eine sehr komplexe und vielschichtige Geschichte über Menschen, die mit anderen Menschen nicht allzu viel anfangen können und dafür ihre guten Gründe haben, so skurril sie anfangs erscheinen mögen. Das gilt für Walt und die schöne Cello-Spielerin genauso wie für den scheuen Ben Jones, für einen Prediger, der ein riesiges Holzkreuz durch die Wüste schleppt oder für zwei Brüder (oder so), die sich ihr Hinterland-Idyll wie ein Gefängnis eingerichtet haben oder für eine stockschlaue minderjährige schwangere Frau. Erst als eine unbekannte Sexbombe und wenig später ein angeblicher Reality Show Produzent eintreffen, beginnt die Wüste zu leben. Besonders das Cello rückt in den Fokus, und an diesem Cello hängen ganze Tragödien.
Anderson lässt Ben Jones, halb Native American, halb Jude, die Geschichte erzählen, ruhig, auch wenn’s rabiat wird, mit oft leise-sarkastischem Unterton, mit milder Selbstironie und großer Empathie für ziemlich alle Figuren. Ben Jones ermittelt nicht groß und gräbt auch keine alten Leichen aus, aber allmählich setzen sich für ihn viele kontingente Splitter plausibel zusammen – und dieses Bild ist nicht unbedingt erfreulich. Über allem aber liegt die Wüste, die Anderson in wunderbaren Bildern zeichnet. Nie verklärt idyllisch, sondern grausam bis brutal und trotzdem unendlich schön. Desert Moon ist eine Geschichte, die sich aus dieser Landschaft entwickelt und deren Figuren konstitutiv mit dieser Landschaft verbunden sind. Nur das Cello ist eine Art Fremdkörper, für den die Wüste kein Erbarmen hat. Sie ist und bleibt von gleichgültiger Schönheit.
James Anderson: Desert Moon. Übersetzt von Harriet Fricke. Polar Verlag, Hamburg 2018. 330 Seiten, 18 Euro.
Alarmstufe Trump

(AM) Rund zwei Millionen Menschen beschäftigt der amerikanische Staat auf Bundesebene, davon 70 Prozent im weitesten Sinne im Bereich der Sicherheit. Er übernimmt Risiken, die keine Einzelperson und kein Einzelunternehmen tragen könnten: Wirbelstürme etwa oder Finanzkrisen, Cyberangriffe, Epidemien oder Terroranschläge, aber auch zum Beispiel die Gefahr, dass Medikamente süchtig machen können, dazu Vorsorge, Ausbildung, Strukturpolitik und Chancen, ländliche Entwicklung. Längst nicht nur im Landwirtschaftsministerium etwa kamen Leute ohne jegliche Erfahrung ans Ruder, auch im Energieministerium (110.000 Mitarbeiter, ein Haushalt von 30 Milliarden Dollar) wurde und wird vorsätzlich sabotiert. Diese bei Trump und seinen Leuten verhasste Behörde verwendet etwa die Hälfte ihres Budgets auf die Instandhaltung und Bewachung des Atomwaffenarsenals der USA. Allein zwischen 2010 und 2018 wurde spaltbares Material, mit dem sich 160 Atombomben hätten bauen lassen, sichergestellt. Außerdem werden hier die Atomwaffeninspektoren der Internationalen Atomenergiebehörde ausgebildet. Ihnen ist es zu verdanken, dass in den Atomkraftwerken der Welt nicht reihenweise waffenfähiges Material ausgebrütet wird und verschwindet. Trumps Leute hatten (und haben) davon keinen blassen Schimmer. Michael Lewis zeichnet in vielen kleinen Porträts nach, dass bei Trumps Amtsantritt oft noch nicht einmal ein Interesse erkennbar war, ein Ministerium überhaupt kennenzulernen – man wusste nur: Es muss verkleinert werden, und die eh teils von Obama ernannten Fachleute müssen allesamt weg.
„Willfull ignorance“ – vorsätzliche Unwissenheit nennt sich diese Geisteshaltung. „Ich habe nur gedacht, heilige Scheiße, dieser Typ (Trump) hat von nichts eine Ahnung. Und es ist ihm scheißegal“, zitiert Lewis den New Jersey-Gouverneur Chris Christie, der ein Übergangsteam zusammengestellt hatte und dann von Steve Bannon im Auftrag Trumps von einem Tag auf den anderen gefeuert wurde. Alle Pläne landeten im Papierkorb. Lobbyisten und Zufallsbekannte erhielten Machtpositionen. „Trumps Haushalt und die gesellschaftlichen Kräfte, die dahinterstehen, werden von dem perversen Bedürfnis angetrieben, nichts zu wissen und dumm zu bleiben. Donald Trump hat dieses Bedürfnis nicht erfunden. Er ist nur seine ultimative Verkörperung“, schreibt Michael Lewis.
Ironie der Geschichte: Der Erwerb der Filmrechte an diesem Buch war eine der ersten Taten von Michelle und Barak Obama, die bei Netflix eine milliardenschwere Doku-Programmreihe betreuen.
Michael Lewis: Erhöhtes Risiko (The Fifth Risk, 2018). Aus dem Englischen von Jürgen Neubauer. Campus Verlag, Frankfurt 2018. 224 Seiten, 24,95 Euro.
Treffgenauer als jede Verschwörungstheorie

(TW) Die Plotter von Un-Su Kim ist nicht deswegen so originell, weil der Roman aus Südkorea kommt, wir wissen inzwischen, dass Asien sehr produktive, sehr spannende Kriminalliteratur zu bieten hat. Er ist auch nicht sehr originell, weil er in der Reihe der autoreflexiven „Killer“-Romane steht, die, sagen wir, spätestens seit Jean-Patrick Manchette „La Position du tireur couché“ oder Luis Sepúlvedas „Tagebuch eines sentimentalen Killers“ ihre eigene Tradition hat. Spannend ist, wie Un-Su Kim die makrostrukturell auch nicht gerade innovative Ballade vom Killer, der im Zuge eines Verteilungskampfes innerhalb der als gildenmäßig organisierten und dadurch romantisierten Parallelwelt der Auftragsmörder, selbst auf der Abschussliste landet, inszeniert.
In Un-Su Kims Buch existiert ein nicht weiter erklärtes Universum, das die Politik- und Wirtschaftswelt Südkoreas mittels ausgefuchster Morde steuert, erdacht und dirigiert von den Plottern, anonymen Gestalten, exekutiert von der Killergilde „Library of Dogs“, die allerdings zunehmend unter neoliberalen Druck gerät. Diese absichtlich unkonkrete, artifizielle Welt ist explizit literarisch verfasst. Deshalb generiert sich der Roman nicht aus abschilderndem Realismus, sondern aus Dialogen, mäandernden Memoirs und Reflexionen, mit denen Un-Su Kim die Handlung vorantreibt, ohne auf konventionelle Dramaturgie setzen zu müssen. Diese durch und durch fiktionale Welt erscheint aber gerade dadurch „wirklicher“, „menschlicher“ und damit letztendlich bösartiger und treffgenauer als jede verschwörungstheoretische Mär darüber, wie es wirklich zugeht auf der Welt.
Un-Su Kim: Die Plotter. Europa Verlag 2018. Übers.: Rainer Schmidt. 360 Seiten, 24 Euro.
Anstoß zur Debatte
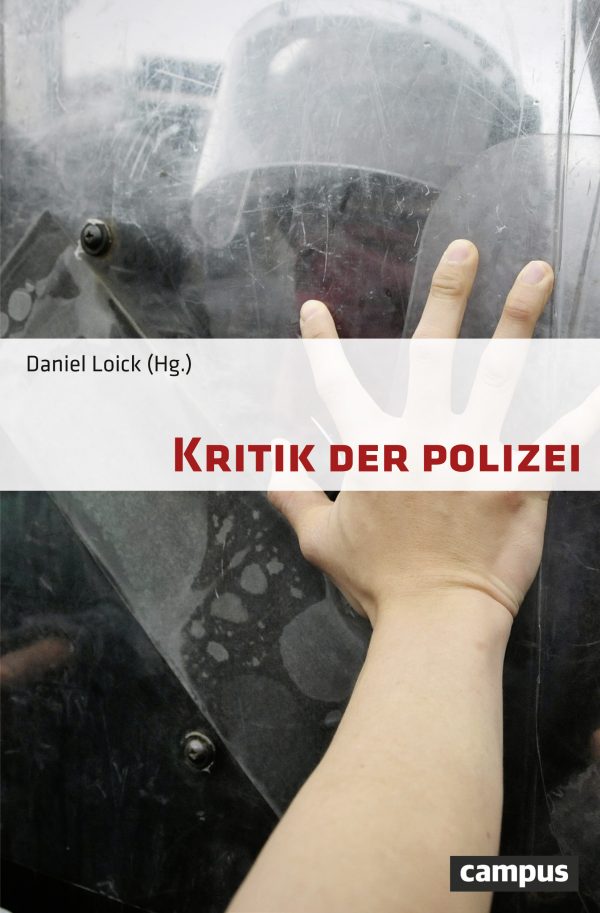
(AM) Was ist Polizeikritik? Heutzutage muss das offenkundig wieder erklärt werden, jedenfalls spricht Daniel Loick, Herausgeber des sehr informativen Sammelbandes Kritik der Polizei genau dazu jetzt am 12. Februar in der Hochschule für Bildende Kunst Dresden. Der G-20-Gipfel in Hamburg, die Occupy-Proteste, neulich auch die Polizeieinsätze im Hambacher Forst oder in Paris und vor allem die US-amerikanische Black-Lives-Matter-Bewegung haben das Thema Polizeigewalt wieder auf die internationale Tagesordnung gehoben. Im Zuge wachsender gesellschaftlicher Spannungen wird die Frage der Konfrontation mit der Staatsgewalt und damit die Legitimation der Polizei als Ordnungsmacht immer offensichtlicher. Während die Polizei als Freund und Helfer und Garant der öffentlichen Sicherheit erlebt oder gefordert wird, erleben andere, die bei Kontrollen, Razzien oder Verhaftungen mit ihr konfrontiert sind, ganz andere Perspektiven. (Siehe auch den CrimeMag-Text zur Aufrüstung nicht nur der US-Polizei von 2014: Wenn der Krieg nach Hause kommt…)
Der Band versammelt wichtige Texte zur Polizeikritik von deutschen und internationalen Intellektuellen, Aktivistinnen und Aktivisten. Teil I blickt auf die Geschichte der Polizei, dabei Texte von Michael Foucault, Mark Neocleous mit „Adam Smith, die Polizei und der Wohlstand“, Sally E. Hadden mit „Sklavenpatrouillen und die Polizei“ und der Italiener Giorgie Agamben. Polizei gegen die Demokratie, Polizei und Rassismus und die Polizei im Neoliberalismus lauten die nächsten Kapitel, ehe es mit den Frauen von „INCITE! Women of Color Against Violence“ über Statements zu vergeschlechtlicher Gewalt geht und mit Kristian Williams zu „Die Polizei überflüssig machen“.
Ein hochwillkommener Band mit viel Anstoß zu einer überfälligen Debatte.
Daniel Loick (Hg.): Kritik der Polizei. Mit Beiträgen unter anderem von Giorgio Agamben, Rafael Behr, Kendra Briken, Didier Fassin, Sally Hadden und Vanessa Thompson. Campus Verlag, Frankfurt 2018. 346 Seiten, 22,90 Euro.
Klassizistische Struktur

(TW) Niemand kennt deinen Namen von Matthew Richardson ist ein klassischer „Maulwurfroman“. Irgendwer ganz oben in der Geheimdiensthierarchie des United Kingdom sabotiert Aktionen des MI6, liefert einen anscheinenden Doppel- (oder Trippel-)Agenten an köpfungswillige Islamisten aus, lässt Akten verschwinden und tötet Menschen, die etwas wissen könnten. Alle Zeichen stehen auf Großanschlag in London, Furcht und Schrecken allenthalben. Auch Solomon Vine ist eine Schachfigur in einem vieldimensionalen Spiel, aber als Hauptfigur auch der Einzige, der nach viel Leid und Elend, das er erdulden muss, am Ende durchblickt.
Die Struktur ist klassizistisch: Vieldeutige Dialoge, undurchsichtige Situationen und Konstellationen, opake Figuren, literarisch-kanonische Anspielungen – man sollte überhaupt mal über die vielen leisen Echos von Anthony Pricein neueren britischen Polit-Thrillern nachdenken -, exzentrisches Personal, aber in formal konventioneller Prosa vorgetragen. Bleibt also nur ein Innovationspunkt: Gender. Und diese Karte spielt Richardson leider zu überdeutlich, was das Buch bei aller Komplexion dann doch ziemlich ausrechenbar macht. Wie überhaupt Richardson sich in den eigenen Intrigen zu verheddern scheint, weshalb er sie an einem bestimmten Punkt völlig unnütz durch eine lange resümierende Passage klarieren muss, wie einst Old Lady Agatha – aber das kann dem Debutstatus des Romans geschuldet sein oder einem jener Lektorate, die kein Vertrauen ins Lesepublikum haben. Nicht machen, möchte man schreien. Aber ein interessanter Autor ist Matthew Richardson allemal.
Matthew Richardson: Niemand kennt deinen Namen. Übersetzung von Ulrike Thiesmeyer. Rowohlt Verlag, Hamburg 2018. 400 Seiten, 9,99 Euro.
Gesellschaftliche Dimension

(JF) Überforderte Polizisten, denen der Glaube an den Rechtsstaat längst abhanden gekommen ist. Und Mo aus dem Senegal, der Arbeit sucht und als Kleindealer im Park landet. Das geht böse aus.
In den 66 kurzen Kapiteln und vielen knappen Sätzen seines zweiten Romans um den Berliner Kommissar Jerusalem Schmitt erzählt Philipp Reinartz eine vertrackte Mordgeschichte im Thrillertempo, ohne die gesellschaftliche Dimension des Verbrechens aus dem Auge zu verlieren. Und wäre da nicht ein Ermittler, der den Unterschied zwischen „scheinbar“ und „anscheinend“ kennt, bliebe der Fall unaufgeklärt. Dass sich an den Verhältnissen etwas ändert, ist nicht zu erwarten. Auch deshalb brauchen wir Kriminalromane wie diesen.
Philipp Reinartz: Fremdland. Goldmann Verlag, München 2018. 320 Seiten, 10 Euro.
Marktkompatibel

(TW) Ganz auf die „Exotik“ des Schauplatzes setzt Der Mongole – Das Grab in der Steppe von Ian Manook. Die „Exotik“ der Mongolei ist natürlich nur im westlichen Blick eine solche, da hilft es auch nicht, dass Manook, der eigentlich Patrick Manoukian heißt und Franzose mit armenischen Wurzeln ist, seinen Roman aus rein mongolischer Perspektive erzählt und alle seine (positiven) Hauptfiguren Mongolinnen und Mongolen sein lässt. Seine Hauptfigur, Kommissar Yeruldelgger Khaltar Guichyguinnkhen, ist dennoch eine globalisierte Ermittlerfigur mit tragischem familiären Hintergrund und seiner Tochter entfremdet, kantig, gewaltaffin, grüblerisch, hierarchiefeindlich, einzelgängerisch, aber auch genial, loyal und im Grunde gut, also eine Art Best-of der üblichen Verdächtigen nach jahrzehntelanger Genre-Geschichte.
Die Story ist ebenfalls geopolitisch global. Der Kommissar hat es mit einem toten europäischen Kind und abgeschlachteten Chinesen zu tun – und damit mit korrupten mongolischen Eliten, die ihr Land an Südkoreaner und Chinesen (üble Gestalten, das) verhökern und gleichzeitig mit mongolischen Neo-Nazis (interessanter Aspekt), ein Mittelschurke nennt sich „Adolf“, die sich für die Erben von Dschingis Khans Imperium halten. Aber „Exotik“ muss dann halt doch sein: Also alles, was nicht schnell genug auf die Bäume kommt: Steppenromantik, uralte mongolische Mythen und Sagen, Visionen und knallharte Kampfmönche mit spirituellem Background, was sicherlich alles so authentisch ist, dass es quietscht. Manook war schließlich 2008 auch mal in der Mongolei. Anyway, gut ist das Buch in Szenen, die in einem abgefuckten Ulaanbaatar spielen, routiniert gut die Figurenkonstellationen -, die korrupten Cops, das anscheinend benevolente Oberscheusal, Yeruldelggers Kolleginnen und Kollegen, die Sidekicks, der „CSI Miami“- Fimmel mancher Figuren und die Naturschilderungen. Das Ganze ist stockkonventionell erzählt (oder sagen wir: sprachlich-ästhetisch unauffällig) und insofern absolut marktkompatibel, eben mit ein bisschen Tourismus comme il faut. Und natürlich auf Serie angelegt.
Ian Manook. Der Mongole. Übersetzung von Wolfgang Seidel. Blanvalet Verlag, München 2019. 640 Seiten, 15 Euro.
Religion und Politik

(rum) Ein radikaler Gottesstaat mitten in Europa – in Frankreich haben die Kleriker übernommen, kontrollieren Politik und Polizei in Tito Topins Roman „Tanzt! Singt! Morgen wird es schlechter“. In einer nahen Zukunft hat der 86-Jährige seine im Original 2017 erschienene Geschichte angesiedelt. Der in Paris lebende Journalist Boris Prévert muss wegen eines kritischen Artikels, in dem er den Bischof der Pädophilie beschuldigt, aus der Stadt fliehen. Mit falschen Papieren und einem Pastorengewand macht er sich auf den Weg, zunächst zu seiner Jugendfreundin Soledad nach Avignon. Doch das Regime ist nachtragend, hat ihm einen Killer hinterher geschickt. Nach einem blutigen Zwischenfall fliehen er und Soledad nach Portugal. Doch bis sie, zusammen mit zwei weiteren Flüchtlingen, einem Bankräuber und einer schwangeren jungen Frau, dort ankommen, ist Portugal schon nicht mehr der sichere Hafen.
190 Seiten reichen dem in Casablanca geborenen, seit den 1960ern in Frankreich lebenden Schriftsteller, Drehbuchautor und Grafiker für diese bitterböse Dystopie. Er erklärt nicht viel, sondern wirft einen mitten hinein, versteht es, griffig und packend zu erzählen. Wer in diesem Frankreich bleibt, muss sich anpassen, wer kann, flieht nach Süden. Dabei reduziert sich die Zahl der Enklaven rapide. Denn in Topins Roman sind die großen monotheistischen Religionen und die sich daran orientierenden Sekten im Nahen Osten und den USA der Glaubenskriege überdrüssig und beschließen, dass doch nicht die jeweils andere Religion, sondern einzig die Ungläubigen ihre eigentlichen Gegner sind. Religion wird also vielerorts zur Pflicht, reaktionäres Denken zur Norm.
Topin spitzt das gnadenlos zu, geht hart mit den Klerikern ins Gericht, deren Macht sich rapide ausbreitet. In seiner durch die Fluchtbewegung vorangetriebenen Geschichte fängt er den zunehmenden Druck, die Enge, die vom einen Moment auf den anderen ganz konkret werdende Gefahr für Andersdenkende mit schnell geschnittenen Szenen und borstigem Witz gut ein und liefert damit einen bissigen Kommentar auf eine Zeit, in der religiöser Fanatismus vielerorts massiv an Einfluss gewinnt.
Tito Topin: Tanzt! Singt! Morgen wird es schlechter (L’exil des mécréants, 2017). Aus dem Französischen von Katharina Grän. Distel-Verlag, ###. 190 Seiten, 14,80 Euro.
Biedersinniger Fidelwipp

(TW) So peinlich bescheuert, dass es fast schon wieder originell ist (nee, nicht wirklich) ist Blake von Jack Heath. Blake ist ein Profiler oder Troubleshooter, der auf freier Honorarbasis für das FBI arbeitet, wenn die Behörde mal wieder nicht weiterkommt. Bezahlt wird er vom FBI mit den noch fast warmen Leichen von Hingerichteten (deswegen spielt der Roman in Texas, die richten so erfreulich oft hin, frisch aus der Region, möchte man sagen), die er dann frohgemut verspeist. Abzuheften unter „Überbietungszwang“, nur ein zoopädonekrophiler Kannibale könnte das toppen. So weit, so bekloppt, aber schon okay – daraus hätte man was Satirisches machen können oder was Grand-Guignol-haft Makabres oder was Provokantes oder halt irgendwas Intelligentes, von mir aus auch was abgrundtief Zynisches.
Aber nix da: Das Buch führt sich bloß wüst auf (naja, bis man nach ein paar Seiten den Gag kapiert hat), ist aber purer, erschütternd biedersinniger Fidelwipp: Der Kannibale mit vampirischen Zügen ist im Grunde gut, hatte eine schlimme Kindheit und trifft eine alte Jugendliebe wieder, die er allerdings erst nach ein paar hundert Seiten erkennt, nach dem sie schon tagelang zusammen gearbeitet haben. Und dann geht’s dem echten Schurken nach ein paar total unplausiblen Handlungshaken an den Kragen. Meine Güte, was für eine trübe Mixtur aus Sozialkitsch und Gewaltporno und doofem wer-ist-der-Böse-Rätsel. Komikfrei, überhaupt total ungebrochen, eindimensional und mit nur einem Geheimnis: Was soll das?
Jack Heath: Blake. Übers.etzt von Angelika Najokat.Heyne Verlag 2019. 448 Seiten. 12,99 Euro.
Gefühle als Erkenntniswert

(AM) Ein Buch gegen die Versuchung, der Verzweiflung zu erliegen, das ist Königreich der Angst von der Philosophin Martha Nussbaum, am Tag der Wahl von Donald Trump im fernen Kyoto angefangen, letzten Sommer in USA erschienen und nun relativ zügig übersetzt. Die Professorin für Rechtswissenschaften und Ethik an der University of Chicago bezeichnet sich selbst als Aristotelikerin, die Frage nach dem guten Leben steht im Mittelpunkt ihrer Arbeiten zur praktischen Philosophie. Sie schreibt sehr allgemeinverständlich, wurde mit mehreren Literaturpreise und über sechzig wissenschaftliche Ehrengraden ausgezeichnet.
Alles sei heute eine Frage der Emotionen, erläutert sie in der Einführung: „In den USA gibt es heute sehr viel Angst, und diese Angst ist häufig mit Zorn, Schuldzuweisungen und Neid vermischt. Angst blockiert allzu oft rationale Überlegungen, sie vergiftet die Hoffnung und behindert eine konstruktive Zusammenarbeit.“ Gefühlen gebührt, davon ist Martha Nussbaum überzeugt, ein eigener Erkenntniswert. Kein Gefühl sieht sie für die Demokratie als so gefährlich an wie die Angst, hat deren primäre Rolle erst mit Trumps Wahl zum US-Präsidenten verstanden. In diesem Sinn ist das Buch eine aus der Realität gespeiste Ergänzung zu ihrem letzten Werk „Zorn und Vergebung“.
Den drei demokratiegefährdenden Emotionen widmet sie je ein ganzes Kapitel, seziert Zorn, Neid, Ekel und was uns Menschen dazu treibt. Der Titel speist sich aus der Angst, mit der wir auf die Welt kommen. Nussbaum nimmt Anleihen unter anderem bei Winnicott, um die Hilflosigkeit und die Traumata des Babys zu beschreiben, das nur zwei Möglichkeiten hat: Herrschen oder Sterben. Angst sei insofern ein „monarchisches“ Gefühl, mit stark narzisstischen und infantilen Zügen. Angst wolle herrschen wie ein König, die Demokratie aber verlange, die Unabhängigkeit der anderen zu respektieren und ihnen auf Augenhöhe zu begegnen.
Die Mechanismen von Machtlosigkeit, Ressentiments, Schuldzuweisungen, Abgrenzungen und Sündenböcken wirken quer durch die Gesellschaften, links wie rechts. Philosophie begreift Nussbaum als eine „sanfte Disziplin“: „Hoffnung ist eine Wahl, die man trifft… Gute Werke brauchen Hoffnung … betonte schon Kant.“ Sie plädiert für die Trennung von Tat und Täter, die Unterscheidung von Mensch und Meinung.
Martha Nussbaum: Königreich der Angst: Gedanken zur aktuellen politischen Krise (The Monarchy of Fear. A Philosopher Looks at Our Political Crisis, 2018). Aus dem Englischen von Manfred Weltecke. Wgb Theiss Verlag, Stuttgart 2019. 304 Seiten, 28 Euro.
Substantiell

(TW) Die Starz-Serie „Black Sails“ bietet gerade ein wunderbares Gegennarrativ (für alle, die jetzt schnauben: Das Wort „Narrativ“ ist manchmal sehr sinnvoll, weil es die Multimedialität von „Erzählung“ impliziert) gegen hegemoniale Lesarten des Piratentums des 17. und frühen 18. Jahrhunderts in der Karibik – ein dialektischer Diskurs unter anderem über Freiheit, inklusive sexueller Autonomie und Diversität und unter Umschreibung diverser Piraten-Mythen à la „Treasure Island“, nebst polit-ökonomischem Background, der die Kolonialmächte Spanien und England und deren Wertewelt nicht gut aussehen lässt. Neben der Karibik ist auch der Arabische Golf (bis zum Indischen Ozean) Schauplatz des Großnarrativs „Piraterie“. Auch dort ging es um die Durchsetzung imperialistischer Interessen, um Handelsplätze und Routen, die vor allem von der Ostindischen Kompanie gewaltsam dem Empire einverleibt werden sollte. Ein Propaganda-Krieg gegen lokale Kulturen war Teil dieser Strategie, die Piraterie die zivilisatorisch-konsensuale legitimatorische Raison für alle gewaltsamen Aktionen und Ermächtigungen. Narrative, die sich bis heute, Stichwort „Somalische Piraten“, fortsetzen.
Sultan bin Muhammad al-Qasimi hat in seiner großen Studie Der Mythos arabischer Piraterie im Golfeinen auf sehr reichhaltiges Quellenmaterial (vor allem aus Mumbai) gestützten historiographischen Gegenentwurf (Dissertation an der University of Exeter) vorgelegt, der vor allem die intentionale britische Mythenbildung dekonstruiert. Natürlich muss man bei allen historischen Studien grundsätzlich auf das erkenntnisleitende Interesse schauen – der Autor selbst herrscht über ein Golf-Emirat (Sharjah) und ist deswegen sicher nicht interesselos. Aber wichtig und spannend daran ist, dass es ein substantielles Gegennarrativ gibt, von dem aus man auch heutige Perspektive, Wahrnehmungen und Verarbeitungen auch und gerade in den Populären Kulturen noch einmal mit der gebotenen Skepsis betrachten kann.
Sultan bin Muhammad al-Qasimi: Der Mythos der Piraterie im Golf. Georg Olms Verlag 2018, Hrsg.: Beate Bücheleres-Rieppel. 300 Seiten, 29,80 Euro.
Schluss mit lustig

(TW) Das Gegenteil von komisch ist oft gewollt komisch. Das ist das Problem von Antti Tuomainen und Palm Beach, Finland. Ein Roman aus der Serie Pleiten, Pech und Pannen mit Leichenverzierung. Ein Typ mit Miami-Vice-Obsession möchte ein verschlafenes, langweiliges finnisches Küstenstädtchen in ein international satisfaktionsfähiges Luxus-Ressort verwandeln, auch wenn die Ostsee kalt und das Wetter wenig einladend ist. Natürlich fehlen ihm dazu die Mittel und die Kompetenz, aber Größenwahn kennt keine Grenzen. Deswegen heuert er auch die zwei größten Loser an, die dort herumhängen. Die sollen für ihn eine Hausbesitzerin so vergrämen, damit er billig an das Grundstück kommt. Natürlich geht alles schief. Sie bringen versehentlich den Bruder eines Profikillers um, der dann prompt ins Städtchen einreitet, gleichzeitig mit einem Undercover-Cop, der sich in die Hausbesitzerin verliebt.
Weil sich alle so völlig unplausibel blödsinnig benehmen, geht das allbekannte Jeder-gegen-Jeden-Spiel los. Das ist Elmore Leonard very very light. Unwitzig, ausgelutscht, billig (wenn die Tatsache, dass zwei ältere Damen miteinander Sex haben, auf derselben Fake-bizarren-Ebene gehandelt wird wie dumme Killer) und fast empörend blöd, selbst innerhalb der selbstgesteckten Parameter, die per se unsinnig sind. Aber spätestens, wenn Tuomainen uns erzählt, dass die Obertrottel, die nie aus ihrem Kaff an der Küste herausgekommen sind, nicht wissen, dass die Ostsee keine Ebbe und Flut hat – neee, dann ist echt Schluss mit lustig. Bei diesem Roman bleibt nur die Frage: Geht´s noch?
Antti Tuomainen: Palm Beach, Finland. Übersetzt von Niina Katariina und Jan Costin Wagner. Rowohlt/Hundert Augen, Hamburg 2019. 368 Seiten, 20 Euro.
Erfreulich uneindeutig

(TW) Bastard von Max de Radiguèsist ein wirklich allerliebster Comic. May und ein Knabe namens Eugene, der ihr Sohn sein könnte, setzen sich nach einem blutigen Raubüberfall mit der Beute ab und werden – May ist Profigangsterin – von ihren Ex-Kumpanen gejagt. May setzt sich robust und letztlich sehr effizient zur Wehr, und auch der kleine Eugene ist ein absolut toughes Kerlchen. Der Clou dabei ist, dass die anscheinend naiven Bilder (mit einem Schuss Manga) eine andere, nettere Geschichte zu erzählen vorgeben als die Storyline sagt.
Die Geschichte selbst könnte aus dem Westlake/Stroby-Gangster-gegen-Gangster-Universum stammen, die dazu passende fiese Denke wird von einer Familientragödie grundiert, die auch vor ein paar Schluchz-Elementen nicht halt macht. Durch die Figur eines netten, stets supportiven Truckers, wie um die hellen Bilder zu unterstützen, kommt „Noir“ als Label gar nicht erst ins Spiel. Die unartige Moral – wer Gewalt clever einsetzt, kommt weiter – kombiniert mit den stimmungsmäßig hellen Zeichnungen erzeugt eine erfreulich uneindeutige, faszinierende Spannung.
Max de Radiguès: Bastard. Comic. Übers.: Andreas Förster. Reprodukt Verlag, Berlin 2018. 192 Seiten, 14 Euro.











