
Perth – zwischen Unschuld und Niedertracht
– Von Alan Carter.
Schuldig: Siebeneinhalb Jahre Haft für den Mann, der mit der Drohung, einem Bergbau-Manager in Perth mit einem Bolzenschneider die Finger abzuschneiden, 200.000 AUD erpresste.
Schlagzeile in der Zeitung, 1. Oktober 2010
Es war ein übler Fall, der in ganz Australien Schlagzeilen machte. Der Rohstoffboom in Western Australia war gerade auf dem Höhepunkt, ein Ausdruck des Unternehmergeistes, der diesen Bundesstaat so groß gemacht hat. In einem Eldorado muss man nicht unbedingt in den Schacht hinunter, um Geld zu machen.
Als ich mich Anfang 1991 in Perth, Western Australia, niederließ, war ich von der gleißenden Sonne, den weißen Stränden und dem klaren blauen Himmel wie geblendet. Perth war nicht nur eine halbe Welt von dem kalten, grauen, postindustriellen Nieselregen meiner Geburtsstadt Sunderland im Nordosten Englands entfernt – nein, es lag auf einem anderen Planeten. Perth war ein Ort, an dem alles möglich war, wo Träume Wirklichkeit werden konnten, wo ich mich selbst neu erfinden und neu anfangen konnte. Diese Stadt war, so schien es mir, tatsächlich El Dorado.
Perth ist die Hauptstadt des Bundesstaates Western Australia, einer Landmasse von etwa der Größe Westeuropas vor dem Fall des Eisernen Vorhangs – 2.529.8754 Quadratkilometer. Ein großer Teil dieses Gebietes ist dünn besiedelt, dort leben ungefähr 2,6 Millionen Menschen, im Schnitt also etwa eine Person pro Quadratkilometer. Wir anderen 92% leben im südwestlichen Zipfel des Bundesstaates, fern von dem roten Staub und der Wüstenhitze des Nordens und des Landesinneren, zusammengedrängt wie freilaufende Hühner, die dem Platzangebot nicht trauen, sondern überzeugt sind, dass irgendwo versteckt Raubtiere auf der Lauer liegen. Perth ist wohl die isolierteste Hauptstadt der Welt, von hier aus ist es nach Jakarta näher als nach Canberra – und das mag, zum Teil jedenfalls, die Einstellung erklären, die hier herrscht.
Sich ordentlich mies fühlen in El Dorado
Wenn man einer Stadt eine Persönlichkeit zuschreiben kann, dann strahlt Perth an einem guten Tag Licht, Gesundheit, Gutmütigkeit und Unschuld aus. An einem schlechten Tag neigt die Großstadt zu Egoismus, Niedertracht und Provinzialismus. Vielleicht liegt das daran, dass so viele ihrer Bewohner davon träumen, plötzlich reich zu werden, so wie die Bergbau-Magnaten Lang Hancock und Andrew „Twiggy“ Forrest. Die Kluft zwischen arm und reich hat sich erschreckend vergrößert – wir bauen weitere Marinas und mehrstöckige Lagergestelle für Sportboote, aber für die wachsenden Zahlen von Obdachlosen, die sich die astronomischen Mieten und Immobilienpreise nicht leisten können, gibt es solche Zerstreuungen nicht.
Das Prinzip „Jeder ist sich selbst der Nächste“ ist in der Stadt überall spürbar. Und es beruht auf Angst. Fernsehen und Printmedien werden von Verbrechensmeldungen überschwemmt, und das ist kein Wunder. Ein Einbruch bei einem Bürger von Perth ist mehr als doppelt so wahrscheinlich wie ein Einbruch bei einem Einwohner von Sydney, und ein Überfall ist in Perth anderthalb mal so wahrscheinlich. Man sollte erwarten, dass die Bewohner El Dorados, wo Geld und Sonnenschein doch im Überfluss vorhanden sind, sich glücklich und sicher fühlen. Aber das ist nicht der Fall. Von der Deakin University durchgeführte Studien zum Wohlbefinden stellen immer wieder fest, dass die Einwohner von Perth sich von allen  Australiern am miesesten fühlen. Diese Thematik greife ich in Getting Warmer (erschienen im August 2016 bei Edition Nautilus auf Deutsch als „Des einen Freud“) auf, meinem zweiten Cato-Kwong-Roman.
Australiern am miesesten fühlen. Diese Thematik greife ich in Getting Warmer (erschienen im August 2016 bei Edition Nautilus auf Deutsch als „Des einen Freud“) auf, meinem zweiten Cato-Kwong-Roman.
„Der Premierminister ist besorgt, Cato. Ratlos. Er versteht nicht, warum wir nicht alle fröhlich unsere Vegemite-Sandwiches verdrücken, wo der Bergbau-Boom uns doch so reich gemacht hat und wir der globalen Rezession trotzen, bla, bla, bla. Stattdessen diese ganze Wut, Unfreundlichkeit und Brutalität auf seinen Straßen. Das“, Hutchens klopfte mit seinem dicken Zeigefinger auf den Bericht, „raubt dem armen Kerl den Schlaf.“ […]
„Ideen dazu?”, fragte Hutchens.
„Money can’t buy me love“, summte Cato. (S. 46)
Goldene Zeiten
Vielleicht hat diese brütende Unzufriedenheit ihre Wurzeln in der finsteren Geschichte unseres Eldorados. Perth wurde Anfang des neunzehnten Jahrhunderts gegründet. Unter dem Namen Swan River Colony war die Siedlung anfangs ein abgelegener Außenposten der wachsenden Strafkolonie New South Wales. Der Staat, den wir heute als Australien bezeichnen, basiert in der Tat auf Verbrechen – auf den Verbrechen der Menschen, die aus Großbritannien herübergebracht wurden. Ihre Vergehen reichten von Schafdiebstahl über die Gründung einer Gewerkschaft oder den Widerstand gegen britische Gesetze in Irland bis hin zu Mord. Und eine weitere Basis des Staates ist das Verbrechen, die ursprünglichen Bewohner, Australiens Ureinwohner, grausam enteignet zu haben, ihnen ihr Land und ihre Kultur geraubt zu haben – ein Akt, der unserem Land immer noch Schande macht.
Die Geschichte Australiens ist blutgetränkt, und viele der Menschen, die hier in den zwei Jahrhunderten, seit Europäer zum ersten Mal das Land betraten, zu Wohlstand kamen, verdanken das direkt oder indirekt verbrecherischen Machenschaften. Insbesondere sind Kriminalität und Bergbau schon lange vor dem derzeitigen Boom miteinander verflochten gewesen. Auf den Goldfeldern von Kalgoorlie grasierte während des Goldrausches ab Anfang der 1890er Jahre schon gleich von Beginn an der Golddiebstahl. Während sie für eine Firma arbeiteten, schmuggelten die Goldsucher Gold, soviel sie nur konnten, und diese Diebstähle wurden im Allgemeinen als ihr Privileg betrachtet. Alle schienen vom Golddiebstahl zu profitieren, was die Bergbaugesellschaften frustrierte und die Polizei vor Ort zur Verzweiflung trieb, war es ihr doch unmöglich, den zahlreichen Anzeigen, die sie erhielt, nachzugehen.
Nach der Einsetzung eines parlamentarischen Untersuchungsausschusses im Jahr 1906 richtete man 1907 ein auf Golddiebstahl spezialisiertes Dezernat ein. Diese Polizeikräfte wurden von der Chamber of Minerals und Energy finanziert, einzig zu dem Zweck, Golddiebe, illegale Händler und Schmuggler aufzuspüren. Das Dezernat existiert heute noch. Gegenwärtig lebt die australische Wirtschaft vor allem vom Bergbau, von der Landwirtschaft und vom Tourismus. Western Australia produziert 46% der australischen Exporte und ist der zweitgrößte Eisenerzproduzent der Welt. Es ist damit die führende Wirtschaftsmacht Australiens. Hier gibt es Arbeit, hier ist das Geld. Und hier lohnt sich Kriminalität so richtig.
 In meinem ersten Roman, Prime Cut, lag mir daran, die Schattenseite des Bergbau-Booms zu erkunden, die Ausbeutung ausländischer Arbeitnehmer, die Gier, die Abzocke. In einer Schlüsselszene hat der Protagonist Cato Kwong, ein Kriminalbeamter mit chinesischen und australischen Wurzeln, eine Auseinandersetzung mit dem Geschäftsmann Keith Stevenson und seinem kultivierten Partner Jimmy Dunstan:
In meinem ersten Roman, Prime Cut, lag mir daran, die Schattenseite des Bergbau-Booms zu erkunden, die Ausbeutung ausländischer Arbeitnehmer, die Gier, die Abzocke. In einer Schlüsselszene hat der Protagonist Cato Kwong, ein Kriminalbeamter mit chinesischen und australischen Wurzeln, eine Auseinandersetzung mit dem Geschäftsmann Keith Stevenson und seinem kultivierten Partner Jimmy Dunstan:
Außerdem war Cato eine Veränderung in Jimmy Dunstans Gesicht aufgefallen: Abscheu, aber auch ein leises Schuldgefühl waren in seiner Miene zu lesen. Er machte mit seinen ausländischen Arbeitern das gleiche, vielleicht war er nicht ganz so korrupt, aber dafür möglicherweise in größerem Maßstab. Größere Projekte, mehr Arbeitnehmer, er schürfte nicht so tief, dafür aber auf einem größeren Gebiet. Geschickter, vornehmer. (Prime Cut, S. 305)
Doch während man mit der Ausbeutung von Arbeitskräften erhebliche Profite machen kann, kommt das größere, schnellere Geld aus dem Drogenhandel.
Kokain-Glamour
In den letzten Jahren haben Australiens starke Wirtschaft und der hohe Preis, den die User für Drogen zahlen, das Land zu einem lohnenden Ziel für Kokainhändler gemacht. Die Daten der Australian Crime Commission zeigen, dass der Großhandelspreis für ein Kilogramm Kokain mit etwa 220.000 AUD hier mehr als siebenmal so hoch ist wie in den USA und fast hundertmal so hoch wie in Kolumbien. Bei einem Bruttogewinn von fast 1.000 Prozent ist es kein Wunder, dass Verbrecher keine Mühen scheuen, um den australischen Markt zu infiltrieren. Auf dem Höhepunkt des Bergbau-Booms kamen Fakten ans Licht, die bewiesen, dass ein brutales mexikanisches Drogenkartell mindestens zwei Jahre lang jeden Monat etwa eine halbe Tonne Kokain nach Australien geschmuggelt hatte. Die Behörden vermuteten, dass das Sinaloa-Kartell in Australien eingedrungen war und den Kokainverbrauch im Land anheizte, denn im Hafen von Melbourne hatte man eine Kokainlieferung von 220 Kilo abgefangen, die die Polizei diesem kriminellen Netzwerk zuschrieb.
Weiter westlich sind die Profite sogar noch größer. Detective Superintendent Charlie Carver von der Serious and Organised Crime Division in Western Australia soll gesagt haben: „Die Bewohner von Western Australia bezahlen für ein Gramm Kokain zwei- bis dreimal mehr als Konsumenten in den Eastern States, daher ist es für die Händler lukrativ, die Drogen hier bei uns zu verkaufen.“ Ein Gramm Kokain kostet in Perth 400 bis 600 australische Dollar, aber trotz dieses hohen Preises ist die Droge in Western Australias Partyszene beliebt, und die Zahl der Konsumenten wächst. Der Markt in Western Australia wird für Drogenimporteure immer einträglicher, weil hier aufgrund der niedrigen Arbeitslosigkeit und der hohen Löhne im Bergbau- und im Rohstoffsektor das verfügbare Einkommen höher ist. Im Jahr 2009, als der Rest der Welt sich gerade von der globalen Finanzkrise erholte, beschlagnahmte die Polizei in Western Australia 300% mehr Kilogramm Drogen als im Jahr zuvor.
Laborgeister zaubern multikulturell
Die eigentliche Boom-Droge ist Methylamphetamin. Es macht 90% der im Bundesstaat beschlagnahmten Drogen aus und ist zum wichtigsten Bestandteil von Ecstasy und Ice geworden. In Western Australia ist es dreimal so viel wert wie in den Eastern States von Australien – eine Pille kostet hier 50 AUD und eine Unze 15 000 AUD, während im Osten nur 18 AUD für eine Pille und 5000 AUD für eine Unze verlangt werden. Dieser Preisunterschied führt dazu, dass immer mehr Dealer morgens einen Flieger nach Perth nehmen, ihre Ware abstoßen und am Abend mit einem ordentlichen Gewinn wieder in den Osten zurückkehren. „Warum sollte man für 150.000 Dollar ein Jahr lang in einer Mine schuften, wenn man das gleiche Geld auch in zwei Wochen verdienen kann? Das ist die Mentalität, mit der wir es zu tun haben“, sagt Charlie Carver, der Detective Superintendent von der Organised Crime Division. Der Unternehmergeist hat auch die Vorstädte infiziert: In heimlichen Laboren wird selbst produziertes Meth gemixt – ein wahrer Breaking-Bad-Boom ist entstanden. Das ist in mehr als einer Hinsicht ein Kracher, denn eine Zeitlang verging kaum eine Woche, ohne dass ein Haus in die Luft flog, weil jemand die Mixtur falsch angesetzt hatte.
Die kriminellen Netzwerke in Perth wachsen rapide, während immer neue Wellen von Designerdrogen die Straßen überspülen, und die Polizei ist in ständiger Angst, dass brisante Situationen eskalieren könnten, denn rivalisierende Banden versuchen, die Herrschaft über den gewinnträchtigen Drogenmarkt zu erringen. Wie der Assistant Commissioner Nick Anticich aus Western Australia feststellt: „Mit seinem Wachstum zieht Perth neue Akteure an, die auch ein Stück vom Kuchen abhaben wollen.“ In Getting Warmer kehrt unser Protagonist Cato Kwong nach Perth zurück und wird dort unter anderem mit einem Bandenkrieg konfrontiert, in dem der Kampf um die Drogendollars aus dem Bergbau-Boom immer härtere Formen annimmt. Cato trifft einen früheren Kollegen wieder, Colin Graham, der inzwischen beim Dezernat für Organised Crime Karriere macht und gerade im Mord an einem kleinen Dealer ermittelt.
„Er hatte mit gefährlichen Leuten Umgang“, räumte Graham ein. „Eigentlich bin ich erstaunt, dass er sich überhaupt so lange gehalten hat. Es ist ein gefährliches Spiel, mit sehr hohen Einsätzen. Der Meth-Markt in Western Australia ist der lukrativste im ganzen Land. Die Bergleute schwimmen im Geld, und wenn sie in ihrer Freizeit feiern wollen, bezahlen sie gern bis zu fünfzig Prozent mehr als alle anderen, schließlich ist es ja nur Geld. Kein Wunder, dass die Banden aus den Eastern States da gern mitmischen möchten. Jeder will ein Stück vom Kuchen, und es macht ihnen nichts aus, dafür Blut zu vergießen.“ (S. 35)
Vielleicht gibt es allerdings auch einen herzerwärmenden Aspekt des Booms im organisierten Verbrechen, nämlich seinen multikulturellen Charakter. Vormals anglozentrische Motorradgangs nehmen jetzt Mitglieder aus aller Herren Länder auf, ehemalige Kindersoldaten aus dem Kongo genauso wie Migranten aus dem Libanon, und sie knüpfen Verbindungen zu einheimischen und internationalen Kartellen von China bis Kolumbien. Man reicht sich über den Ozean hinweg die Hände. Zumindest, was die Unterwelt angeht, sind Perths Tage als provinzieller Außenposten des British Empire, als „Little England“, vorbei.
Nicht nur mit dem Drogenschmuggel lässt sich in El Dorado schmutziges Geld machen. Auch die altmodischen Taktiken der Schutzgelderpressung und der Erpressung überhaupt werden angewandt. „Erpressung ist in Western Australia das Boom-Verbrechen“, posaunte The West Australian am 12. April 2010. Die Zeitung berichtete, die Strategien, mit denen Verbrecherbanden und Motorradgangs Firmen in Western Australia erpressen, seien ein Problem, und die Polizei befürchte, dieses Problem werde mit dem wachsenden Boom in unserem Bundesstaat zunehmen.

Minen-Konzerne wie Rio Tinto überschatten die Stadt.
Guter Schnitt
Hier nun betritt Darryl Stretton mit seinem Bolzenschneider die Bühne. Wie das Gericht in Perth erfuhr, reiste Stretton, der in New South Wales lebte, nach Perth, um dort von einem Bergbau-Manager Geld zu erpressen. Weiterhin hatte er Helfer angestellt, um sein Opfer zu bedrohen. Zum ersten Mal hatte Stretton von dem Geschäftsmann, dessen Identität nicht preisgegeben wurde, Geld erhalten, nachdem er sich in einem Haus im Süden Perths mit ihm getroffen hatte. Darryl Stretton hatte Interesse daran gezeigt, ein Geschäft mit dem Manager abzuschließen, und ihn eingeladen, sich mit seinem Steuerberater zu treffen, um die Sache ausführlicher zu besprechen. Ein Foto von Stretton zeigt, dass er ein echter Fiesling ist, dessen Gesicht nur eine Mutter liebhaben konnte – man kann ihn schwerlich für etwas anderes als für einen Ganoven halten. Warum also hat der Bergbau–Manager eingewilligt, zu dem „Treffen“ mit dem „Steuerberater“ zu erscheinen? Hier haben wir ein weiteres Charakteristikum des Booms: Er ist relativ demokratisch. Bei der Arbeit tragen alle gleichermaßen Sicherheitsweste und Schutzhelm, es gibt keine Berührungsängste – Oligarchen verkehren mit Klempnern. Der Schlägertyp mit der Knollennase da in der Zimmerecke könnte Direktor einer Mine sein – wer weiß? Daher nahm der Bergbau-Manager die Einladung an und lief direkt in einen Albtraum hinein.
Der Steuerberater entpuppte sich als ein Mann namens Ox. Er war ein kräftiger Kerl mit Tätowierungen, einem Ziegenbärtchen und Ohrringen, und während er fragte, wo das Geld bleibe, schlug er sich mit einem Baseballschläger in die Hand. Vor Gericht wurde ausgesagt, dass er dem Manager nahelegte, am nächsten Tag 20.000 AUD auf ein Konto zu überweisen und dann im Laufe der nächsten Wochen noch zwei weitere Raten von jeweils 90.000 Dollar. Andernfalls würde man dem säumigen Zahler die Finger mit einem Bolzenschneider abknipsen, einen Finger für jede Woche Verzug – ganz im Stil von Tarantino. Weil der Mann um sein Leben und um das seiner Familie fürchtete, zahlte er das Geld. Zweihunderttausend Dollar für einen halben Tag Arbeit, Darryl. Nicht schlecht! Das kommt dem Verdienst eines Bergbau-Magnaten schon recht nahe.
Die Rückseite des am Sex verdienten Dollars
Natürlich war Darryl Stretton nicht der Einzige, der da auf dem freien Markt eine Goldgrube entdeckt hatte. Wo es Männer und Moneten gibt, finden sich auch Prostitution, Zuhälter und Puffmütter. Während des Bergbau-Booms in Australien ist die Zahl der Prostituierten, die sich zu abgelegenen Bergbau-Städten auf den Weg machen, gewachsen. Auch die Zahl der Sexarbeiterinnen ist gestiegen, die laut der Australian Crime Commission aus Asien einfliegen, um von der starken Wirtschaft, der robusten Währung und den hohen Löhnen im Land zu profitieren. Sexarbeiterinnen schlagen vor allem auch in den abgelegenen Städten aus dem Boom Kapital, wo das älteste Gewerbe der Welt jetzt als jüngste Branche die Möglichkeit nutzt, einfach für kurze Zeit einzufliegen und wieder zu verschwinden.
Eine Boulevardzeitung aus der Hauptstadt zitierte einen Bericht der University of New South Wales von 2012, in dem festgestellt wurde, dass der Stundenlohn für Sex-Dienstleistungen in Sydney, der größten Stadt Australiens, im Durchschnitt 150 Australische Dollar betrug. Sexarbeiterinnen in abgelegenen Bergbau-Städten, wo es von gut verdienenden Männern nur so wimmelt, können das Doppelte verlangen.
In der Goldgräberstadt Kalgoorlie in Western Australia wirbt das historische Bordell Red House, das seit 1934 existiert, mit Dienstleistungen von 300 AUD pro Stunde an aufwärts. Die Besitzerin Bruna Meyers berichtete dem Revolverblatt, dass die Frauen in ihrem Etablissement bis zu 4.000,- australische Dollar pro Woche verdienen, wenn viel los ist, das ist etwa dreimal so viel wie das durchschnittliche Gehalt eines ganztags arbeitenden Australiers. „Die Mädchen hier stammen hauptsächlich aus den Eastern States. Sie kommen manchmal für zwei oder drei Wochen. Manche sind auch einfach junge Frauen, die gerade eine Weltreise machen.“ Allerdings erwähnt die Zeitung nicht, dass für jedes freischaffende „fröhliche Freudenmädchen“, das vom Bergbau-Boom profitiert, Tausende von Frauen und Mädchen ins Elend verkauft werden und dass das organisierte Verbrechen Profit daraus schlägt.
Auf der Höhe des Booms startete die australische Bundespolizei eine Aktion, um Menschen, die als Zwangsarbeiter, Prostituierte oder für Zwangsehen nach Western Australia verkauft worden waren, zu retten. Man befürchtete, dass immer mehr Frauen nach Perth und in abgelegene Bergbau-Städte wie Kalgoorlie, Karratha und Port Hedland gebracht und dort zur Arbeit in der Sexindustrie gezwungen wurden. Die australische Bundespolizei führte von 2010 bis 2011, also auf dem Höhepunkt des Booms, 45 Ermittlungen wegen Menschenhandels durch – im Vergleich zu 35 Ermittlungen im Jahr zuvor -, darunter waren 24 neue Fälle. Es ist bedrückend, dass es nur eine Handvoll Verurteilungen wegen Menschenhandels gab, seit das Gesetz 2003 in Kraft trat. Die Opfer wurden normalerweise in ihre Heimatländer zurückgeschickt, nur um dort wieder im Sexgewerbe zu landen.
Feiner Stoff im finsteren Perth
Drogen, Gewalt und Sex – wen wundert es da, dass Australien, und insbesondere Western Australia, einen Boom an Kriminalromanen erlebt? In einem Artikel, der kürzlich im Guardian veröffentlicht wurde, wird die Krimi-Szene in Western Australia als wohl „eine der aufregendsten in Australien“ beschrieben. Das sonnige Postkarten-Perth scheint vielleicht im Widerspruch zu der düsteren Atmosphäre zu stehen, die einen großen Teil der zeitgenössischen Kriminalliteratur in Western Australia kennzeichnet und der sich Autoren wie David Whish-Wilson, Robert Schofield, Dave Warner und ich selbst verschrieben haben. War es Raymond Chandler, der bemerkte, dass die Schatten umso dunkler erscheinen, je heller das Licht ist?
Die strahlende Sonne, der blendend weiße Strand, der leuchtend blaue Himmel und die reichen Belohnungen El Dorados schimmern wie eine Fata Morgana in der Wüste. Aus der Nähe erkennt man jedoch, dass man über ein ausgebleichtes Skelett in einem ausgetrockneten Wasserloch gestolpert ist. Der Krimiautor David Whish-Wilson aus Perth bemerkt: „Wahrhaft quälend und beängstigend ist in diesen Romanen nicht die Gefahr, die dem ‚Helden’ des Krimis droht, sondern der Schaden, der dem Gemeinwesen zugefügt wird. Ebenso wird nicht in erster Linie dargestellt, wie die Polizei mit den in einer Metropole üblichen Verbrechen fertig wird, sondern wie die implizite Gewalt und die Schichten der Angst mit dem Schutz des Ansehens von oft machtvollen Interessen verknüpft sind.“ In Getting Warmer sinnt Cato Kwong über diese Machtinteressen und Perths dunkle Geschichte nach, während er gerade im Bau befindliche Hochhäuser im Stadtzentrum betrachtet:
Der Central Business District bestand aus einem Wald von hohen Kränen und Gerippen neuer Gebäude. Cato entdeckte die Umrisse von mindestens einem Wolkenkratzer, der seines Wissens mit Drogengeldern finanziert worden war, und mehrere weitere Bauten, bei denen die Bauunternehmen und Sicherheitsfirmen schlicht als Deckfirmen für Motorradgangs und andere kriminelle Unternehmen fungierten. Das Stadtmotto von Perth war „Floreat“, lateinisch für „Sie möge gedeihen“. Es passte. Selbst einige der legaleren Gebäude waren das Resultat von Reichtum, der im Laufe von zwei Jahrhunderten mittels Geldwäsche aus geraubten Ländereien, unterschlagenen Löhnen und gestohlenen Bodenschätzen entstanden war. Perths Skyline mochte sich ständig verändern, aber der Untergrund blieb der Gleiche: ein schmieriges kleines Reich von Räuberbaronen.
Perth ist aufgrund seiner isolierten Lage und seiner geringen Größe seit jeher so überschaubar, dass eine begrenzte Anzahl dynamischer Menschen großen Einfluss auf Entscheidungsfindung und Verhalten in der Stadt haben können. Gelegentlich mag das gut gewesen sein, wenn nämlich Cowboy-Kapitalisten den Staat an der Kehle packten und ihn aus seinem selbstzufriedenen, erstickenden Provinzialismus herausschüttelten – man denke dabei nur an Lang Hancock, der den Eisenerz-Boom lostrat und drauf und dran war, Atombomben einzusetzen, um das Erz schneller aus dem Boden zu holen. Aber auf anderen Gebieten haben sich natürlich tief verwurzelte Strukturen von Gefälligkeiten, Bestechung und unzulässiger Einflussnahme herausgebildet. Man denke nur an den politischen Skandal um die WA Inc, an diese Hochzeit zwischen Cowboy-Kapitalismus und politischem Filz in den späten 1980er und den frühen 1990er Jahren, die dazu führte, dass die Steuerzahler etwa 900 Millionen australische Dollar verloren und einige einflussreiche Politiker und Geschäftsleute ins Gefängnis kamen. Kurz, Korruption – in großem oder kleinem Stil, subtil oder offenkundig. Und wo es Korruption gibt, da findet man normalerweise auch ein paar korrupte Polizisten und ausreichend Stoff für einheimische Autoren.
Organisation ist alles, es sei denn …
Es verwundert kaum, dass die Polizei das organisierte Verbrechen gern der nicht organisierten Kriminalität vorzieht – mit dem organisierten Verbrechen lässt sich nämlich viel leichter umgehen, und es ist zudem weitaus lukrativer. Im düsteren Geflecht von Bordellen, Spielhöllen, Drogenbaronen und gierigen Polizeibeamten braucht man nur ein bisschen Schmiergeld locker zu machen und ein Auge zuzudrücken. Solange die Öffentlichkeit keinen Schaden nimmt, kann man es dann ruhig den kriminellen Banden selbst überlassen, sich und die anderen Gangs zu überwachen, auf ihre eigene brutale Art. Aber hin und wieder platzen solche Vereinbarungen, und die Maske fällt, so wie am Abend des 22. Juni 1975, als die bekannte Puffmutter Shirley Finn auf dem Highway 7 am Golfklub von South Perth ermordet wurde. Der Mord an Finn schockierte Perth, es war das erste Beispiel dafür, dass eine bekannte Persönlichkeit von der Unterwelt umgebracht wurde.
David Whish-Wilson thematisiert diesen Fall in seinem ersten Kriminalroman Line of Sight (Penguin 2010). Es ist eine düstere, wirklichkeitsnahe, unterhaltsame Lektüre. Die Tatsache, dass Finn ermordet wurde, weil sie gedroht hatte, die Namen jener Polizisten zu nennen, an die sie gezahlt hatte, und die Tatsache, dass ihre Leiche nach der „Bowlingkugel“-Exekution (vier Kopfschüsse) eindeutig zur Schau gestellt worden war, bestärkten in der Überzeugung, dass korrupte Polizeibeamte sie persönlich umgebracht hatten. In der Folge äußerten sich zwar einige mutige Zeugen vor dem parlamentarischen Untersuchungsausschuss, aber sie wurden rasch an den Rand gedrängt, und der Status quo – dass nämlich Kriminalbeamte in Western Australia von Prostituierten und Spielbetrieben Zahlungen einforderten – war wiederhergestellt. Alles ging wieder seinen gewohnten Gang.
Im Laufe der Jahre kamen mit deprimierender Regelmäßigkeit weitere Fälle von Korruption, Trägheit und Inkompetenz bei der Polizei ans Licht, und die gleichen bereits bekannten Namen tauchten immer wieder auf. Alles Stoff für einheimische Krimiautoren, um Dichtung und Wahrheit miteinander zu verweben. Hier noch einmal Cato Kwong in Getting Warmer:
Kwong war bei seinen Schlussfolgerungen über Colin Graham vom Geld ausgegangen […] Ein Katalog von missglückten Razzien, durchgesickerten Informationen und großen Bareinzahlungen auf das Konto einer Familienstiftung legten nahe, dass Graham mit den Apachen unter einer Decke steckte […] Man glaubte, für mindestens einen Mord der Apachen vor zwei Jahren sei er persönlich verantwortlich gewesen – er hatte der Bande seine Qualifikation beweisen wollen. (S. 222)

Blick vom King’s Park in Perth.
Lebensgefährliche Literatur
In The Mickelberg Stitch (Bookscope 1985) behauptete der Autor Avon Lovell, die drei Brüder Mickelberg seien aufgrund von Falschaussagen, Schlägen und Einschüchterung sowie gefälschtem Beweismaterial für den Perth Mint Swindel, einen spektakulären Goldraub im Jahr 1982, verurteilt worden. Nach diesen Enthüllungen folgte die Vergeltung auf dem Fuße. Jemand feuerte eine Kugel durch Lovells Bürofenster, der Autor erhielt zahlreiche Drohungen, die Bremsen seines Wagens wurden manipuliert, und vor Gericht unterlag er haushoch. Sein Buch wurde verboten und von uniformierten Polizisten aus den Buchhandlungen entfernt. Lovells Prozess machte ihn bankrott, und niemand wollte ihm Arbeit geben, obwohl sich jede einzelne seiner Behauptungen im Nachhinein als richtig erwies.
Ein Whistleblower sagte aus, dass Detective Don Hancock der Schuldige war, und anschließend erhängte er sich. Hancock hatte ein paar Jahre zuvor auch die Zeugenaussagen aller Prostituierten, die für Shirley Finn gearbeitet hatten, aufgenommen. Diese Aussagen ähnelten sich unheimliche Weise. Zur Belohnung hatte man Hancock zum Leiter der Kriminalabteilung befördert. Später wurde er von Motorradgangstern mit einer Autobombe umgebracht, als Rache für den angeblichen Mord an einem ihrer Mitglieder, das auf den Goldfeldern erschossen worden war. Einige Jahre später kam es dann zu dem Fall Andrew Mallard, der für einen Mord, den er nicht verübt hatte, zehn Jahre im Gefängnis saß. Als Beweis hatte ein gefälschtes Geständnis gedient. Dieser Fall inspirierte mich zu meiner fiktiven Vorgeschichte von Catos Sturz in Prime Cut:
Wie bald hatte Cato Kwong gewusst, dass das alles Humbug gewesen war? Erst, als die Koalition aus drängelnden Journalisten und Weltverbesserern acht Jahre nach Peter Beatons Inhaftierung Berufung einlegte? Oder schon, als Hutchens ihn eine halbe Stunde, nachdem Beaton sein Geständnis unterzeichnet hatte, zur Seite nahm und von ein paar Ungereimtheiten sprach, die ausgebügelt werden mussten? Zum Beispiel? Zum Beispiel war der Verhaftete groß und mager, hatte dunkles Haar und ein riesiges Spinnennetz-Tattoo auf dem Hals, das anscheinend niemand bemerkt hatte. Die Zeuginnen aber hatten von einem mittelgroßen Mann mit rötlichem Haar gesprochen. (Prime Cut, S. 111)
Die jüngere und auch die weiter zurückliegende Kriminalgeschichte und die alltäglichen Storys über den Boom bieten also ausreichend Inspiration für uns Autoren. Aber was wäre, wenn wir sie verlieren würden? Dem Vernehmen nach ist der Mummenschanz vorbei und die guten Zeiten sind dahin. Der Preis für Eisenerz ist in den Keller gefallen, die Bergbau-Magnaten schnallen die Gürtel enger und Arbeiter werden entlassen. El Dorado hat wohl seinen Glanz verloren. Dieses Szenario wird in Prime Cut bereits angedeutet:
Ratzfatz von der Boomtown zur Geisterstadt, schneller, als man papp sagen konnte. Es war noch viel schlimmer, als die Gerüchteküche es sich je hätte ausmalen können. Ein Foto auf der Titelseite zeigte das Ortsschild von Hopetoun: Vor den Ortsnamen hatte jemand ein „NO“ gesprüht. Die Stadt ohne Hoffnung. Die ersten, die geopfert wurden, waren offenbar die Gastarbeiter, die jetzt nicht mehr gebraucht und in den nächsten Flieger nach Hause gesetzt wurden. Besorgnis wurde laut wegen der tapfer kämpfenden Einheimischen, die Firmen aufgemacht hatten, um der boomenden Stadt ihre Dienste anzubieten, und die nun, da ihr Markt nicht mehr existierte, einer ungewissen Zukunft entgegensahen. Cato vermutete allerdings, dass die Keith Stevensons und Jimmy Dunstans dieser Welt immer einen Weg finden würden, um irgendwie und irgendwo ihre Dollars zu machen. (Prime Cut, S. 364)
Wie gewonnen, so zerronnen
Was hat Western Australia von den Gewinnen aus diesem Multimilliarden-Dollar-Boom auf die Beine gestellt? Na gut, wir haben viele Marinas und große weiße Boote auf dem Swan River, und unsere Häuser gehören zu den teuersten in ganz Australien. Aber das erinnert mich an den Fußballspieler George Best, der in den 1960er und 1970er Jahren für Manchester United spielte und einer der ersten Superstars in seinem Sport wurde, bevor er seine Karriere als notorischer Säufer und Frauenheld beendete. Auf die Frage, was mit dem legendären Reichtum geschehen sei, den er angehäuft hatte, antwortete er: „Ich habe eine Menge Geld für Alkohol, Mädels und schnelle Autos ausgegeben. Den Rest hab ich einfach verpulvert.“ Nur sehr wenig von den Gewinnen aus dem Boom ist zurückgeflossen, um eine bessere Gesellschaft oder eine hellere, sicherere Zukunft zu schaffen. Wir kürzen weiterhin die Sozialausgaben und die Ausgaben für Gesundheit und Bildung, und die Zahl der Obdachlosen auf unseren Straßen nimmt zu. Wie gewonnen, so zerronnen.
Es gibt Hoffnung auf neue Katastrophen
Was aber wird aus den Drogenbaronen, den Erpressern und den Zuhältern, wenn der Boom verebbt? Was wird dann aus den sich abrackernden Schriftstellern, die die finsteren Machenschaften in El Dorado zu Papier bringen? Keine Angst. Das Ganze ist nur ein Zyklus, der nächste Boom kommt bestimmt. Einige Kommentatoren behaupten sogar, der Boom sei noch gar nicht vorbei, er bewege sich nur in eine neue Phase oder nehme eine neue Form an. Der Immobilienboom ist weiterhin stark, und es besteht nicht nur Nachfrage nach Häusern, sondern auch nach Agrarland – und wieder, wie schon beim Bergbau-Boom, ist China der Schlüsselmarkt. Dieses Thema erforsche ich in meinem dritten Buch, Bad Seed, in dem Cato nach Shanghai reist. Dort will er im Mordfall an einer chinesischen Familie ermitteln, die in ihrer Strandvilla südlich von Perth umgebracht wurde. In Western Australia muss man langfristig denken und lernen, sich in mageren Zeiten breit aufzustellen oder vielleicht den Markt zu manipulieren, so wie die Öl- oder die Eisenerzproduzenten es tun – sie fluten den Markt, um die kleineren Konkurrenten zu ertränken, und dann begrenzen sie ihre Lieferungen, um die Preise wieder in die Höhe zu treiben. Es gilt, neue Märkte zu finden und bereits existierende Märkte zu konsolidieren. Wieder einmal scheint es, als habe Darry Stretton, der „Bolzenschneider“, die Nase vorn gehabt.
Ein Jahr später war er wieder da. Erneut war er nach Perth gereist, um von dem gleichen Bergbau-Manager Geld zu erpressen. Diesmal wollte er 500.000 australische Dollar, mehr als das Doppelte der vorherigen Summe. In einem Boom-Staat steigen die Preise eben mit beachtlicher Geschwindigkeit. Bei einem Treffen in einem Restaurant wurde dem Opfer mitgeteilt, dass „Jungs“ von der Finks Outlaw Motorcycle Gang, der berüchtigten Motorradbande, in die Stadt kämen und dass er „eins drüber kriegen“ würde, falls er nicht zahlte. „Eins drüber“? Stretton war offensichtlich von Tarantino zu Good Fellas aufgestiegen. Dem Manager wurde auch gesagt, dass die Bewegungen seiner Kinder bekannt seien, ebenso wie der Standort seines Ferienhauses. Stretton erklärte, ein Komplize, der mit ihm zusammen nach Perth gekommen sei, „ein Mörder und Psychopath“, wie er sich ausdrückte, würde „das erledigen“. Falls der Manager zur Polizei gehen sollte, würde er möglicherweise getötet werden oder seine Familie würde verschwinden.
Daraufhin deponierte der Manager auf einem Konto Geld für Stretton, ging diesmal aber auch zu seinem Rechtsanwalt, denn bei diesen Preisen würden Strettons alljährliche Besuche ihn in den Ruin treiben, und der Kerl machte keine Anstalten, die Stadt zu verlassen. Nun wurde die Polizei eingeschaltet, Strettons Telefongespräche wurden abgehört, und er wurde verhaftet. Vor Gericht sagte Strettons Verteidiger, sein Mandant sei von anderen Männern bedroht worden, die ihm die Schuld dafür gaben, dass sie Hunderttausende von Dollars im Anlagegeschäft verloren hatten. Stretton zeigte inzwischen anscheinend Reue und äußerte den Wunsch, die ursprünglichen 200.000 AUD, die der Manager verloren hatte, zurückzuzahlen. Das aber war ihm wohl kaum möglich, denn er war bankrott und ihm stand eine Gefängnisstrafe bevor. Der Richter bemerkte, Strettons Erpressungsmethode sei zwar vielleicht nicht gerade elegant gewesen, dafür aber effektiv – jedenfalls für eine Weile.

Zieht sich viele Meilen hin: die „Millionaire’s Row“ entlang des Swan River.
Der Oligarchen-Streik
Wenn wir von eleganter Erpressung sprechen, dann waren die größten Gewinner des Booms vielleicht die Bergbau-Oligarchen. Nachdem sie Milliardenprofite eingesackt haben und maßlos und unsinnig reich geworden sind, stellt sich heraus, dass es den größten Unternehmen mit Hilfe von Tricks und origineller Buchführung gelungen ist, jegliche angemessenen Steuerzahlungen auf ihre märchenhaften Einnahmen zu umgehen. Denken wir an einen Steuersatz von 0,002 Prozent. Denken wir an Offshorefirmen, die ihre Einnahmen waschen. Stellen wir uns vor, dass im Laufe von acht Jahren auf 5,7 Milliarden Gewinn ganze 121.000 AUD Steuern gezahlt wurden.
In Perth organisierten die Oligarchen eine Demonstration mit 1200 gut betuchten Teilnehmern gegen die vorgeschlagene Bergbau-Steuer. Für eine Kampagne gegen diese Steuer gaben sie in sechs Wochen etwa 20 Millionen AUD aus. Die Steuer würde, behaupteten sie, die Investitionen drosseln und Arbeitsplätze vernichten. Und es klappte – die damalige Laborregierung gab klein bei. Die verwässerte, kastrierte Version der Steuer erbrachte fast gar keine Mehreinnahmen für das Staatssäckel und wurde von der neuen Regierung wieder aufgehoben. Wer braucht bei solchen Erfolgen noch Baseballschläger?
Mit einem persönlichen Besitz von etwa 10 Milliarden Dollar braucht ein Oligarch nur 25 Minuten, um das jährliche Durchschnittseinkommen eines Australiers von etwa 100 000 Dollar zu verdienen. Da kann Darryl Stretton nur vor Neid erblassen. Trotzdem hält das die Großverdiener nicht davon ab, herumzujammern. Sie klagen, Arbeiter in Australien erhielten zu hohe Löhne und es sei nicht leicht, mit den afrikanischen Bergbauunternehmen mitzuhalten, die ihren Sklaven pro Tag gerade mal 2 Dollar zahlten. Ich konnte nicht anders, in Getting Warmer habe ich auf diesen Sachverhalt aufmerksam gemacht:
Cato fand mit seiner Laksa mit Meeresfrüchten einen freien Tisch und setzte sich. Am Nachbartisch erhob sich eine stämmige junge Frau in Krankenschwesterntracht, um zu gehen. Ihren halb durchgelesenen West ließ sie liegen, und Cato beugte sich hinüber und stibitzte ihn. In der Schlagzeile sorgte man sich um die Auswirkungen einer angedrohten Bergbau-Steuer auf die ungesicherten Lebensverhältnisse der Milliardäre im Land. Bei Forbes, wo die Ranglisten der Reichen aufgestellt wurden, vermutete man, eine Kombination aus überhöhten Steuern, Gewerkschaftsrüpeln und hohen Lohnforderungen würde dazu führen, dass die Milliardäre ihre Tätigkeiten nach Afrika verlegten, denn sie wussten, wie man dort Geschäfte machte. Zwei Dollar am Tag pro Arbeiter, schätzten sie. Der Premierminister war ein wenig beunruhigt und wollte sehen, was sich machen ließ. (S. 135)
Zwei australische Dollar am Tag? Das nenne ich kriminell. Wenn unsere Politiker und Oligarchen ihre Führungsaufgaben mit dieser moralischen Einstellung wahrnehmen, ist es kein Wunder, dass unsere Gesellschaft vor Zynismus und ungreifbarer Wut kocht. Aber zum Glück gibt es in Western Australia ja noch die hart arbeitenden Krimiautoren – sie halten der Gesellschaft für einen Durchschnittsverdienst von etwa zwei australischen Dollar pro Tag einen Spiegel vor und bieten, zumindest fiktiv, Lösungen an, in denen das Gute über das Böse triumphiert.
(Deutsch von Sabine Schulte; Fotos aus Perth von Alf Mayer)
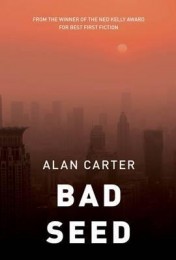 Alan Carter: Geboren 1959. Wanderte 1991 von England nach Australien aus. Arbeitet als Dokumentarfilmregisseur und hat sich mit drei Romanen um den Außenseiter-Polizisten Cato Kwong eine erhebliche Reputation als Kriminalautor erschrieben, der die westaustralische Gesellschaft und Politik präzise seziert. Bücher auf Deutsch: „Prime Cut“ (Edition Nautilus, 2015) und „Des einen Freud“ (Edition Nautilus, 2016). Carter lebt in Fremantle/Western Australia. Cato Nr. 3, „Bad Seed“ erscheint vermutlich übersetzt bei uns 2017.
Alan Carter: Geboren 1959. Wanderte 1991 von England nach Australien aus. Arbeitet als Dokumentarfilmregisseur und hat sich mit drei Romanen um den Außenseiter-Polizisten Cato Kwong eine erhebliche Reputation als Kriminalautor erschrieben, der die westaustralische Gesellschaft und Politik präzise seziert. Bücher auf Deutsch: „Prime Cut“ (Edition Nautilus, 2015) und „Des einen Freud“ (Edition Nautilus, 2016). Carter lebt in Fremantle/Western Australia. Cato Nr. 3, „Bad Seed“ erscheint vermutlich übersetzt bei uns 2017.
Offenlegung: Thomas Wörtche ist Redakteur, Tobias Gohlis Autor bei CrimeMag, daneben sind beide Herausgeber des Krimimagazins, Ausgabe: Crime & Money (Droemer), in dem dieser Artikel erschienen ist. Im CrimeMag erscheint er nun ebenfalls, nicht etwa weil Alan Carter die Herausgeber bestochen hätte, sondern damit dieser wichtige Artikel eine große Öffentlichkeit erhält.












