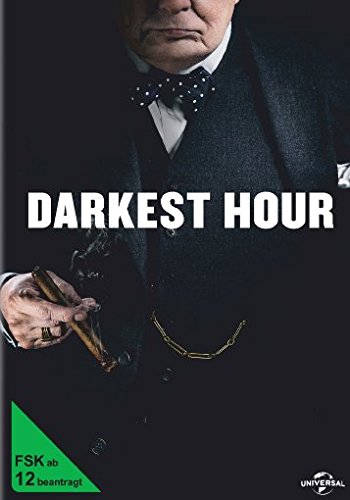 Blut, Schweiß und Pathos: Keep calm and admire Winston!?
Blut, Schweiß und Pathos: Keep calm and admire Winston!?
Offenbar war er noch nie so wertvoll wie heute – jedenfalls für Historiker, Sachbuch-Autoren und Film-Regisseure: Das Churchill-Enigma fasziniert das Publikum in diesen turbulenten Brexit-Zeiten immer noch. „Darkest Hour“ (Regie: Joe Wright, mit Gary Oldman als Churchill) zeigt den britischen Nationalhelden Winston Churchill (1874-1965) im Mai 1940 als Staatsmann, Krisenmanager und Retter vor dem Nazi-Terror. Gegenüber den Appeasern Chamberlain und Halifax hat er zwar einen schweren Stand, aber er setzt sich mit seinem „Never surrender“-Kampfgeist und seiner elektrisierenden Rhetorik durch. Doch was soll diese filmisch betriebene Denkmalpflege über 50 Jahre nach dem Tod dieser Symbolfigur signalisieren? Wie aktuell ist heute überhaupt noch der von Boris Johnson beschworene „Churchill Faktor“? – Von Peter Münder.
Den Whisky konsumiert er zum Frühstück, die Zigarre wird nebenher mit ritualisierter Hingabe entzündet, bevor der große massige Mann das erste Diktat des Tages in Angriff nimmt, das er auch mal in der Badewanne hinter verschlossener Tür durchführt. Doch der nörgelnde, gnadenlos oberlehrerhafte Churchill verhält sich gegenüber der neuen Sekretärin so rücksichtslos, dass diese bald ihre staccato-Hackrei auf der mächtigen Schreibmaschine aufgibt und weinend davon läuft. So präsentiert Gary Oldman in den ersten „Darkest Hour“-Szenen den eigensinnigen, exzentrischen Krisenbewältiger Churchill, der sich in der schwersten Stunde der Nation mit den Appeasern, Skeptikern und Defätisten herumschlagen muß, die nach all den teutonischen Überfällen und Annexionen und sogar noch während der Umkesselung von Dünkirchen glauben, mit anbiedernden „Verhandlungen“ die blutrünstigen Nazis beschwichtigen zu können.
Churchill als unbeugsamer Kämpfer hatte längst erkannt, dass Nachgiebigkeit gegenüber der „furchtbarsten Tyrannei in der menschlichen Geschichte“ nur noch deren Aggressionspotential steigert – seine Kampfansage an Hitler gilt daher auch für die englischen Appeaser Halifax, Chamberlain, Lord Astor, Darlington oder den mit den Nazis sympathisierenden Medien-Mogul („Daily Mail“) Lord Rothermere. Der hatte Hitler übrigens schon 1938 ein Telegramm geschickt, das einer Ergebenheitsadresse gleichkam: „Mein Führer, Ihr Stern steigt immer höher und ich wünsche Ihnen jeden nur denkbaren Erfolg“.
Als Chamberlain zurücktritt und Churchill am 10. Mai 1940 zum Premier und Verteidigungsminister ernannt wird, schlägt ihm im Unterhaus eine Welle von Skepsis und Mißtrauen entgegen. Die schicksalhafte Parlamentsdebatte über Britanniens von „Blood, Sweat, Toil and Tear“ verdüsterter Zukunft taucht die Kamera in ein düsteres Licht, das von einzelnen Strahlen durchbrochen wird – hier bahnen sich noch zahlreiche weitere existentielle Konflikte an, ahnen wir.
Irritierend ist allerdings, dass im Film nur einige Stichworte andeuten sollen, worauf das allgemeine Mißtrauen gegenüber Churchill beruht. Denn sein 1904 erfolgter Parteiwechsel von den Konservativen zu den Liberalen und dann von 1924 wieder zurück zu den Konservativen bleibt ebenso unerwähnt wie seine von Heer und Marine eingefädelte katastrophale amphibische Operation während des 1. Weltkriegs bei Gallipoli, wo auf britischer Seite ca. 50 000 Soldaten fielen.
 Die Grenze zum Kitsch überschreitet Regisseur Joe Wright , wenn der Premier als volkstümlicher U-Bahnfahrer mit anderen Passagieren über die Nazi-Bedrohung diskutiert: Sie alle bestärken den Kriegshelden in seiner kompromißlosen Einstellung; das Macauly-Zitat (aus „Horatius“) wird von einem begeisterten Passagier sogar zu Ende deklamiert: „Wie stirbt ein Mann denn besser, als im Kampf mit der Gefahr, für die Asche seiner Väter“? Da der historische Hintergrund von Wright sonst penibel beachtet wird, fällt diese fiktive Szene doch ziemlich drastisch aus dem Rahmen. Und verstärkt den Eindruck, dass man hier mit Szenarios für moralische Aufrüstung konfrntiert wird und vielleicht in einem Durchhalte-Seminar für Brexit-Gebeutelte gelandet ist. Oder soll der verblasste Glanz eines ehedem grandiosen Empire hier wieder aufpoliert werden? Nach dem Motto „We shall fight them in their EU-offices, in their canteens, at their cash machines and behind their PCs“?
Die Grenze zum Kitsch überschreitet Regisseur Joe Wright , wenn der Premier als volkstümlicher U-Bahnfahrer mit anderen Passagieren über die Nazi-Bedrohung diskutiert: Sie alle bestärken den Kriegshelden in seiner kompromißlosen Einstellung; das Macauly-Zitat (aus „Horatius“) wird von einem begeisterten Passagier sogar zu Ende deklamiert: „Wie stirbt ein Mann denn besser, als im Kampf mit der Gefahr, für die Asche seiner Väter“? Da der historische Hintergrund von Wright sonst penibel beachtet wird, fällt diese fiktive Szene doch ziemlich drastisch aus dem Rahmen. Und verstärkt den Eindruck, dass man hier mit Szenarios für moralische Aufrüstung konfrntiert wird und vielleicht in einem Durchhalte-Seminar für Brexit-Gebeutelte gelandet ist. Oder soll der verblasste Glanz eines ehedem grandiosen Empire hier wieder aufpoliert werden? Nach dem Motto „We shall fight them in their EU-offices, in their canteens, at their cash machines and behind their PCs“?
Oldmans Churchill ist ein sympathischer, exzentrischer Kauz, nuschelnd, rechthaberisch, dynamisch, humorvoll und kämpferisch – wie man es von diesem Nationalhelden erwartet. Wie viele Kilogramm Latexprothesen ihm der Maskenbildner verpasst hat, damit der eher schmächtige Oldman seinem korpulenten historischen Vorbild ähnelt, ist mir ehrlich gesagt, völlig Wurscht. Das Heraussägen einiger weniger Segmente aus dem historischen Bilderbogen ohne die damaligen komplexen politischen Zusammenhänge zu berücksichtigen, hat allerdings den Nachteil, dass manche Aktionen eher rätselhaft anmuten. Was ja auch schon zutraf für „Five Days in London“ von John Lukacs (2001).
Regisseur Joe Wright legte auch schon in seinem Kostümfilm „Charles II.“ (2005) großen Wert auf emotionale Achterbahnfahrten: Nach der Vertreibung durch Cromwells Revoluzzer kann Charles II. seine triumphale Rückkehr auskosten. Die Verfilmung von McEwans-Roman „Atonement“ (Abbitte) in dem nicht nur das phonstarke Klappern der Schreibmaschinen auffällt, sondern auch sein verspielter Umgang mit optischen Effekten, wurde von einigen Kritikern als schmalziges Pilcher-opus abgetan, weil die falsche optische Wahrnehmung der 13jährigen Briony, die zu so unsäglichen Konsequenzen führt, als ästhetisch ansprechendes Wasserspiel verharmlost wurde. Kann ja sein, ich finde es allerdings ganz sympathisch, wenn sich Wright wie Tom Hanks als Schreibmaschinen-Fan outet und das markante Klappern einer alten Remington wie ein betörendes Leitmotiv von Wagner zum Dröhnen bringt.
Welchen Churchill hätten Sie denn gern?
Da Churchill schon früh als Kriegsreporter in Kuba, im südafrikanischen Burenkrieg und als Kavallerist an der Schlacht von Omdurman im Sudan teilnahm und darüber stark beachtete und hochbezahlte Reportagen veröffentlichte, gibt es neben den vielen Churchill-Biographien auch zahlreiche Rückblicke, Reportagen, die sechsbändige Geschichte des 2. Weltkrieges und historische Analysen von ihm selbst – für die „Geschichte englischsprachiger Völker“ erhielt er 1953 den Literatur-Nobelpreis. Ungefähr hundert literarische Neuerscheinungen beschäftigen sich jährlich mit Winston Churchill – aber es gibt immer noch überraschende Aspekte, die bisher im Churchill-Kontext kaum bekannt waren: Etwa die Casino-Zocker- und Aktienspekulations-Thematik, seine Verschwendungssucht und Geldnot, die Churchill dazu trieb, maximale Honorarforderungen für alle möglichen Berichte, Reportagen und historischen Rückblicke zu verlangen, die er nach Vertragsabschluß oft noch an weitere Verlage  verkaufte. Die lukrativsten Honorare bekam er übrigens für den Verkauf von Filmrechten – auch wenn die Filme nicht realisiert wurden, wie David Lough in seinem grandiosen Band „No More Champagne – Churchill and His Money“ 2015 enthüllte. Darin wird allerdings auch der millionenschwere Churchill beschrieben, der seine Zigarren-und Champagner-Lieferanten sowie die Schneider meisten drei bis fünf Jahre auf die Bezahlung seiner exorbitanten Rechnungen warten ließ. Und der große Staatsmann ließ auch keine Tricks unversucht, um das Finanzamt zu überlisten – ganz im Vertrauen konsultierte er auch mal den Schatzkanzler, wenn hohe Steuernachzahlungen fällig waren. „Ich bin eben ein Autor, dem die politischen Geschäfte oft in die Quere kommen“, war Churchills Erklärung, wenn Verleger wieder einmal längst fällige und bezahlte Texte von ihm einforderten.
verkaufte. Die lukrativsten Honorare bekam er übrigens für den Verkauf von Filmrechten – auch wenn die Filme nicht realisiert wurden, wie David Lough in seinem grandiosen Band „No More Champagne – Churchill and His Money“ 2015 enthüllte. Darin wird allerdings auch der millionenschwere Churchill beschrieben, der seine Zigarren-und Champagner-Lieferanten sowie die Schneider meisten drei bis fünf Jahre auf die Bezahlung seiner exorbitanten Rechnungen warten ließ. Und der große Staatsmann ließ auch keine Tricks unversucht, um das Finanzamt zu überlisten – ganz im Vertrauen konsultierte er auch mal den Schatzkanzler, wenn hohe Steuernachzahlungen fällig waren. „Ich bin eben ein Autor, dem die politischen Geschäfte oft in die Quere kommen“, war Churchills Erklärung, wenn Verleger wieder einmal längst fällige und bezahlte Texte von ihm einforderten.
Alle zwei oder drei Jahre werden obendrein auch Biopics produziert, die zwar nicht speziell anläßlich runder Jubelfeiern (D-Day, Geburtstag, Todestag) für den britischen Durchhalte-Apostel realisiert wurden, aber meistens doch wie kitschige Denkmalpflege anmuten. In der anrührenden Netflix-Serie „The Crown“ (2016) ist der ziemlich ausgelaugte Churchill (gespielt von John Lithgow) besonders zerknirscht, als die junge Queen ihn wegen seiner Ignoranz hinsichtlich des tödlichen Londoner Smog maßregelt und ihn auch noch zum längst fälligen Rücktritt auffordert; in „The King´s Speech“ (2010) hat Timothy Spall die Chance, seine wärmste Sympathie für die doppelt geschiedene Mrs. Simpson und den unseligen Duke of Windsor auszudrücken. Nur in Jonathan Teplitzkys „Churchill“ von 2017 (Hauptrolle Brian Cox) wird das Psychogramm einer düsteren, depressiven und jähzornig-rechthaberischen Natur geliefert: Bei der Planung der Aliierten für den D-Day ist Churchill im April 1944 keineswegs der souveräne Kriegsherr, sondern der Störenfied, der Eisenhower, Montgomery und andere Oberbefehlshaber extrem nervt. Die störrische Bulldogge will alle Invasionspläne kurzerhand über den Haufen werfen, weil ihm zwei geteilte Angriffslinien viel erfolgversprechender erscheinen als eine stringente Offensive. Unbelehrbar, wie er schon im Ersten Weltkrieg bei der Planung für das amphibische Gallipoli-Desaster in den Dardanellen war, widersetzt er sich allen plausiblen Argumenten, bis ihn seine fürsorgliche Ehefrau Clementine (und auch der König Georg VI.) zur Einsicht bringen können.
Doch unbeirrt betrachtete sich Churchill später in seinen Kriegsberichten und Erinnerungen („Memoirs of the 2nd World War“) weiter als einzig kompetenter Experte für amphibische Militäroperationen.

Mit den Nazis verhandeln? Niemals!
In vielen Biographien und historischen Studien wird darüber spekuliert, was gewesen wäre, wenn die Appeasement-Fraktion um Chamberlain und Halifax sich durchgesetzt hätte. Wäre die Insel von den Nazis nach dem Polenfeldzug und dem Sieg über Frankreich dann einfach überrollt worden und als eine Art britisches „Reichsprotektorat“ unter teutonische Verwaltung gestellt worden? Der „Churchill Faktor“ machte vor allem während der Einkesselung von Dünkirchen im Mai 1940 den entscheidenden Unterschied: Hätten die deutschen Truppen ihre Angriffe auf die britisch-französischen Truppen fortgesetzt und die Invasionspläne weiter verfolgt, wäre die labile Lage wohl auch trotz Churchills glühender Rhetorik nicht zu retten gewesen. Aber nach der erfolgreichen Evakuierung konnte Churchill die Zuversicht und den Siegeswillen der Briten beflügeln – auch wenn die „Blood,Toil, Tears and Sweat“-Theatralik heute allzu melodramatisch anmutet. Jedenfalls konnten sich die bei den Nazis (und auch bei Mussolini) anbiedernden Appeaser um Chamberlain und Halifax nicht durchsetzen und der auf Aufrüstung setzende und Verhandlungen mit dem „Führer“ ablehnende Churchill wurde statt Halifax zum Premier ernannt – obwohl König Georg VI. lieber Halifax als Churchill in Number Ten gesehen hätte. Kriegsentscheidend war dann natürlich Roosevelts Entscheidung, Churchill im Krieg gegen die Nazis mit amerikanische Waffen und Truppen zu unterstützen.
 Diesen „Churchill Faktor“ hatte auch Boris Johnson im Auge, als er anlässlich des 50. Todestages von Churchill 2015 sein locker-ironisches Buch „The Churchill Factor“ veröffentlichte. Er kokettiert darin aber mehr mit seinen eigenen brillanten Faktoren – etwa mit rhetorischen Glanzleistungen und selbstironischen Eskapaden – als mit pragmatisch- politischen Plänen zur Bewältigung der britischen Alltagsmisere.
Diesen „Churchill Faktor“ hatte auch Boris Johnson im Auge, als er anlässlich des 50. Todestages von Churchill 2015 sein locker-ironisches Buch „The Churchill Factor“ veröffentlichte. Er kokettiert darin aber mehr mit seinen eigenen brillanten Faktoren – etwa mit rhetorischen Glanzleistungen und selbstironischen Eskapaden – als mit pragmatisch- politischen Plänen zur Bewältigung der britischen Alltagsmisere.
Wer in Churchills Memoiren die Kapitel über die entscheidenden Kriegsjahre und über das Verhalten der Appeasement-Klüngel liest, kann sich nur verblüfft die Augen reiben: Denn man merkt dem Autor fast in jeder Zeile an, wie er vor Wut kocht und sich empört: Da hat Chamberlain sein Haus am Eaton Square an den deutschen Botschafter Ribbentrop vermietet, da gibt es Treffen auf den Landsitzen von Aristokraten wie Lord Darlington, der Ribbentrop regelrecht hofiert und dessen antisemitische Hetze so weit internalisiert, dass er zwei jüdische Zimmermädchen entlässt. Schon Ende 1937 war Außenminister Eden angesichts der rasanten deutschen Aufrüstung so verärgert und besorgt über die eigene laxe britische Aufrüstung, dass er sich beim Premier Chamberlain über diese Defizite beschwerte. Eden wird daraufhin von Chamberlain wie ein debiler Schuljunge mit der Empfehlung abgekanzelt: „Why don´t you just go home and take an Aspirin?“ Seine brachiale Unnachgiebigkeit gegenüber den Nazi-Horden wird von dieser Wut über die verschlafenen englischen Biedermänner angefeuert, die eine unvermeidliche Konfrontation mit den deutschen Brandstiftern unbedingt vermeiden wollen und alles ausblenden, was ihr rosiges „Peace in our Time“-Weltbild stören könnte.
 Wenn Sebastian Haffner in seiner brillanten, scharfsinnigen Churchill-Monographie von 1967 (jetzt anläßlich des „Darkest Hour“–Films in einer Neuauflage vorliegend!) den großen Briten zuerst als Krieger und Kämpfer charakterisiert und dann auf seine anderen Eigenschaften eingeht, dann hat er damit den eigentlichen Kern dieses letzten „Viktorianers“ erkannt, der sich erst als 19Jähriger auf der Militärakademie Sandhurst aus dem Schatten seines berühmten Vaters Lord Randolph entfernen und frei entfalten konnte. In seinem 1930 veröffentlichten Band „My Early Life“ weist Churchill auf seinen traditionellen Wertekanon hin, den er aus der viktorianischen Epoche übernommen hat: Das britische Empire war auf den Meeren unangefochten und dementsprechend sicher in heimatlichen Gefilden; und es konnte der Welt außerdem Lektionen erteilen, wenn es um die Kunst des Regierens ging.
Wenn Sebastian Haffner in seiner brillanten, scharfsinnigen Churchill-Monographie von 1967 (jetzt anläßlich des „Darkest Hour“–Films in einer Neuauflage vorliegend!) den großen Briten zuerst als Krieger und Kämpfer charakterisiert und dann auf seine anderen Eigenschaften eingeht, dann hat er damit den eigentlichen Kern dieses letzten „Viktorianers“ erkannt, der sich erst als 19Jähriger auf der Militärakademie Sandhurst aus dem Schatten seines berühmten Vaters Lord Randolph entfernen und frei entfalten konnte. In seinem 1930 veröffentlichten Band „My Early Life“ weist Churchill auf seinen traditionellen Wertekanon hin, den er aus der viktorianischen Epoche übernommen hat: Das britische Empire war auf den Meeren unangefochten und dementsprechend sicher in heimatlichen Gefilden; und es konnte der Welt außerdem Lektionen erteilen, wenn es um die Kunst des Regierens ging.
Diese „Rule Britannia“-Mentalität hatte Churchill eigentlich nie aufgegeben – auch nach dem Ende des 2. Weltkrieges war das noch seine Maxime. Sie führte auch zu seiner gnadenlos-rassistischen Hetze gegen Indien und Gandhi, den Churchill ja am liebsten lebenslang einkerkern wollte. Sebastian Haffner weist auf diese düsteren Seiten Churchills hin und bemerkt dazu kritisch, dass manche Tiraden des britischen Staatsmannes sich kaum von denen Hitlers unterschieden. Allergisch reagierte Churchill stets auf kritische Einwände anderer: Als er sich von Stalin und Roosevelt auf den großen Konferenzen vor Kriegsende wie ein subalterner Statist behandelt fühlte, entwickelte er eine massive Stalin-Aversion, die er jedoch gekonnt kaschierte. Auch seine vermeintliche Europa-Begeisterung relativiert sich schnell, wenn man in Betracht zieht, dass dieses Europa aus seiner Sicht natürlich noch vom Empire bevormundet und in das Commonwealth eingebunden sein sollte. Und über seine um 1950 ausgebrüteten Ideen für einen militärischen Angriff auf die Sowjetunion wollen wir lieber den Mantel des Schweigens ausbreiten.
Der „Darkest Hour“-Film wurde übrigens von der Londoner Churchill Society als bisher bester Churchill-Film überhaupt bejubelt. Es gab ein Preview im State Room in Number Ten, wo die prominenten Zuschauer von dieser filmischen Glorifiezierung sehr angetan waren. „Falls sich Winston irgendwo hinter den Tapeten versteckt haben sollte, wäre er über diesen Film bestimmt äußerst entzückt gewesen und hätte zufrieden geschmunzelt“, lautete der Kommentar auf der Churchill Society-Homepage.
Peter Münder
Infos/Literatur:
Sebastian Haffner: Churchill. Rowohlt Monographie, Reinbek. Neuauflage 2018 (zuerst 1967)
Christian Graf von Krockow: Churchill. Eine Biographie des 20. Jahrhunderts. Hamburg 1999
David Lough: No More Champagne. Churchill and his Money. Head of Zeus, London 2015
Mary Soames (edt.): Winston and Clementine. The personal Letters of the Churchills. Boston 1999
Boris Johnson: The Churchill Factor. London 2014.
David Stafford: Churchill & Secret Service. London 1995
Andrew Roberts: Churchill und seine Zeit. Aus dem Engl. von Friedrich Griese. München 1998
Johann N. Schmidt: Großbritannien 1945 – 2010. Stuttgart 2011
M.F. Perutz: What If ? Kritik zu John Lukacs/ Five Days in London May 1940. In: New York Review of Books, 8/3/ 2001.
Brian Urquhart: How great was Churchill? Kritik zu Max Hastings: Winston´s War: Churchill 1940-1945. In: New York Review of Books 19/8/ 2010
Winston Churchill: My Early Life. London 1989 (zuerst 1930)
ders.: Memoirs of the Second World War. (Six volumes in one) Boston 1959
International Churchill Society: www. winstonchurchill.org
Ihr Magazin heißt – natürlich -: „Finest Hour„.











