Fear, Loathing and Madness in the White House
Eine merkwürdige Paralyse grassiert unter maßgebenden amerikanischen Politikwissenschaftlern, Historikern, Journalisten und aktiven Politikern: Wenn über das Thema Impeachment diskutiert wird, lautet die Devise der Wegducker: „Don´t mention the I-word“! Warum eigentlich? Als wirksame Drohkulisse hatte die Einleitung eines Impeachmentverfahrens bereits 1974 „Tricky Dick“ Richard Nixon vor einer endgültigen Amtsenthebung zum Rücktritt veranlaßt. Von Peter Münder
Den Wahlkampf von Donald Trump hatte Allan Lichtman genau verfolgt und sogar den völlig überraschenden, sensationellen Wahlsieg des egomanischen Dealmakers vorhergesagt, worauf der Wahlsieger T sich sogar entzückt beim Geschichtsprofessor Lichtman (American University Washington) für die zutreffende Prognose mit einem Dankschreiben statt des üblichen Twitter-Gestammels bedankt hatte. Lichtman hatte bei seiner insgesamt achten zutreffenden Wahlprognose nicht nur alle gängigen Parameter wie Umfrage-Ergebnisse, Tweets, Medienberichte, Debatten, Werbekampagnen und Parteistrategien total ignoriert („das alles zählt wenig oder gar nichts am Wahltag“), sondern gleichzeitig auch prophezeit, dass Trump bald nach seinem Amtsantritt mit einem Impeachment-Verfahren zu rechnen hätte. In seinem Buch „The Case for Impeachment“ begründet er nun ausführlich – auch mit Bezug auf die von den Gründungsvätern in ihren für die Verfassung erarbeiteten Impeachment-Artikeln – warum eine Amtsenthebung des amtierenden Präsidenten geboten ist und auch erfolgreich sein sollte. Er ist damit einer der wenigen, der klare Kante zeigt und aufgrund diverser Trump-Desaster wie der Moskau-Connection inklusive kommerzieller Interessen (mit der Planung für ein Moskauer T-Hotel) sowie russischer Wahlkampfbeeinflussung (offenbar über gehackte email-Accounts von Hilary Clinton) nachzuweisen versucht, dass eine Amtsenthebung keineswegs abwegig wäre. Hinzu kommen noch gravierende Falschaussagen, Vertuschungsmanöver und die schon für Nixon damals fatale, „impeachable“ Behinderung der Justiz. Lichtman hat zwar eine lange Liste mit Impeachment-Begründungen ausgearbeitet; er entwickelt jedoch einen exzessiven Übereifer, wenn er auch die psychisch-mentale Kondition nebst Ferndiagnosen von Analytikern einbezieht oder etwa T´s Aversion gegen den Klimawandel als „Verbrechen gegen die Menschlichkeit“ darstellt und für „impeachable“ befindet.
Aber welche Vergehen sind überhaupt „impeachable“?

„We, the People“ gegen Präsidenten-Willkür
Das ziemlich komplexe Procedere ist von den Vätern der amerikanischen Verfassung festgelegt worden. Washington, Madison, Franklin, Jefferson, Hamilton u.a. wollten nach der errungenen Unabhängigkeit von der englischen Krone unbedingt verhindern, dass ein amerikanischer Präsident sich ähnlich selbstherrlich und willkürlich geriert wie Georg III. – daher hatten sie die zuständigen Entscheidungs-Instanzen für ein Impeachment-Verfahren bereits in Artikel 1präzise beschrieben. In seinen „Federalist Papers“ hatte sich Alexander Hamilton (1755-1804, im Duell von seinem Widersacher Aaron Burr erschossen) schon ausführlich im 65. Artikel vom 7. März 1788 und in weiteren Beiträgen darüber ausgelassen, wobei er auch die Voreingenommenheit sympathisierender und feindlicher Gruppierungen ansprach, die bei Impeachmentverfahren beteiligt sind:
„Ein gut konstituiertes Gericht für Amtsenthebungsverfahren ist in einem Regierungssystem, das völlig auf Wahlen basiert, ebenso wünschenswert wie schwierig zu konstituieren. Gegenstand seiner Zuständigkeit sind solche Vergehen, die sich aus dem fehlverhalten von Inhabern öffentlicher Ämter ergeben, aus dem Mißbrauch oder der Verletzung des ihnen in Treuhänderschaft übertragenen öffentlichen Amtes. Sie sind ihrem Wesen nach das, was man mit besonderem Recht POLITISCH (sic!) bezeichnen kann, weil sie sich überwiegend auf Vergehen beziehen, die unmittelbar der Gesellschaft zugefügt worden sind. Aus diesem Grund wird ihre Strafverfolgung immer die Leidenschaften der ganzen Gemeinschaften aufputschen, und sie in Gruppierungen aufspalten, die den Angeklagten gegenüber mehr oder weniger freundlich oder feindlich gesonnen sind. … In solchen Fällen besteht die große Gefahr, daß der Urteilsspruch stärker durch die relative Stärke durch die relative Stärke der Gruppierungen als durch die wahren Beweise von Unschuld oder Schuld bestimmt wird“. (Adams: Die Federalist-Artikel von Hamilton/Madison/Jay. UTB 1994, S. 395).
 Diese „aufgeputschten Leidenschaften“ kochten im Nixon-Verfahren ebenso hoch wie beim Impeachment von Bill Clinton, das von den Republikanern ja eher als willkommenes Schlachtfest betrachtet wurde, bei dem der politische Charakter präsidialer Verfehlungen (Clintons Falschaussage unter Eid) weitgehend ausgeblendet wurde, weil man lieber die von Monica Lewinsky präsentierten Oralsex-Details goutieren wollte. Nixon warf jedoch das Handtuch, als seine Amtsenthebung unvermeidbar war und seine kriminellen Vertuschungsmanöver ans Licht der Öffentlichkeit gelangt waren.
Diese „aufgeputschten Leidenschaften“ kochten im Nixon-Verfahren ebenso hoch wie beim Impeachment von Bill Clinton, das von den Republikanern ja eher als willkommenes Schlachtfest betrachtet wurde, bei dem der politische Charakter präsidialer Verfehlungen (Clintons Falschaussage unter Eid) weitgehend ausgeblendet wurde, weil man lieber die von Monica Lewinsky präsentierten Oralsex-Details goutieren wollte. Nixon warf jedoch das Handtuch, als seine Amtsenthebung unvermeidbar war und seine kriminellen Vertuschungsmanöver ans Licht der Öffentlichkeit gelangt waren.
Und Trump, dieser „Messiah of the Maniacs“, wie ihn Thomas Adcock nennt (Vgl. seine Kolumne vom 15. November hier im Crime Mag) ? Nach all seinen Lügen und Skandalen, den peinlichen und irren „Grab her pussy“-Zitaten nebst den kommerziellen russischen Eskapaden dieses völlig überforderten pathologischen Turbo-Twitter-Selbstdarstellers stellte sich ja schon längst die Frage, warum die Diskussion über ein Impeachment-Verfahren gegen Trump so windelweich und zögerlich in den USA angegangen wurde. Dieser Präsident war ja eigentlich nie berechenbar, Nord-Korea als Erzfeind stellte mal das absolute Böse und Teuflische dar, was sich dann aber wieder schnell als überholt erwies, weil der koreanische Rocket-Boy-Diktator plötzlich zum liebenswerten Freund mutiert war – nur gut, dass Trump zwischendurch nicht doch noch auf den roten Knopf gedrückt hatte.
Neben all den psychologisch-mentalen Defiziten, die der Monomane im Weißen Haus jeden Tag aufs Neue demonstriert – wie Trump-Mitarbeiterin Omarosa Manigault Newman in ihrem extrem naiven, aber aufschlußreichen Selbsterfahrungsbericht aus der Froschperspektive „Entgleisung“ beschrieb – ergeben sich aber auch grundsätzliche verfahrenstechnische und verfassungsabhängige Probleme. Oder ist dies vielleicht nur ein Trugschluß, der konfliktträchtige Entscheidungen bis zur nächsten Präsidentenwahl verschieben soll, weil ein langwieriges Impeachmentverfahren den Regierungsapparat offenbar völlig lahmlegen würde, wie viele Abgeordnete behaupten? Und ist abgesehen von der Diskussion über Mehrheiten in einem möglichen Impeachmentverfahren (erforderlich ist eine Zweidrittelmehrheit im Kongress) geklärt, welche Verfehlungen überhaupt „impeachable“ sind? Es geht ja nicht um irgendein Amtsgerichtverfahren in Nebraska, wo Verkehrsdelikte oder Schwarzbrennerei verhandelt werden. Die politischen Vergehen, die einem Amtsenthebungsvergehen zugrunde liegen und vom Repräsentantenhaus (als Ankläger) sowie dem Senat (als Entscheidungs-Instanz) juristisch beurteilt werden, sind vielmehr Landesverrat, Behinderung der Justiz (wie schon beim Nixon-Impeachment), Meineid oder um die Zusammenarbeit mit einer gegnerischen Macht.
Und die im Verfassungs-Amendment ausdrücklich erwähnten, für ein Impeachment entscheidenden „High Crimes and Misdemeanors“ sind eben nicht „schwere kriminelle Delikte“ sondern „gravierendes Fehlverhalten hoher Amtsvertreter“. In den höheren Etagen der Politkaste hat man aber offenbar ein eher diffuses Verständnis von „impeachable offenses“. So meinte etwa Gerald Ford, 1970 noch Kongreßabgeordneter und danach US-Präsident, „impeachable“ sei, „was die Mehrheit des Kongresses dafür hält“. Und auch Nancy Pelosi, ehemalige Sprecherin des Repräsentantenhauses, schwadronierte 2017 darüber, dass ein Präsident nur des Amtes enthoben werden könnte, „wenn er gegen das Gesetz verstoßen hat“. Dabei war ein Impeachment von den Gründungsvätern ja explizit als Amtsenthebungsverfahren wegen politischen Mißbrauchs vorgesehen.
 Der Harvard-Prof Sunstein stellt klar
Der Harvard-Prof Sunstein stellt klar
„Sie haben das alles völlig falsch interpretiert und die Absichten der Verfassung zur plumpen Karikatur gemacht“, schreibt der Harvard-Professor Cass Sunstein, Verfassungsjurist und Impeachment-Spezialist, in seinem Band „Impeachment. A Citizen’s Guide“ über Ford und Pelosi. Souverän und konzise präsentiert er historische Rückblicke mit faszinierenden Präzedenzverfahren und erklärt mit großer Sympathie für die Gründer- und Verfassungs-Väter deren Absichten. Es wirkt zwar ziemlich grotesk, dass bei dieser detaillierten Erörterung vom Amtsenthebungsverfahren gegen Präsident Andrew Johnson 1868 (Impeachment wegen der Entlassung des Kriegsministers abgelehnt) bis zum Verfahren gegen den Bundesrichter Thomas Porteous Jr. 2010 in Louisiana (nach Impeachment wegen Bestechlichkeit und Falschaussagen aus dem Amt entlassen) von Donald Trump, dessen dubiose Machenschaften die Impeachment-Debatte überhaupt erst ins Rollen brachte, Donald T im Buch kein einziges Mal erwähnt wird. Sunstein geht es eben vor allem um die kristallklare juristische Lehre. Er verabscheut plumpe Polemik und möchte bei den Impeachment-Debatten Emotionen und Lagerdenken möglichst ausschalten. Denn das zögerliche Herumdrucksen der Demokraten, die erstmal über die Mehrheitsverhältnisse im Kongreß und mögliche Sympathisanten auf der Gegenseite diskutieren, bevor sie die eigentlichen Vergehen des Deal-Makers T wegen möglicher impeachable offenses prüfen, kann dem Gerechtigkeitsempfinden des ehemaligen Obama-Beraters und Clinton-Verteidigers nur zuwider sein.
Mit einer Art Quiz, das in leichte und schwere Fallbeispiele sortiert ist, stellt Sunstein Beispiele für die Prüfung zur Einleitung oder Ablehnung von Impeachment-Verfahren vor. Einer der schlechtesten bzw. meist verhassten Präsidenten war übrigens John Tyler, den Sunstein auf einer Liste der „15 worst Presidents“ auf Platz fünf stellt. Gegen ihn wurde schon 1842 wegen exzessivem Veto-Gebrauch ein Impeachment-Verfahren eingeleitet – was aber nach langen Anhörungen und Querelen abgeschmettert wurde – den Abgeordneten war Tylers Veto-Manie einfach auf den Geist gegangen; alle möglichen Korruptions-Beschuldigungen oder seine angeblichen Sympathien für revolutionäre Umtriebe waren frei erfunden.
Im brisanten Impeachment-Quiz stellt Sunstein übrigens auch die Frage, ob ein Präsident, der während seiner Amtszeit einen Mord an einem privat verhassten Bekannten in Auftrag gibt, deswegen impeachable sei – die Antwort lautet: Nein!! Weil diese Handlung eben kein politisches (!!!) Vergehen sei. Sunsteins Band liefert jedenfalls spannende historische Rückblicke; imponierend ist auch sein totales Eintauchen in diese Impeachment-Thematik und und sein Einfühlungsvermögen für die Welt der anti-royalistischen Gründerväter – vor allem für den Juristen Alexander Hamilton, der wie ein Prophet die entscheidenden juristischen und politischen Konflikte vorhersah, die auch heute noch eine große Rolle im politischen Leben und bei Impeachment-Verfahren spielen.
Omarosa: loyal, naiv und hypnotisiert vom American Dream
In Trumps TV-Show „The Apprentice“ war Omarosa Manigault Newman die erfolgreiche lernbegierige schwarze Quotenfrau; sie bildete sich daher ein, mit ihrem TV-Promi-Bonus und den Sympathien des Oligarchen Trump einen stabilen, verläßlichen Unterstützer an ihrer Seite zu haben. Ihr Insider-Bericht  „Entgleisung“ aus ihrer Zeit mit Trump im Weißen Haus ist allerdings ein absolutes Armutszeugnis für einen extrem retardierten Lernprozeß: Selbst nach Trumps peinlichen, widerlichen Skandalen, nach seinen frauenfeindlichen und rassistischen Äußerungen, Twitter-Pöbeleien und größenwahnsinnigen Alleingängen, bringt Omarosa nur weiter ihr Mantra von der Loyalität zu Papier, die ihr Herr und Meister natürlich von ihr erwarten würde. Die Frage, warum sie so lange brauchte, um ihren Job als „Kommunikationsexpertin“ für Trump (eigentlich ein groteskes Paradoxon) hinzuwerfen und sich abzunabeln vom egomanischen Popanz, beantwortet sie mit dem Hinweis auf die Realisierung des „American Dream“, an den sie immer noch glaube. Entgleist zu sein scheint ihr hier vor allem ihr Realitätsbezug.
„Entgleisung“ aus ihrer Zeit mit Trump im Weißen Haus ist allerdings ein absolutes Armutszeugnis für einen extrem retardierten Lernprozeß: Selbst nach Trumps peinlichen, widerlichen Skandalen, nach seinen frauenfeindlichen und rassistischen Äußerungen, Twitter-Pöbeleien und größenwahnsinnigen Alleingängen, bringt Omarosa nur weiter ihr Mantra von der Loyalität zu Papier, die ihr Herr und Meister natürlich von ihr erwarten würde. Die Frage, warum sie so lange brauchte, um ihren Job als „Kommunikationsexpertin“ für Trump (eigentlich ein groteskes Paradoxon) hinzuwerfen und sich abzunabeln vom egomanischen Popanz, beantwortet sie mit dem Hinweis auf die Realisierung des „American Dream“, an den sie immer noch glaube. Entgleist zu sein scheint ihr hier vor allem ihr Realitätsbezug.
Aus soziologisch-ethnographischer Sicht sind allerdings etliche Passagen bezeichnend und bestechend, die den ganz auf Profit und Selbstdarstellung gebürsteten T in typischen Posen zeigen: Vor der Amtseinführung mit dem üblichen Amtseid, der traditionell mit der Hand auf der Bibel vorgenommen wird, sollte Omarosa dem angehenden Präsidenten T mehrere historisch wertvolle Bibeln früherer Präsidenten zeigen, die T verwenden sollte. Nach langem Genörgel und Taktieren wollte Trump dann statt auf eine Bibel lieber auf seinen eigenen berühmten Klassiker „The Art oft he Deal“ schwören. Omarasa betont, sein Wunsch wäre absolut ernst gemeint gewesen. Außerdem hatte der angehende Präsident mit den goldenen Dollarzeichen in den Pupillen den genialen Einfall, die präsidiale Amtseinführung im Pay-TV übertragen zu lassen – die entsprechenden TV-Einnahmen wollte er sich dann in die eigene Tasche stecken. Trumps pathologische Fixierung auf eine teuflische Kombination von TV- Quote, Kommerz und chaotischer Konflikt-Maximierung beschreibt Omarosa drastisch und eindringlich. Und die beschriebenen alltäglichen Debakel mit einem völlig überforderten, zur längeren Konzentration unfähigen Twitter-Tölpel wirken beim Leser sicher länger nach als die Polit-Intrigen und unter unwürdigen Bedingungen umgesetzten Postenwechsel im Weißen Haus.
„Dem Präsidenten möglichst nichts Schriftliches geben“ lautete die Direktive eines Beraters, die andere lief darauf hinaus, dass man beim einstündigen Gespräch mit Trump höchstens fünf Minuten selbst zu Wort kommen würde, weil seine „Ravings“ (Wutanfälle) über Obama („ein Ausländer!“), die Clintons und seine eigenen dummdreiste Witze sich in endlosen Redundanzschleifen wiederholen würden. Nach ihrem Exitus aus dem Trump-Zirkus zieht Omarosa übrigens noch ein überzeugendes Fazit, das sie zum knackigen Psychogramm verdichtet hat:
„Wir müssen daran denken, dass Trump den Hass liebt. Er genießt Kritik und Beleidigungen. Er hat Freude an Chaos und Verwirrung. Wird er auf Twitter beschimpft, treibt ihn das nur an und versetzt seine Basis in Aufruhr. Um ihn zu entwaffnen, müssen wir sein Ego aushungern. Wir dürfen es nicht füttern“.
Dies alles ähnelt dem Verdikt des soeben entlassenen Trump-Stab-Chefs und Ex-Generals John Kelly, der froh war, endlich aus diesem „Irrenhaus“ entkommen zu sein. Aber all diese T-Marotten sind zwar inakzeptabel und abartig, aber nicht impeachable. Genauso wenig wie die von der „Washington Post“ gezählten Trump-Lügen, die bis zum 31. Oktober dieses Jahres (seit Beginn seiner Amtszeit) genau 6420 betrugen.
Offenbar hat jetzt Trumps ehemaliger Mann fürs Grobe, der Anwalt und Fixer Michael Cohen, mit den gegenüber den New Yorker Justizbehörden erläuterten Details über die heimlich gezahlten Schweigegelder an eine Porno-Queen und ein Playboy-Model für verbrachte Schäferstündchen mit Trump, einen gangbaren Weg zu einem Impeachment-Verfahren angedeutet: Da diese Gelder noch während des Wahlkampfes flossen, um die Frauen ruhig zu stellen, betrachtet die New Yorker Justiz dies als illegale Wahlkampf-Finanzierung – was wohl „impeachable“ wäre.
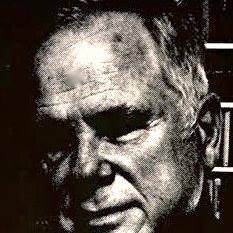
Thomas Adcock
Der CrimeMag-Kolumnist, Romanautor („Hell’s Kitchen“, „Feuer und Schwefel“, „Ertränkt alle Hunde“, „Grief Street“ u.a.) und ehemalige Polizeireporter Thomas Adcock, ein liberaler US-Demokrat, hält das Taktieren und Abwarten der Demokraten bei der Impeachment-Diskussion für völlig unangebracht. Der häufig gehörte Hinweis auf einen paralysierenden Stillstand der Amtsgeschäfte während etwaiger Impeachment-Anhörungen sei einfach grotesk: denn diese Paralyse erlebten wir inzwischen schon seit Monaten, erklärte er dem Autor in einer email :
„Fast überall diskutieren die Leute über Trump, seine Lügen, Wutanfälle, Bigotterie und kriminelle Aktivitäten – wir sind ja schon längst paralysiert, danke bestens. Was die Wähler wollen, ist endlich eine Befreiung von dieser Paralyse und vom Trump-Kult. Ähnlich wie die Impeachment-Hearings zu Richard Nixon und dem Watergate-Skandal, könnte ein Trump-Impeachment auch für einen gesunden politischen Reinigungsprozess bei den Wählern sorgen“, meint Adcock. „Dabei würde nämlich das Verantwortungsbewußtsein unserer Politkaste gestärkt. Die Hearings mit ihrer vorgegebenen Präzison des Verfahrens sind von ihrer logischen Struktur her ähnlich aufgebaut wie ein Roman, der eine komplexe story erzählt; dieses Schritt-für-Schritt-Vorgehen ist einfach zu verstehen, außerdem werden die Hearings im TV übertragen! Während der Nixon-Anhörungen wurde die Story dieses schurkischen Präsidenten und seiner Kohorten überall von faszinierten Zuschauern am TV sehr aufmerksam verfolgt. Ich bin überzeugt, dass es heute genauso oder noch stärker ausgeprägt wäre, wenn das Fernsehen Trumps Verbrechen gegen Amerika Schritt für Schritt entlarven würde. Die formalen Impeachment Anklagen könnten sich wieder – wie schon beim Nixon-Impeachment – am Ende des Verfahrens als überflüssig erweisen. Und wenn Mr. Trump überhaupt etwas respektiert, dann ist es doch die Macht des Fernsehens. TV-Hearings würden daher seinem Regime extrem schaden und ihm selbst auch. Er ist ja letztlich trotz seines Imponiergehabes ein feiger Kerl. Eine Verdammung über das Medium Fernsehen würde ihn zum schnellen Abgang zwingen. Meiner Ansicht nach könnten Impeachment-Hearings wie damals im Nixon-Verfahren innerhalb einiger Wochen abgeschlossen sein und sich danach die paralysierenden Nebel über den USA und dem Rest der Welt verflüchtigen.“
Adcocks Argumente hören sich sehr plausibel an, finde ich. Und den verängstigten Hinweis der Demokraten auf ihre ach so knappe, gerade errungene Mehrheit im Kongreß, die ein erfolgreiches Impeachment-Verfahren ohne Überläufer der Gegenseite vielleicht verhindern könnte, würde ich im Vertrauen auf den Twitter- und TV-fixierten Trump ebenfalls ignorieren. Wenn ihn nämlich der geballte TV-Furor mit einem vernichtenden Impeachment-Verdikt heimsucht, dürften ihm seine Twitter-Lügen ebenso wenig helfen wie seine üblichen völlig überdrehten Pöbeleien auf seinem Haussender Fox-TV.
Peter Münder
(Seine Texte bei CulturMag/ CrimeMag hier)
Literatur:
Angela und Willi Paul Adams (Hrsg.): Die Federalist-Artikel von Alexander Hamilton, James Madison, John Jay. Polit. Theorie und Verfassungskommentar der amerikan. Gründerväter.
UTB Wissenschaft 1788, Paderborn, München, Wien 1994
Allan J. Lichtman: The Case for Impeachment. Harper Collins Publ. London 2018
Noah Feldman und Jacob Weisberg: What are impeachable offenses? (Über die Lichtman und Sunstein Impeachment-Bände)
In: New York Review of Books, 28. Sept. 2017
Cass R. Sunstein: Impeachment. A Citizen´s Guide. Harvard University Press, Cambridge, Mass. 2017
Omarosa Manigault Newman: Entgleisung. Aus dem Amerikan. von Martin Bayer, Helmut Dierlamm, Karsten Petersen und Thomas Pfeiffer. Piper 2018
Michael Tomasky: The Worst of the Worst. (über Michael Wolffs Fire and Fury: Inside the Trump White House und David Frum: Trumpocracy: The Corruption of the American Republic) In: New York Review of Books, 22. Febr. 2018
Bob Woodward: Furcht. Trump im Weissen Haus. Rowohlt 2018
Tim Weiner: No Heroes Here. (Über Bob Woodwards Fear: Trump in the White Whouse) In: New York Review of Books. 8. November 2018
Noah Feldman: Crooked Trump? In: New York Review of Books, 24. Mai 2018
Elizabeth Drew: The Presidency in Peril. In: New York Review of Books, 22. Juni 2017












