
Omerta bei den Großfilialisten
Wenn die Buchpreisbindung nur auf dem Papier steht und das Barsortiment bedroht ist …
Die Corona-Krise hat ganz konkret noch etwas noch notwendiger werden lassen: Eine Novellierung von Paragraph 6 des Buchpreisbindungs-Gesetzes, damit offenbar völlig aus dem Ruder laufende illegale Konditionen zwischen Großverlagen und Großfilialisten endlich unter Kontrolle kommen können. Gerhard Beckmann zeigt am Beispiel der Barsortimente, warum hier der Gesetzgeber gefragt ist.
„Liebe Buchhändlerinnen, Liebe Buchhändler, wir lieben Euch. Und weil wir Euch lieben, haben wir Euch eine Art Gedicht geschrieben. Es besteht aus 4.000 Zeilen. Denn, liebe Buchhändlerinnen, liebe Buchhändlerinnen, Ihr seid eine Wucht. Wie Ihr rennt und packt und tut und macht. Ihr wart und seid der Anker unserer Branche, in einem nie dagewesenen, immer noch anhaltenden Sturm. Ihr habt Leserinnen und Lesern Gedankenfluchten, Kopfreisen, Freiheit aus Papierflügeln ermöglicht, und mit Eurem hartnäckigen Jetzt-erst-Recht Großes für Schreibende und Verlegende geleistet – schon vorher. Und jetzt auch danach, wann immer dieses Danach ist. In einem Roman wärt Ihr die Helden.“
So schreibt die prominente Roman-Autorin Nina George – Mitglied des deutschen P.E.N. Präsidiums sowie im Vorstand des Verbandes Deutscher Schriftsteller – in einem Dankesgruß, der individuell an genau viertausend Sortimenterinnen und Sortimenter in Deutschland, Österreich und der Schweiz ausgegangen ist. Daran haben sich auch noch 52 andere bekannte Autorinnen und Autoren beteiligt.

Nina George ist eine begeisterte und begeisternde literarische Aktivistin, die sich hinter den Kulissen wie in der Öffentlichkeit für die Anerkennung und die Interessen ihrer schreibenden Brüder und Schwestern engagiert. Es ist bemerkenswert, dass sie sich hier nun öffentlich auch so positiv zu der wichtigen Arbeit den Selbständigen und Angestellten des stationären Sortiments im deutschen Sprachraum bekennt. Es ist eine beispiellose Epistel des Mut-Machens an einen Beruf, der in den letzten Jahrzehnten leider (und nur zu oft ohne eigenes Verschulden) an gesellschaftlichem, kulturellem und politischen Ansehen und Rückhalt verloren hat, und allein deshalb schon außerordentlich begrüßenswert: Ich kann mich an keinen irgendwie vergleichbar uneingeschränkte, emotionsgeladene und pauschale Eloge auf den Stand des buchhändlerischen Gewerbes aus Autoren-Kreisen erinnern. Wie konnte es aber ausgerechnet jetzt zu solch einer hymnischen Dankesbekundung kommen? Nachdem der örtliche Buchhandel seine Läden von Amts wegen wochenlang vor Kunden und Lesern hatte zusperren müssen? Laut Branchenmonitor des Börsenvereins hat sich auf Grund der behördlich verfügten Zusperrungen (außer in Berlin und Sachsen) für den April im stationären Buchhandel doch ein Umsatzrückgang von 46, 9 Prozent und ein Absatzminus von 51,1 Prozent ergeben …
Clevere Werbe- und Marketing-Initiative
Man muss die Sache jedoch anders herum betrachten. Diese negative Ansatz- und Umsatzentwicklung ist zuallererst auf die Kettenläden zurückzuführen. Sie haben einerseits ihrer Größe über 800 Quadratmeter halber besonders lange dichtmachen müssen, vor allem jedoch wegen des Ausbleibens der Einkaufs- und Touristenströme in den Innenstädten die Laufkundschaft verloren, von der sie sich primär abhängig gemacht hatten. Und die oben erwähnte Video-Auktion der 53 Autorinnen und Autoren um Nina George muss ebenfalls hinterfragt werden. Bei einer großen Mehrheit der angesprochenen viertausend selbständigen Buchhandlungen wird die Geschäftstätigkeit während der Corona-Schließungen ebenfalls geruht haben. Die Video-Aktion der Autoren entpuppt sich letzten Endes als clevere Werbe- und Marketing-Initiative von Marguerite Joly, die seit September letzten Jahres als Chief Marketing und Digital Officer der Holtzbrinck-Verlage fungiert und dafür Autoren der Verlagsgruppen Droemer Knaur, S.Fischer, Kiepenheuer & Witsch und Rowohlt einzuspannen wusste. Haben die 4.000 genannten Buchhandlungen wirklich jede für sich und alle miteinander „mit ungeheurem Einsatz und (mit) Kreativität dafür gesorgt, dass gute Geschichten weiterhin ihre LeserInnen finden“, wie Marguerite Joly schreibt. Haben wirklich 4.000 Buchhandlungen, also die Mehrzahl der unabhängigen Sortimente, „exemplarisch unter Beweis gestellt, was in einer Krise geschehen muss: Solidarität, verantwortliches Handeln und höchste Flexibiität“? Schön wär’s…

Ja, es gibt sie, die SortimenterInnen und Sortimenter von echtem Schrot und Korn, und es sind ihrer bei uns auch heute noch viel mehr als gemeinhin angenommen wird – oft in mittleren und sogar kleinen Städten, wo man sie vielleicht nie vermutet, und sie wirtschaften gar nicht selten sogar erfolgreicher, rentabler und zukunftsträchtiger als Topmanager von Thalia, Osiander, der Mayer‘schen oder Hugendubel, wenngleich sie kaum einer kennt oder nennt, weil sie klein und lokal sind. Und sie haben auf bewundernswert kreative Weise täglich bis zum Umfallen für Autoren und Bücher, für ihre Kunden und Leser gerackert und sind für eine dringliche Versorgung der Bevölkerung mit Büchern eingesprungen, als Amazon, der größte “Buchhändler“ im Lande, wegen krisengewinnlerisch höherer Absatz- und Renditechancen mit Allerwelts-Konsumgütern seinen Verkauf von Büchern weitgehend einstellte. Ihnen gebührt unser aller Dank, ihnen gebührt politische Unterstützung, insbesondere aber wahre, tätige Solidarität von Seiten der großen Verlage und Konzerne, die leider nur von „Solidarität“ salbadern, wenn’s für sie eben (kostenlos) opportun ist. Denn sie sind jeder am eigenen Ort kommunal und kulturell unersetzlich.
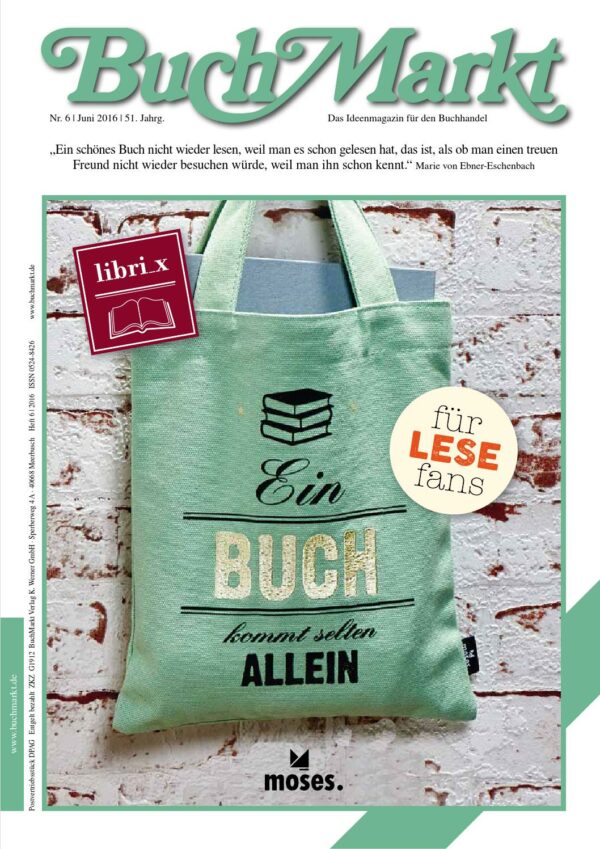
Sie sind jedoch, bei allem Respekt, allzu oft auch – es ist sozusagen die Kehrseite dieser ihrer besonderen Bodenhaftung und Stärke – in einer Art von Kantönli-Denken befangen. Weil sich jeder gern wie ein Kaiser von China vorkommt, kommen sie mit notwendigen Ko-Operationen untereinander selten zu Potte. Für sich allein wären sie angesichts der gewaltigen neuen Herausforderungen kaum über ihren Tellerrand hinausgekommen, hätten sie auch die Umstände der Corona-Krise kaum überstanden. Der Dank, den Autoren und Verlage ihnen spenden, greift also zu kurz. Denn „der Anker unserer Branche“ ist eine Institution, ohne welche die wunderbaren Leistungen unserer großartigen Sortimenterinnen und Sortimenter für Autoren, Verlage und Leser gerade in der Corona-Krise insgesamt gar nicht möglich gewesen wären. Es ist das Barsortiment, das einen Grundstein der Qualitäten und Stärken des deutschen Buchmarkts bildet, wie er in der Welt einmalig ist und sich jetzt von neuem bewährt hat.

Der Öffentlichkeit ist es nicht bewusst. Und abgesehen von Vertriebsleuten habe ich auch im Umkreis der Verlage kaum einen getroffen, der um das Ausmaß wusste, mit dem die drei führenden Zwischenbuchhandelsfirmen Libri, KNV-Zeitfracht und Umbreit eine weitgehende Funktionstüchtigkeit vieler Buchhandlungen trotz der behördlichen Ladenschließungen ermöglicht haben. Ihren Zwischenlagern und ihrem Über-Nacht-Lieferservice ist eh zuzuschreiben, dass unsere Buchhandlungen den größten Teil der lieferbaren Verlagstitel über Nacht für ihre Kunden auf Bestellung parat haben können. Vor einigen Jahren haben sie obendrein als Novum eingeführt, dass sie Online- und Versandbestellungen auch direkt an die „Endkunden“ von rund 1.400 Buchhandlungen liefern, die auf diese Weise trotz Ladenschließung ihrer wesentlichen Aufgabe einer Versorgung der Bevölkerung mit dem Kulturgut Buch in hohem Maße nachzukommen vermochten – was nun übrigens auch erklärt, warum es, wie eingangs berichtet, im April nicht zu noch größeren Absatz- und Umsatzrückgängen des stationären Buchhandels kam. Anders gesagt: Die Barsortimente haben sich als entscheidender Modernisierungsfaktor unseres örtlichen Buchhandels erwiesen, so dass er sich gegen die Konkurrenz des internationalen Online-Giganten Amazon behaupten kann.

Die Umstände der Corona-Krise lassen freilich auch erneut deutlich werden, wie gefährdet die Existenz dieser besonderen deutschen Institution des Barsortiments ist. Die Ursache ist – ironischerweise – in einer anderen besonderen deutschen Institution zu suchen: in der gesetzlichen Buchpreisbindung bzw. einem Missbrauch selbiger durch die großen Konzernverlage und Buchkettenhandelsfirmen. Sie legt nämlich nicht nur fest, dass es überall einen fixen Ladenpreis für Bücher zu geben hat. Sie bestimmt unter anderem ebenfalls, dass die Verlage unter gar keinen Umständen irgend einem noch so großen Bucheinzelhandelsunternehmen Konditionen einräumen dürfen, die besser und günstiger sind als die fürs Barsortiment. Für die Durchführung und Einhaltung des Gesetzes ist die Buchbranche selbst zuständig. (Überschreitungen und Verletzungen erfüllen somit keinen strafrechtlichen Tatbestand, der vor Gericht gebracht werden könnte.) Diese Aufgabe obliegt den Preisbindungs-Treuhändern des Börsenvereins – aber nur, wenn ein Händler gegenüber Kunden, sozusagen nach außen hin, den festen Ladenpreis missachtet.
Hinsichtlich der Konditionen zwischen Verlagen und Händlern im Sinne von Paragraph 6 BuchPrG verfügen die Treuhänder über keine Vollmacht zu Kontrollen und Ahndungen in Fällen von illegalem Verhalten. Denn das Recht auf Bucheinsicht wird ihnen im Gesetz nicht gewährt – vermutlich in Folge einer Lobbytätigkeit der Konzerne beim Gesetzgeber. Hier herrscht nun eine Art von Omerta, wie sie für gewöhnlich nur mit der Mafia in Verbindung gebracht wird. Wenn verschwiegen bleibt, wovon gemunkelt wird, streichen manche Großfilialisten möglicherweise bis zu zehn oder mehr Prozent über der Höhe der eigentlich statthaften Konditionen ein – mit Kollateralschäden, welche die Existenz und die für alle so notwendige wie aufwändige Arbeit der Barsortimente aufs Spiel setzen und den Verlagen selbst schaden, weil sie den Konditionsrahmen zu ihrem eigenen Schaden überziehen.
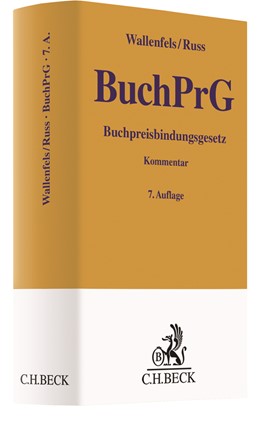
Für die Insolvenz des Unternehmens Koch Neff Oettinger im vergangenen Jahr war zuletzt auch dieses Problem maßgeblich. Und wie Abbé Galiani in der Mai-Ausgabe von BuchMarkt anführte, haben „einige marktmächtige (also für die Branche ‚systemrelevante‘) Marktteilnehmer, die ohnehin bereits besondere Bezugskonditionen genießen, diese nochmals gegenüber den Verlagen und Auslieferungen ‚verbessert‘, insbesondere bezgl. Valuten, Zahlungszielen und Skontofristen. In zumindest einem Falle, wie man hört, verbunden mit dem argumentativen Druck, ‚sonst müssen wir halt sehr viel remittieren‘.“ Auch das ist eine Folge-Erscheinung des Corona- Virus. Es scheint allerhöchste Zeit für eine Novellierung von § 6 des Buchpreisbindungsgesetzes, welche den Treuhändern eine Einsicht in die Bücher der großen Verlage und Filialketten gestattet, damit sie auch hier für legale Verhältnisse sorgen können – zum Erhalt des für die ganze Branche und für unser Land segensreichen Buchpreisbindungsgesetzes.
Gerhard Beckmann
Sein Wutschrei gegen Amazon hier, seine Texte bei uns hier.











