
Warum die Mega-Fusion von Thalia & Mayer‘sche & Ossiander so gefährlich ist
Eine Brandrede von Gerhard Beckmann
Die neue Vorsteherin und der neue Vorstand des Börsenvereins haben in der letzten Novemberwoche 2020 einen überraschenden, einstimmigen Beschluss gefasst, der dem deutschen Buchhandel neue Hoffnung gibt und von größter Bedeutung für Autoren, LeserInnen und Verlagsleute werden könnte. Es geht um eine Neufassung des Buchpreisbindungs-Gesetzes. Warum sie so wichtig ist, wird vom Hintergrund einer skandalösen Geschichte dieses Jahres deutlich, die hier erstmals offen ausgebreitet wird. Ein Appell an die deutsche Öffentlichkeit, den Börsenverein hier aktiv zu unterstützen – denn für den Erfolg seiner Initiative braucht er die Politik.
Dass Thalia und die Mayer‘sche zum Mega-Großfilialisten mit 1,2 Milliarden Euro Umsatz fusionieren wollten, war die Schrecksensation des Jahres 2019. Eine derartige Konzentration im deutschen Buchhandel war bis dahin unvorstellbar. Sie bedurfte natürlich der Zustimmung des Bundeskartellamtes. Die Großfilial-Eigentümer schienen jedoch überzeugt, sie gewinnen zu können. Sie haben sie dann tatsächlich auch bekommen.
Kaum mehr als ein Jahr später, am 22. Oktober 2020, hat die Thaila Mayersche das ganze Buchgewerbe schon wieder in Angst und Schrecken versetzt. Sie hat einen neuerlichen Konzentrationsakt bekannt gegeben, mit einer Art und Weise, welche die Buchbranche umkrempeln wird. Und dem Antrag auf behördliche Genehmigung hat das Bundeskartellamt auch diesmal wieder zugestimmt. Das geschah mit Methoden und Argumenten, die im Sinne allgemein geltender Regeln von Recht und Sachverstand kaum vertretbar sind.
Die Zustimmung erfolgte – statt wie erwartet im Frühjahr 2021 – im Eiltempo, binnen vier Wochen. Sie wurde allein auf der Grundlage von Angaben der Antragsteller erteilt – ohne Anhörung anderer Branchenmitglieder und -sparten, die von diesem spektakulärem neuartigen Expansionsmanöver des Primus unter den Großfilialisten direkt oder mittelbar betroffen sind. Das ist ein dicker Hund – umso mehr, als solches Eilverfahren den übrigen Marktteilnehmern nicht einmal die Zeit und die Möglichkeit zum Erarbeiten einer schlüssig durchdachten Gegenposition und zum Anstoßen einer öffentlichen Debatte ließ, in der alle fraglichen Aspekte offen zur Sprache und ausdiskutiert hätten werden können – was notwendig gewesen wäre. Denn die Sache betrifft gesamtgesellschaftliche, kulturelle und politische Kernelemente. Sie berührt Grund- und Orientierungsfragen unseres demokratischen Lebens.
Der Entscheid des Bundeskartellamts ist zwar amtlich, jedoch nach der Art seines Zustandekommens inakzeptabel
Die Vorgehensweise des Bundeskartellamts ist ein Skandalon. Sie ist ein Indiz sondergleichen für die Gefahr bedrohlicher Umwälzungen, die in Deutschland von Behörden ausgehen bzw. besiegelt werden können. Es ist symptomatisch für ein Kopf-in-den-Sand-Stecken vor ökonomischen und sozialen Entwicklungen und Realitäten, Konsequenz auch eines behördlichen Sich-Abschottens gegenüber neuen, fundamentalen wirtschafts-, sozial- und kulturwissenschaftlichen Erkenntnissen und Perspektiven.
Es kann Lawinen auslösen, wenn eine systemisch der Wirklichkeit entfremdete Kontrollbehörde in Problemfällen, die ein Großteil der Bevölkerung und künftige Generationen substantiell angehen, anstehende Entscheidungen im Blindgang trifft. Die Behörde wird sich gegen solche Kritik gewiss zur Wehr setzen und mit dem Hinweis rechtfertigen, rechtskonform gehandelt und nur ihrer Amtspflicht genügt zu haben. Sie wird entgegnen, dass sie Regularien einzuhalten habe, die für alle Handelsmärkte und Wirtschaftsbereiche gleichermaßen anzuwenden seien – und davon könne natürlich auch der Buchmarkt nicht ausgenommen werden.
Es ist ein Argument, das auf den ersten Blick stichhaltig wirkt – an und für sich. Aber nur solange der Blick am Tellerrand der Binnenlogik einer Institution endet. Ansonsten könnte man versucht sein, auf böse Gedanken zu kommen und den Kartell-Beamten vorzuhalten, sie seien – so ein ganz aufgebracht polternder bayerischer Urliberaler – in einem “Alt-Papierparagrahen-Obrigkeitsdunst-Denken“ befangen.

Die Sache macht auch aus einer anderen Perspektive einen befremdlichen Eindruck. Wegen des überstürzten Prozedere, das einfach Verdacht erregen muss. Denn es hat die meisten selbstständigen Sortimenter, die ganze Sparte der Barsortimenten und die großen, mittleren und kleinen unabhängigen Verlage einfach überrollt, die massive Einwände gegen die beträchtliche Veränderung des Buchmarkts durch die neuerliche Expansion des Thalia-Mayerschen-Konzerns mit der Osiander-Vertriebs-Gesellschaft geltend zu machen und vorzutragen gehabt hätten und haben. Sie sind von dem Schnellurteil kalt erwischt und ausmanövriert worden. Das Bundeskartellamt hat somit eine krassen Form der Diskriminierung zu verantworten. Ihr Vorgehen kann de facto nur als bewusste Parteinahme für die neuartige Variante der Expansions- und Konzentrations- Strategie des Großfilialisten-Primus mit dem viertgrößten deutschen Buchketten-Unternehmen gewertet werden.
Fairness gegenüber dem Amt, ja: Doch wer oder was könnte seinen bedenklichem Schritt veranlasst haben?
Könnte es aber vielleicht unfair sein, die Beamten des Bundeskartellamts böser Absichten zu verdächtigen? Wäre es nicht denkbar, dass sie von den vorgebrachten Argumenten des Aufgebots für diese Elefantentenhochzeit überzeugt und der Dringlichkeit ihres Vollzugs mit Nachdruck bewusst gemacht worden sind? Es sei nicht vergessen: Die Sache wurde in Corona-Zeiten durchgepaukt, in einem Moment, als der seit Jahren beklagte zunehmende Rückgang der Geschäfte mit Büchern dank der Lockdowns, Shutdowns bzw. Verordnungen von Kontakt-und Bewegungseinschränkungen in den Innenstädten auf Hochtouren kam, als die rettenden hohen Weihnachtsumsätze des Einzelhandels weitgehend auszufallen drohten und angesichts eines möglicherweise längeren Ausbleibens von Kundenströmen die Zukunftsaussichten mau schienen – weil befürchtet wird, dass ganze Käuferschichten dauerhaft in Richtung Online-Großversender – vulgo, zu Amazon – entschwinden könnten.
Wer einmal persönlich miterlebt hat, mit welch schier übernatürlichen Fähigkeiten an blendenden Denk-und Dia-Projektionen Anteilseigner und Manager von Großunternehmen aufzuwarten vermögen, wenn sie mit dem Rücken an der bröckelnden Wand stehen, mag ahnen, wie die Damen und Herren des Kartellamts da möglicherweise in die Pflicht genommen wurden.
Es wäre keineswegs unwahrscheinlich, dass sie von den Argumenten der Vertreter aus Hagen und Tübingen überzeugt wurden und aus Überzeugung handelten, als sie sich mit den Großfilialisten identifizierten. Da erhebt sich dann freilich die große Frage: Sind diese Argumente, soweit bekannt, wirklich hieb- und stichfest?
„Ziel der neuen dauerhaften Partnerschaft ist es, die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Buchhändler gegenüber multinationalen Konzernen zu stärken“
So heißt es in der offiziellen Begründung des Konzerns. Eine geniale Begründung. Sie suggeriert: Es geht eigentlich, letztlich gar nicht um Eigeninteressen der Großfilialisten, die den Antrag beim Kartellamt stellten. Es geht vielmehr ums Ganze, um gemeinnützige Interessen, um eine nationale Aufgabe: um die Existenz des deutschen Buchhandels überhaupt. Ihr Fortbestand ist angeblich durch ihm wettbewerbsmäßig bevorteilte ausländische Megakonzerne gefährdet. Eine ebenso clevere Behauptung.
Sie tönt schon fast wie eine Verschwörungstheorie. So etwas wie einen Trupp von „multinationalen Konzernen“, der in bedrohlichem Konkurrenzkampf mit den deutschen Buchhändlern stünde und ihnen den Boden unter den Füßen wegziehen könnte, gibt es nämlich gar nicht. Die Formulierung ist die Hochstilisierung eines einzigen ausländischen Schreckgespensts: des Online-Giganten Amazon aus Seattle in den USA. (Er ist, nur nebenbei bemerkt, keineswegs unproblematisch, aber nicht in einem für den deutschen Buchhandel spezifischen Sinn, sondern wegen seiner auf Hochrenditen fixierten ausbeuterischen internationalen Steuer-Schiebereien und -tricks ein Problem, das jedoch EU-politisch zu lösen wäre. )
Amazon aber wäre im jetzigen Kontext am ehesten als Popanz richtig benannt. Der Konzern wird für eine Causa instrumentalisiert, mit der er eigentlich wenig oder nichts zu tun hat. Beginnen wir ganz konkret mit der schon erwähnten These, die aus dem Zusammengehen der Thalia-Mayerschen mit Osiander resultierende Konzentration erhöhe die Wettbewerbsfähigkeit deutscher Buchhandlungen gegenüber dem multinationalen Online-Handelskonzern. Sie ist offenbar pure Erfindung. Holger Ehling – einer unserer bestvernetzten international tätigen Buchhandels-, Kommunikations- und Medienexperten – hat auch in seinen Leitartikeln für das unabhängige Branchenmagazin BuchMarkt mehrfach berichtet, „das Amazon überall dort, wo starke nationale Konkurrenz besteht, bei weitem nicht so gigantisch daherkommt, wie man ob des Rufs des Unternehmens denken könnte“. So ist eben im Buchgeschäft der Bundesrepublik – verglichen etwa mit den USA und mit Großbritannien und ihren erheblich schwächeren stationären Sortimenten – Amazons Marktposition schwach, aus einem schlichten Grund, den ich im BuchMarkt-Juliheft 2020 ausgeführt habe: Der stationäre deutsche Buchhandel hat weltweit die größte Vielfalt und Stabilität. Zur Erhaltung und Förderung seiner Position gegenüber Amazon wäre also gerade eine kartellamtliche Ablehnung des Thalia-Antrags das Richtige gewesen.
Wenn die Großfilialisten aus Hagen und Tübingen gegenüber dem Kartellamt behauptet haben sollten, ein Vormarsch des amerikanischen Online-Giganten Amazon im deutschen Buchmarkt sei nur mit einer weiteren Konzentration des stationären Bereichs durch heimische Unternehmerfamilien zu stoppen, müssten sie augenscheinlich unhaltbare Aussagen gemacht haben.
Es gibt weitere gewichtige Argumente dagegen. Ein bedeutender österreichischer Ökonom an der eidgenössischen Hochschule St. Gallen hat eines grundsätzlich formuliert – dass nämlich „Größe (an an sich) kein (ausreichendes) Konzept“ bedeutet. Dr. Marcus Disselkamp – nach dem Studium der Wirtschaftswissenschaften in Fribourg und Oxford in Führungspositionen bei internationalen Handelsgesellschaften, heute ein führender Digital- und Transformationsökonom – hat es bereits nach der Fusion von Thalia mit der Mayerschen (2019) in einem Gemeinschaftsbeitrag für BuchMarkt folgendermaßen konkretisiert: „Die Buchbranche scheint in einer fast krankhaft wirkenden Manier auf Amazon fixiert. Es wird Zeit, dass sie sich davon freimacht. Dazu gehört nach unserem Befinden auch die Vorstellung, dass deutsche Familien als Eigentümer und eine neuartige, marktbeherrschende Größe Garantien sein könnten dafür, dass Thalia Amazon Paroli bieten kann und die Zukunft des stationären Buchhandels sichern könnte – ganz als ob unabhängige Buchhandlungen sich nur gegen die Macht von Amazon zu behaupten vermöchten, wenn sie dem Lockruf von Thalia folgen und unter das Dach dieses Großfilialisten schlüpfen würden. Dabei gäbe es Anlass zu diskutieren, ob nicht gerade die Weiterführung der bisherigen „großfilialen“ Praxis (ohne eine grundlegende Re-Orientierung) die Existenzfähigkeit des deutschen Buchhandels beschädigen würde – ohne dass sich dafür Amazon der Schwarze Peter zuschieben ließe.“
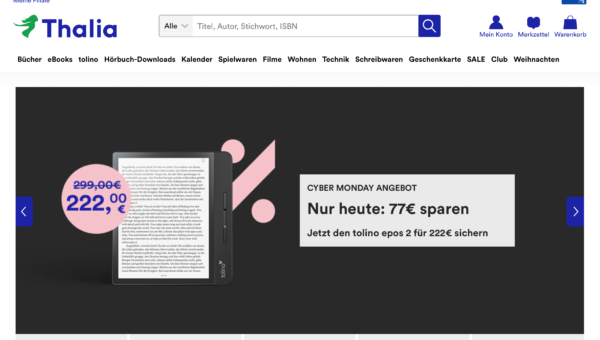
Diese Warnung hat inzwischen noch mehr Berechtigung. Es ist unbegreiflich, wie das Kartellamt den neuen Konzentrationsvorgang als Einzelfall behandeln und anschließend erklären konnte, auch weitere Anträge jeweils „von Fall zu Fall“ prüfen zu wollen. Denn inzwischen ist die Thalia-Strategie klar vernehmlich dargelegt worden. Die Form des Zusammengehens mit Osiander hat Modellcharakter. Und das hätte dem Kartellamt eigentlich schon im August 2019 bewusst werden müssen, als der Thalia-CEO Michael Busch nach der Fusion mit der Mayerschen bekanntgab: „Wir wollen weiterhin kleinere Buchhandlungen und regionale Filialisten überzeugen, auf die Branchen-Plattform von Thalia zu kommen.“ Thalia – als Plattform der Branche? Und man erinnert sich heute hier und da an den Ausspruch des Filial-Gründers Henning Kreke (Douglas), der die Vision hatte, Thalia zum „Dachunternehmen“ des stationären Buchhandels in Deutschland auszubauen – d. h. eine Art von Monopol gegenüber den Verlagen anzustreben.
Was charakterisiert das neue Modell dieses Verbunds?
Osiander behält für die Filial-Läden rechtlich seine Selbständigkeit und tritt – mit Eigenverantwortung für das Personal, für Marketing und Werbung sowie eine traditionsbezogenes Sortimentsnische – nach außen weiterhin als unabhängiges Buchhandelsunternehmen auf. Aber, so hat der Co-Geschäftsführer Heinrich Riethmüller erklärt, „wir stützen uns auf die Sortimentsauswahl von Thalia“. Und: „Die Abwicklung unseres gesamten Warenflusses erfolgt über die Thalia-Plattform.“ Über die Osiander-Vertriebs-Gesellschaft, an welcher Thalia die Mehrheit der Anteile hält, gewinnt der Tübinger Filialist Zugang zur gesamten logistischen und betriebswirtschaftlichem Infrastruktur des Hauptkonzerns. Ist das nun ein Joint Venture? Oder doch eher eine Tochtergesellschaft? Wie auch immer man diese Osiander-Vertriebs- Gesellschaft bezeichnen mag: Sie vermehrt und zementiert – über die zentrale Programmauswahl, den Zentraleinkauf und das Zentrallager – die Markt-Macht, die Macht- und Verhandlungsposition des Hagener Konzerns gegenüber den Verlagen. So gewinnt Thalia noch mehr an Größe – eine Größe, die Thalia bei neuerlichen Rabatt- und Konditions-Verhandlungen mit Verlagen als Warenabnehmer sozusagen „alternativlos“ machen wird. Doch schon die aktuell von Thalia geforderten bzw. erhaltenen Rabatte und Sonderkonditionen haben ein so hohes Niveau erreicht, dass es selbst für die großen Konzernverlage kaum mehr finanzierbar sein dürfte. Und die Barsortimente, an deren Funktionen und Leistungen das gesamte – weltweit einmalige – deutsche Buchhandelssystem hängt, müssen angesichts weiterer Thalia-Übergriffe ums Überleben bangen. Gerade ihre Funktion, ihre herausragenden Innovationsleistungen, ihre besondere Nähe zum Sortiment, ihre Arbeit garantiert dem deutschen Buchhandel, dass er es im Dienst am Kunden mit Amazon aufnehmen kann. Kein Wunder, dass die Branche auf das alles schockiert reagierte. Kein Wunder, dass die Zustimmung des Kartellamts zu diesem Deal auf totales Unverständnis stösst.
Das Kartellamt aber hat auf den Schrecken der Branche mit Kopfschütteln und Unverständnis reagiert. Für einen fairen Wettbewerb mit- und untereinander hätten sie doch, hat es empörten Verlegern, unabhängigen Buchhändlern und Barsortimentern bedeutet, die gesetzliche Buchpreisbindung, so dass für alle neuen Bücher überall ein und derselbe gleiche Ladenpreis verpflichtend ist.
Daraufhin ist eine in der Branche seit langem angestaute Wut außer Rand und Band geraten. Den Hintergrund bildet eine Skandalgeschichte, die so unglaublich ist, dass sie hier endlich im Detail erzählt werden muss, zumal sie öffentlich kaum bekannt scheint. An der Lösung der Probleme, welche diese Geschichte aufwirft, hängt die Zukunft des deutschen Buchhandels, der deutschen Verlage, Autoren, Übersetzer und der Lesekultur des deutschen Publikums.
Ja, es gibt die Buchpreisbindung, sie funktioniert, sie ist ein zentrales Element des deutschen Buchmarkts mit seiner hohen Qualität. Und sie funktioniert in dem vom Kartellamt umrissenen Rahmen. Die für den Börsenverein des Deutschen Buchhandels tätigen Treuhänder der gesetzlichen Buchpreisbindung, die Rechtsanwälte Dieter Wallenfels und Professor Dr. Christian Russ stellen sicher, dass für neue Bücher tatsächlich überall der gleiche Ladenpreis gilt, damit im Handel fairer Wettbewerb herrscht.
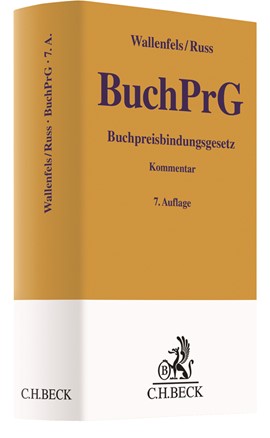
Das stellt aber nur eine Seite der Medaille dar, die äußere Seite, die das Publikum sieht. Die zweite Seite der Medaille ist jedoch genau so wichtig. Sie regelt die Geschäfte, die Preise, Rabatte und Handelskonditionen, die Abgabe- und Einkaufspreise zwischen Verlagen und Händlern, damit auch im Binnenverkehr der Branche gleiche Regeln für alle gegeben sind, damit zwischen den Marktteilnehmern ein fairer Wettbewerb herrscht. Dazu legt das Buchpreisbindungsgesetz fest, dass Verlage für ihre Titel keinen Einzelhändlern höhere Rabatte und allgemeine geldwerte Konditionen einräumen darf als den Barsortimenten, die flächendeckend für eine schnelle Belieferung aller Sortimente sorgen. (Neuerdings, auf Bestellung des Buchhandels, sogar bis hin zu Endkunden – eine beträchtliche Zusatzleistung, welche die Buchhändler in der prompten Kundenbedienung mit Amazon gleichstellt.) Um ihre Serviceleistungen erbringen und finanzieren zu können, wurde ihnen ein fester Rabatt von fünfzig Prozent vom Ladenpreis garantiert. (Sie verkaufen die Titel für etwa 35 Prozent an die Einzelhändler weiter.)
Bei diesem zweiten zentralen Moment der Buchpreisbindung aber gibt es Schwierigkeiten. Normalerweise ist es so, dass eine Nichteinhaltung von gesetzlichen Bestimmungen auch gesetzlich geahndet werden kann, damit das Gesetz notfalls gerichtlich durchgesetzt wird. So ist das auch bei der Buchpreisbindung in Österreich. In Deutschland dagegen ist diese Möglichkeit bislang nichtgegeben. Sie war m.W. zwar ursprünglich vorgesehen, ist schließlich aber aus der Gesetzesvorlage entfernt worden, vermutlich auf Grund von Einflussnahmen durch Lobbyisten – etwa von Groß- oder Konzernverlagen, die sich in (oft gnadenlosen) Verdrängungskämpfen nicht einschränken lassen wollten, oder von Großbuchhandlungen, das scheint heute niemand mehr genau zu wissen. Die Aufgabe zur Durchsetzung der entsprechenden Klauseln des Gesetzes wurde dem Branchenverband und damit den beiden oben erwähnten Treuhändern anvertraut – ohne dass ihnen dazu notwendigen Mittel zur Verfügung gestellt worden wären. Im Unterschied zu ihrem österreichischen Kollegen, der immer wieder mit Erfolg vor Gericht gegangen ist, wenn beispielsweise ein findiger Großfilialist auf komische Ideen kommt, die nicht gesetzeskonform sind, können Herr Wallenfels und Professor Dr. Christian Russ in fraglichen Fällen nicht gegen verdächtige Unternehmen vorgehen – und sie beispielsweise auch nicht gerichtlich zur Offenlegung geheimer, rechtswidriger Absprachen zwingen lassen.
Diese Notlage dürfte dem Kartellamt wohl bekannt sein. Insofern ist der Verweis gegenüber Kritikern seines jüngsten Thalia-Entscheids nicht sehr angebracht gewesen. Obendrein hat er ein Gerüchle. Denn es ist leider so, dass Thalia – wie Amazon auch – keine Auskunft zu geben bereit ist, wenn ein Verdacht auf illegal hohe Forderungen und Einstreichungen von unrechtmäßig hohen Einkaufsrabatten und – Konditionen aufkommt. Sie berufen sich auf die ihnen angeblich zustehende Wahrung von Geschäftsgeheimnissen – so wie es auch Großverlage tun, die – wahrscheinlich – dergleichen überhöhte Konditionen einräumen. Damit nicht genug: Es gibt Aussagen von Insider-Informanten, denen zufolge Thalia eine Unterschrift verlangt, in denen Verlage sich zu verpflichten, solche unrechtmäßigen Konditionen nach außen hin zu verschweigen. Und es gibt m.W. kein Haus, dass diese Zusage gebrochen hat – aus Angst, wie hier und da zugegeben wurde, dass Thalia sonst mit einem Abbruch von Einkäufen oder Geschäftsbeziehungen droht.

In diesen Dingen schweigt jeder beharrlich für sich. Man wagt nicht, mit anderen darüber zu diskutieren, um möglicherweise gemeinsam oder gar öffentlich dagegen anzugehen. Mehr noch, und hier wird es grotesk: Man glaube, haben mir etliche Verleger zu verstehen gegeben, es auch nicht tun zu dürfen, sonst habe man das Gesetz gegen sich; dergleichen Diskussionen seien als Absprachen zu werten: als Kartellabsprachen, die gegen Kartellrecht verstießen. Sind das nur Vorwände, um das Schweigen zu rechtfertigen? Müsste es nicht eine Debatte darüber geben, ob es denn sein kann, dass ein Unternehmen sich auf eine privatwirtschaftliche Unterschrift für eine abgeforderte Verpflichtung beruft, welche die Verletzung einer rechtlich vorrangigen, weil gesetzlichen Vorschrift durch Schweigen sanktioniert? Und hätte dazu auch das Kartellamt etwas zu sagen?
Manchmal konnte – oder musste – der Eindruck entstehen, dass diese Verschwiegenheit sogar dazu führte, dass selbst hochrangige Vertreter des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels keine genauere, konkrete Vorstellung von solchen Verhältnissen gehabt haben. In diesem Jahr scheint dort freilich doch Einiges in Bewegung gekommen zu sein. Es wird von einer Initiative gesprochen, die in der Politik für eine Novellierung des Buchpreisbindungsgesetzes anregen soll – damit die Treuhänder endlich eine gesetzliche Handhabe zur Durchsetzung der Bestimmungen bekommen.
Dagegen hat es in den Gremien des Börsenvereins offenbar auch Widerstände gegeben – angeblich unter den Verlegern von Seiten des einen oder anderen Konzerns, vor allem jedoch, wie ich mehrfach gehört habe, im Sortimenterausschuss, was kaum zu glauben wäre. Oder sollten dort, wie auch schon erzählt wurde, inzwischen Großfilialisten zu einflussreich geworden sein? Könnte es gar so sein, wie Informanten berichtet haben, dass Thalia mit Drohungen versucht haben soll, weitere Bemühungen zur Novellierung des Buchpreisbindungsgesetzes zu verhindern? Sie ist dringend notwendig. Denn die Buchpreisbindung ist essenziell wichtig, darum muss offensichtlichen Missbräuchen ein Ende bereitet, der unabhängige deutsche Buchhandel, der in diesen Corona-Zeiten wieder einmal seine volle Bedeutung unter Beweis gestellt hat, mit verbesserten Konditionen finanziell und branchenstrukturell gestärkt werden, und die Ausrichtung der Großfilialisten zu einer aktiv kunden- und leserbezogenen buchhändlerischen Orientierung zurückfinden, wie sie in Großbritannien der Sortimenter James Daunt bei Waterstones bereits mit Erfolg durchgeführt hat und jetzt in den USA bei Barnes & Noble weiterführt.
In der vergangenen Woche (16-22.11.) ist es zu einer Überraschung gekommen. Das oberste Gremium des Börsenvereins hat einen wichtigen ersten Schritt in die richtige Richtung getan. Die neue Vorsteherin, Karin Schmidt-Fridrichs, und der neue Vorstand haben den einstimmigen Beschluss gefasst, eine Task Force mit der Vorbereitung der nächsten Schritte und zur Weiterführung der politischen Gespräche zu der Gesetzesnovellierung zu beauftragen. Buchhändler und Verlage sollten ihre politischen Kontakte nutzen, um diese Initiative des Börsenvereins so breit wie möglich zu unterstützen.
Gerhard Beckmann
Siehe auch: Gerhard Beckmann: Starke Argumente für die Buchpreisbindung. Fakten zur großen Wirksamkeit von Buchhandlungen vor Ort. Gerhard Beckmann zu einer wichtigen Innsbrucker Pilotstudie – CulturMag August 2020.
Sein Wutschrei gegen Amazon hier, seine Texte bei uns hier. Gerhard Beckmann, den wir als regelmäßigen Mitarbeiter von CulturMag mit Freude an Bord haben, ist eine der profiliertesten Menschen der deutschen Verlagsszene. Seine Kolumne „Beckmanns Große Bücher“ im Buchmarkt stellt kontinuierlich wirklich wichtige Bücher mit großer Resonanz vor.
Nachtrag zum Artikel:
Ein Stein ist ins Rollen gebracht: Am 3. 12. weist das Fachinformationsmedium „Langendorfs Dienst“ auf Gerhard Beckmanns Offenen Brief und verlinkt. In der Ankündigung wird ausgeprochen, dass „zuletzt Kein & Aber-Verleger Peter Haag öffentlich gemacht hat, dass Thalia mit Forderungen von bis zu 60 Prozent an ihn herangetreten sei (wir berichteten)“ und dass nun die neue Initiative des Börsenvereins für eine Novelle des Buchpreisbindungsgesetzes neue Nahrung erhalte.

Und am Wochenende 12./13. Dezember 2020 greift „Die literarische Welt“ das Thema auf, indem sie Gerhard Beckmann dazu interviewt, dies in der Wochendausgabe wie auch online:












