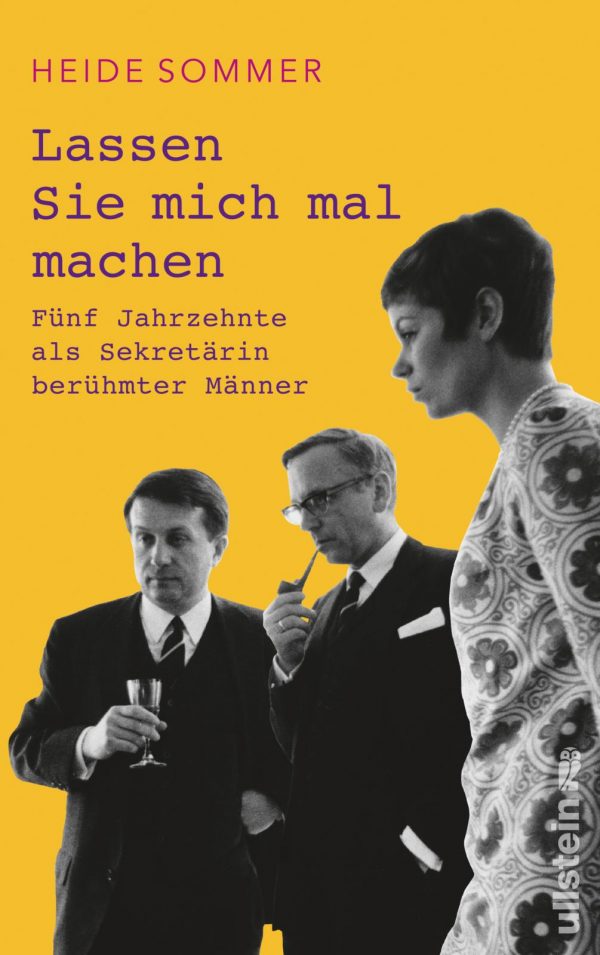
„Ich hatte meine Redakteure fest im Griff“
Heide Sommer arbeitete im Verlauf von fünf Jahrzehnten als Sekretärin für Edelfedern wie Theo Sommer, Joachim Fest, Günter Gaus, Rudolf Augstein, Fritz J. Raddatz sowie für den Dramatiker Carl Zuckmayer, Ex-Kanzler Helmut Schmidt und den Hamburger Opern-Generalmusikdirektor Hans Zender. Sie war nicht nur Stenographin und Tippse, sondern auch erfinderische Organisatorin. Ihr Rückblick „Lassen Sie mich mal machen“ erfasst eine Epoche ohne PC, Smartphone und Fax. Er ist mit kulturkritischen Exkursen garniert und gerät so auch zum spannenden Dokument der Zeitgeschichte. – Von Peter Münder.
Die Telefonverbindung zum „Zeit“-Korrespondenten Hansjakob Stehle nach Warschau musste sie in den 1960er Jahren mit einem Tag Vorlaufzeit bestellen und für die Tonband-Aufzeichnung einen Saugnapf vom Uher-Tonband am Telefon festpfriemeln, was nur nach nervtötender Fummelei funktionierte. Aber die technischen Finessen des Fernschreibers oder des „Spiegel“-Rohrpostsystems meisterte Heide Sommer souverän. Neben all den Steno-Diktaten und dem Abtippen handgeschriebener Texte kümmerte sie sich noch um Reisegeld-Abrechnungen, unverlangt eingereichte Manuskripte und um die Alltagsroutine der Redaktion: Heide Sommers Aufforderung an die Herren Redakteure „Lassen Sie mich mal machen“, passte denen gut ins Konzept, weil ihnen dieser Alltagskram zu unübersichtlich, kompliziert oder einfach nur lästig war. Aber deren Verdikt von der „Diktatur des Sekretariats“ war natürlich ironisch gemeint. „Ich hatte meine Redakteure fest im Griff“, konstatiert Heide Sommer selbstbewusst. Aus der subalternen Froschperspektive schildert sie ihre Zeit mit den prominenten Luftschiffern des Geistes jedenfalls nicht. Auch wenn bei der Charakterisierung ihres Helden Theo Sommer maximale Idealisierung und verliebte Heroisierung im Spiel ist.
Bei ihrem ersten Sommer-Treffen war der damals 32-Jährige ja bereits mit einer zehn Jahre älteren Frau verheiratet und schon früh Vater von zwei Kindern geworden. Diese Paar-Konstellation war also etwas kompliziert, doch für die optimistische, vom Theo-Aktivismus beflügelte Heide schien alles machbar zu sein.
Heide Grenz, Jahrgang 1940, wuchs im schöngeistigen, gutbürgerlichen Ambiente in Bad Kissingen auf: Der Vater war Komponist und Dirigent und eröffnete ihr nach dem Abitur, dass er ein Studium wegen eines geplanten Hausbaus nicht finanzieren könnte; sie müsste sich also allein durchschlagen. Das war für sie aber beim Umzug nach Hamburg keine große Sache. Bei Bau-Unternehmen, Schlepper-Firmen wie Bugsier und Fairplay im Hafen, bei asiatischen Im- und Export-Klitschen sammelte sie ihre Praxis-Erfahrungen und behauptete sich glänzend in einer auf Macho-Allüren und traditionelle Rollenmuster fixierten Männerwelt. Dazu merkt sie an, dass „antatschiges“ Verhalten der Männer sich damals anders abspielte als etwa das Bedrängen und Erpressen ambitionierter Schauspielerinnen von einem Harvey Weinstein heutzutage: „Wir fühlten uns damals nicht gedemütigt, sondern durch die Aufmerksamkeit guter, bedeutender oder berühmter Männer, in deren Glanz wir uns sonnten, eher geschmeichelt. Aber diese Männer wussten sich auch zu benehmen.“
Für das damalige 22-jährige „Fräulein Grenz“ (so nennt sie sich rückblickend) war jedenfalls ein Traum wahr geworden, als sie nach ihrem Erweckungserlebnis – der Podiumsdiskussion mit „Zeit“-Redakteur Theo Sommer im Hamburger Amerika-Haus über die US-Außenpolitik zur Kennedy-Zeit – tatsächlich einen Job bei der „Zeit“ bekam und der berühmten Edelfeder als Sekretärin nicht nur zuarbeiten konnte, sondern mit ihm auch über Themen und Texte diskutierte. Aus dem engen Arbeitsverhältnis wurde bald eine Affäre, dann die große Liebe mit anschließender Frust-Phase und anvisierter Trennung. Doch ihre Love Story köchelte weiter und wurde 1976 von der Eheschließung (mit Augstein als Trauzeugen) gekrönt. Die anschließenden massiven Irrungen/Wirrungen führten dann 1988 doch noch zur Scheidung. Diese privaten, emotionalen Erdbeben sollten uns eigentlich nicht weiter interessieren, sie wirkten sich aber ziemlich verheerend auf ihr Gemüt aus, weil Sommers Ehefrau intervenierte und für ein „Entsorgen“ der lästigen Rivalin bei der „Zeit“ sorgte: Heide Gertz wurde tatsächlich entlassen und in London beim „Institute of Strategic Studies“ entsorgt – wo sie depressiv und todunglücklich ein Jahr verbrachte. Besonders bitter: Der tolle Theo hatte das alles ohne Protest abgenickt. Was wohl auch ihren Blick für dessen plumpen Egoismus schärfte: Denn als sie mit Rudolf Augstein während des Wahlkampfs für drei Wochen in den erzkatholischen Wahlkreis Paderborn ziehen wollte, war Sommers spontane Reaktion die entrüstete Frage gewesen: „Wer brät mir dann mein Steak?“ Was sie nicht nur darin bestärkte, diesen grotesken Wahlkampf-Trip mit dem völlig überforderten, miserablen Redner Augstein nun erst recht zu machen. „Ich dachte nur „Arschloch“, vermerkt sie dazu trocken.
Überhaupt sind Heide Sommers kritisch-skeptische Kommentare über Augstein, Günter Gaus, Carl Zuckmayer, Raddatz und andere Größen bemerkenswert, denn sie illustrieren ihr gewaltiges Erkenntnisinteresse ebenso wie ihr unabhängiges Denken. Den tolpatschigen Rhetoriker Augstein kanzelt sie regelrecht ab („viel zu gehemmt und befangen, versagte kläglich, weil er die Freiburger Thesen, das neue Grundsatzprogramm der FDP, nicht gelesen hatte“); während sie trotz ihrer Sympathien für die illustre Mimose Raddatz dessen exorbitante Eitelkeit genau erkennt und angesichts seines Furors über lediglich „zwei Riesenfeten“ zu seinem Geburtstag trocken anmerkt „So kann man sich seine Kopfschmerzen auch selber machen.“
Ihre eigene Eitelkeit kommt immer dann zum Vorschein, wenn sie sich an den Rand geschoben fühlt: Mit Theo Sommer bereiste sie für einen großen „Zeit“-Bericht Israel nach dem Sechstagekrieg. Es gab viele Gespräche, offizielle Treffen, Feste mit hohen Militärs usw. Als Sommer nach dem Tod des Generals Scharon 2014 in einem Nachruf an einen Festabend mit Scharon erinnerte, kommentiert sie dies mit dem Hinweis, Scharon hätte damals die ganze Nacht nur mit ihr getanzt und keineswegs mit den Soldaten – „Ich trug ein hippiemäßig angehauchtes, zweiteiliges Leinengewand…“ usw. Auf einer halben Seite rutschen ihr dazu alle möglichen Details aus der Feder, auch das wohlwollende Kneifen des Generals in ihre Seite gehört dazu – wenn Theo nicht in der Nähe war…
Aber sei’s drum: Trotz der Überdosis an Theo-Episoden habe ich diesen mit Biss, Ironie und intelligenten Exkursen gewürzten Rückblick auf fünf Jahrzehnte mit berühmten Männern mit großem Genuss gelesen.
PS: Für die nächste Auflage kann der Verlag vielleicht schon eine Korrektur vormerken: „Gianni Schicchi“ hat nicht Rossini komponiert, sondern Puccini (vgl. S. 193).
Peter Münder
- Heide Sommer: Lassen Sie mich mal machen. Fünf Jahrzehnte als Sekretärin berühmter Männer. Ullstein Verlag, Berlin 2019.256 Seiten, 22 Euro.
Peter Münders Texte bei uns hier.











